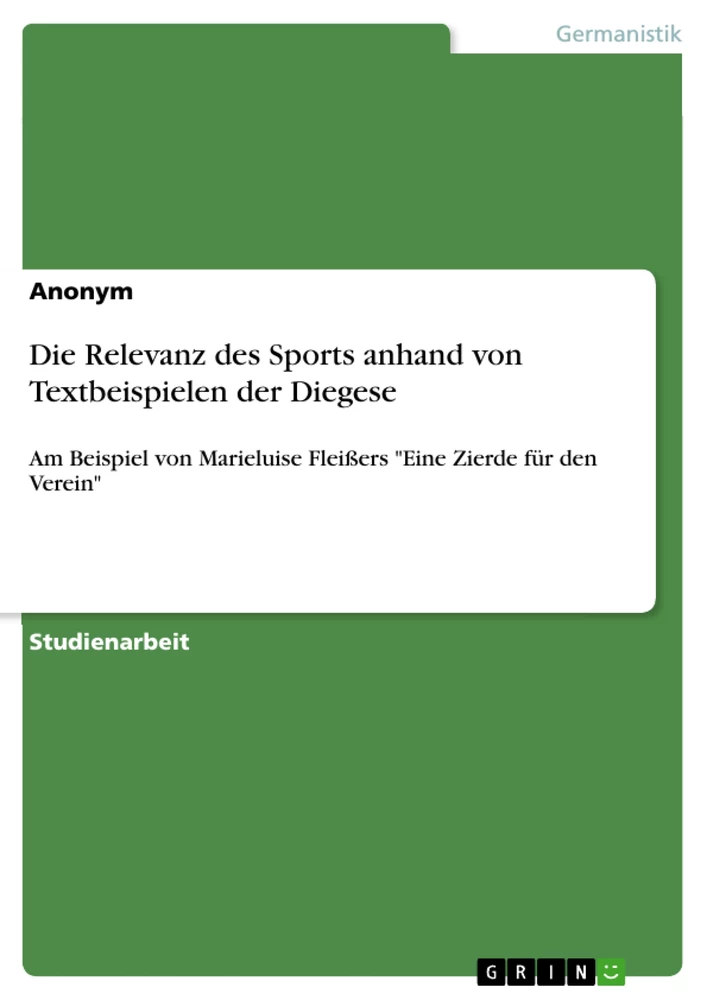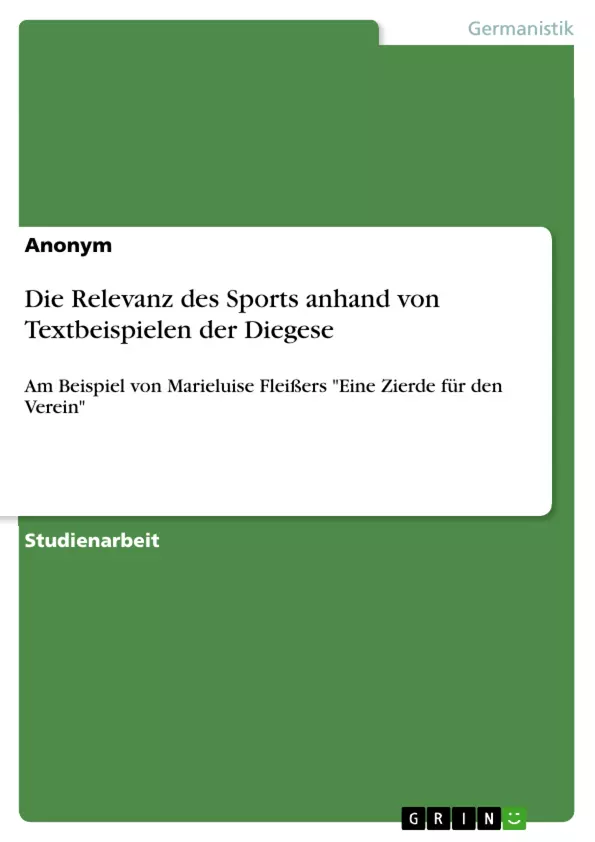Unter dem Titel "Mehlreisende Frieda Geier" 1931 erstmals veröffentlicht, wurde Marieluise Fleißers – teilweise autobiografischer – Roman während der Zeit des Nationalsozialismus auf die "Liste des schändlichen und unerwünschten Schrifttums" gesetzt und verboten. Resultierend aus ihren Erfahrungen in dieser Zeit, erschien 1972 "Eine Zierde für den Verein", die überarbeitete Fassung der "Mehlreisenden Frieda Geier".
Dieser Roman ist so viel mehr, als ein im Untertitel beschriebener "Roman vom Rauchen, Sporteln, Lieben und Verkaufen", denn die erzählte Welt der Endzwanziger Jahre ist durch ein patriarchalisches System scheinbar unüberwindbarer Rollenvorstellungen und brodelndem Antisemitismus geprägt. In diesem System muss sich Frieda Geier, erwerbstätige, selbstständige Frau, als eben diese gegen einen Mann profilieren, der Sport als ein Ventil seiner Aggressionen nutzt und versucht, sie in ihre gesellschaftlich vorgeschriebene Rolle der Ehefrau zu drängen. Im Folgenden wird die Beschreibung der Diegese mit Hilfe von Analysekriterien der Erzähltheorie im Vordergrund stehen und es wird auf die Relevanz des Sportes innerhalb der erzählten Welt, anhand von Beispielen, eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Diegese
- Gerard Genette
- Fiktionale Welt
- Stilistische Komplexität
- Relevanz des Sportes
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die erzählte Welt in Marieluise Fleißers Roman „Eine Zierde für den Verein“ und untersucht die Rolle des Sports in dieser Welt. Der Fokus liegt dabei auf der Beschreibung der Diegese und der Analyse der Bedeutung des Sports anhand von Beispielen aus dem Roman.
- Diegese als „raumzeitliches Universum der Erzählung“
- Analyse der fiktiven Welt und ihrer Verknüpfung mit der realen Welt
- Stilistische Komplexität der erzählten Welt: Uniregional und pluriregional
- Relevanz des Sports als Ventil für Aggressionen und als Mittel der sozialen Kontrolle
- Der Sport als Spiegelbild der gesellschaftlichen Verhältnisse in der Weimarer Republik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Text stellt den Roman „Eine Zierde für den Verein“ von Marieluise Fleißer vor, erläutert seine Entstehungsgeschichte und ordnet ihn in den Kontext der literarischen Neuen Sachlichkeit ein.
- Diegese: In diesem Kapitel wird die Diegese des Romans definiert und anhand von Analysekriterien der Erzähltheorie erklärt. Die fiktive Welt wird mit realen Elementen verknüpft und ihre stilistische Komplexität wird beschrieben.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Diegese, erzählte Welt, Sport, Aggression, soziale Kontrolle, Neue Sachlichkeit, Marieluise Fleißer, „Eine Zierde für den Verein“, Patriarchat, Emanzipation, Weimarer Republik.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Marieluise Fleißers Roman „Eine Zierde für den Verein“?
Der Roman thematisiert das Leben der selbstständigen Frieda Geier in der Weimarer Republik und ihren Kampf gegen patriarchale Rollenvorstellungen und sozialen Druck.
Welche Rolle spielt der Sport in der erzählten Welt?
Sport dient im Roman oft als Ventil für männliche Aggressionen und als Mittel der sozialen Kontrolle innerhalb eines Vereinswesens, das starre Rollenbilder festigt.
Was bedeutet der Begriff "Diegese"?
Diegese bezeichnet das raumzeitliche Universum der Erzählung, also die fiktive Welt, in der die Handlung des Romans stattfindet.
Wie wird das Patriarchat im Roman dargestellt?
Das Patriarchat zeigt sich durch Männer, die versuchen, Frauen in die traditionelle Rolle der Ehefrau zu drängen und ihre berufliche Selbstständigkeit zu untergraben.
Warum wurde der Roman während des Nationalsozialismus verboten?
Aufgrund der kritischen Darstellung gesellschaftlicher Zustände und der emanzipierten Frauenfigur entsprach das Werk nicht den ideologischen Vorstellungen der Nationalsozialisten.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Die Relevanz des Sports anhand von Textbeispielen der Diegese, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/513699