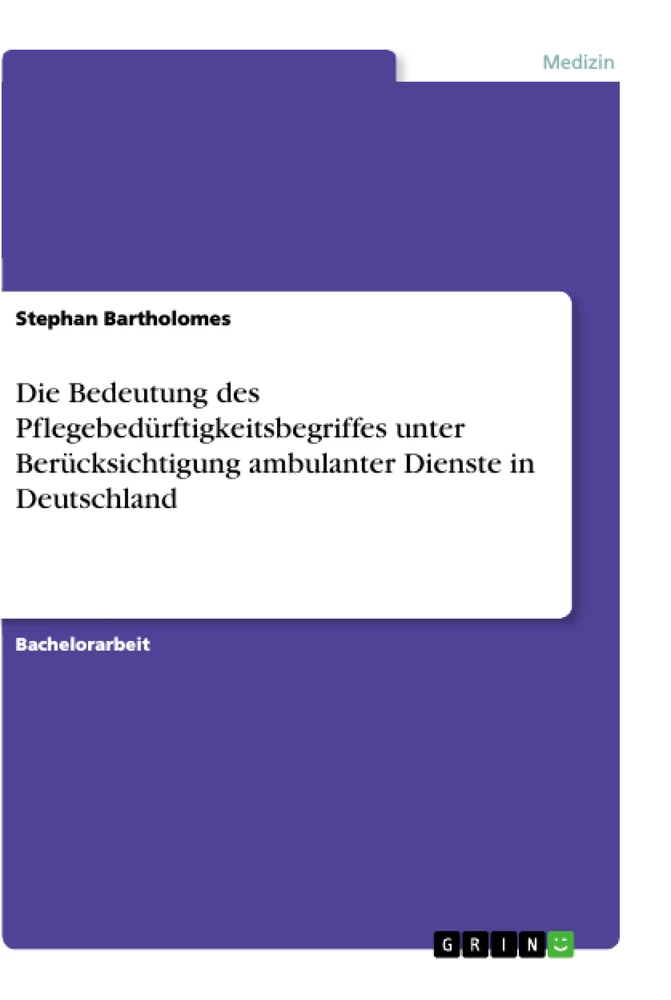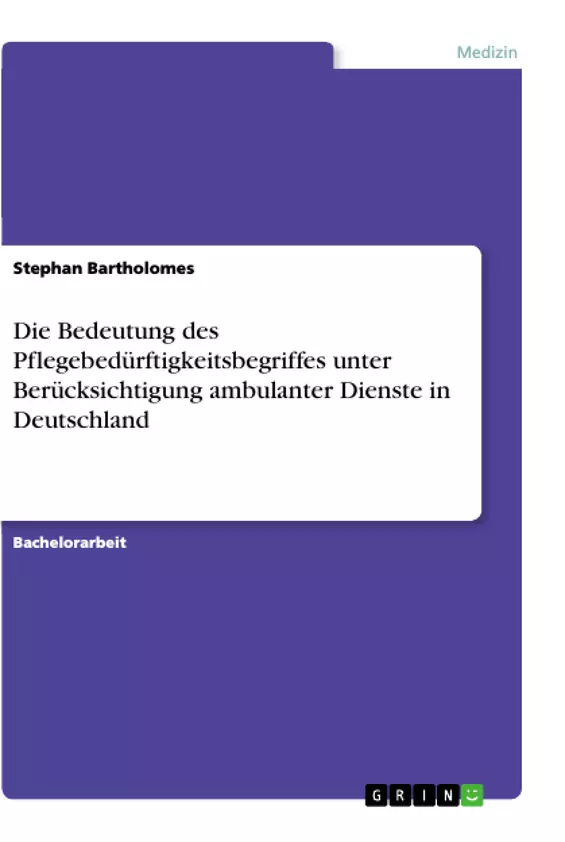Die vorliegende Bachelorarbeit strebt eine Auseinandersetzung mit einer denkbaren Einflussnahme des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes auf das Handeln ambulanter Dienste an. Hierbei sollen sowohl die Perspektiven professioneller Pflege und der ambulanten Dienste als auch die Bedürfnisse potenzieller KlientInnen berücksichtigt werden.
In Deutschland besteht die soziale Pflegeversicherung, die eine (Teil-) Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit vorsieht, seit dem Jahr 1995. Seither wurde dieser Versicherungszweig mehrfach reformiert, die Leistungen insbesondere für demenziell erkrankte Personen stetig ausgebaut. Eine Definition von Pflegebedürftigkeit als Leistungsvoraussetzung ist gesetzlich festgeschrieben. Diese Pflegebedürftigkeit wurde bis einschließlich 2016 anhand von vorhandenem Unterstützungsbedarf in den Bereichen "Körperpflege", "Ernährung", "Mobilität" und "Hauswirtschaftliche Versorgung" unter Zuhilfenahme von normierten zeitlichen Durchschnittswerten für einzelne Verrichtungen beurteilt. Der individuelle Hilfebedarf wurde zuletzt in drei Pflegestufen sowie im Vorhandensein eingeschränkter Alltagskompetenz ausgedrückt
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Abstract
- Abkürzungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Problembeschreibung
- 2.1 Pflegebedürftigkeit
- 2.2 Häusliche Pflege
- 2.2.1 Pflegende Angehörige
- 2.2.2 Professionelle ambulante Pflege
- 3. Zielsetzung und Fragestellung
- 4. Methodik
- 4.1 Literaturrecherche mittels Suchmaschinen
- 4.2 Ein- und Ausschlusskriterien
- 5. Theoretischer Rahmen zum SGB XI
- 5.1 Pflegebedürftigkeitsbegriff seit 1995
- 5.2 Pflegebedürftigkeitsbegriff seit 2017
- 6. Professionelle Pflege
- 6.1 Normative Grundlagen professioneller Pflege
- 6.2 Gesetzliche Grundlagen professioneller Pflege
- 6.3 Professionelle Pflege vs. Laienpflege
- 7. Das Gesundheitssystem in Deutschland
- 8. Sozialpolitische Geschichte des Pflegebedürftigkeitsbegriffes
- 8.1 Situation nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Einführung der Pflegeversicherung
- 8.2 Kritik am Pflegebedürftigkeitsbegriff und Reformen
- 8.3 Der Weg zu einem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff
- 8.4 Kritik und Erwartungen an das PSG II
- 9. Strukturelle und organisatorische Merkmale ambulanter Dienste
- 9.1 Situation ambulanter Dienste in Deutschland
- 9.2 Sichtweise der professionellen ambulanten Pflege
- 9.3 Bedürfnisse und Wünsche potenzieller Klientel
- 9.3.1 Pflegebedürftige
- 9.3.2 Pflegende Angehörige
- 9.4 Leistungsspektrum ambulanter Dienste in Deutschland
- 10. Beschäftigungsbedingungen in ambulanten Diensten
- 11. Zukünftiger Qualifikationsbedarf ambulant Pflegender
- 12. Diskussion
- 13. Schlussfolgerungen und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der möglichen Einflussnahme des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes auf das Handeln ambulanter Dienste. Es sollen sowohl die Perspektiven der professionellen Pflege und der ambulanten Dienste als auch die Bedürfnisse potenzieller KlientInnen berücksichtigt werden.
- Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff und seine Auswirkungen auf die ambulante Pflege.
- Die Bedürfnisse von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen in Bezug auf die häusliche Pflege.
- Das Leistungsspektrum ambulanter Dienste und dessen Ausrichtung auf die Bedürfnisse der KlientInnen.
- Die personellen Ressourcen ambulanter Dienste und deren Bereitschaft auf eine Erweiterung des Leistungsspektrums.
- Die Notwendigkeit weiterer Forschung zur tatsächlichen Nutzung des erweiterten Leistungsspektrums und der Entwicklung zielgruppengerechter Angebote.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Einführung in die Thematik der häuslichen Pflege und die Relevanz des Pflegebedürftigkeitsbegriffes.
- Kapitel 2: Problembeschreibung
Definition des Begriffs "Pflegebedürftigkeit" und Darstellung der verschiedenen Formen der häuslichen Pflege, insbesondere der Rolle pflegender Angehöriger und der professionellen ambulanten Pflege.
- Kapitel 3: Zielsetzung und Fragestellung
Formulierung der Forschungsfrage und Darstellung der Ziele der Bachelorarbeit.
- Kapitel 4: Methodik
Beschreibung der verwendeten Forschungsmethodik, insbesondere der Literaturrecherche und der Auswahl der relevanten Studien.
- Kapitel 5: Theoretischer Rahmen zum SGB XI
Darstellung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes im Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) und seine Entwicklung seit 1995.
- Kapitel 6: Professionelle Pflege
Analyse der normativen und gesetzlichen Grundlagen professioneller Pflege sowie des Unterschieds zwischen professioneller und Laienpflege.
- Kapitel 7: Das Gesundheitssystem in Deutschland
Kurze Darstellung des deutschen Gesundheitssystems im Kontext der häuslichen Pflege.
- Kapitel 8: Sozialpolitische Geschichte des Pflegebedürftigkeitsbegriffes
Verfolgung der Entwicklung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes von der Nachkriegszeit bis zur Einführung der Pflegeversicherung und der aktuellen Reformen.
- Kapitel 9: Strukturelle und organisatorische Merkmale ambulanter Dienste
Analyse der Situation ambulanter Dienste in Deutschland, der Sichtweise der professionellen ambulanten Pflege und der Bedürfnisse potenzieller KlientInnen.
- Kapitel 10: Beschäftigungsbedingungen in ambulanten Diensten
Darstellung der Beschäftigungsbedingungen in ambulanten Diensten und deren Einfluss auf die Qualität der Pflege.
- Kapitel 11: Zukünftiger Qualifikationsbedarf ambulant Pflegender
Analyse des zukünftigen Qualifikationsbedarfs in der ambulanten Pflege.
- Kapitel 12: Diskussion
Diskussion der Ergebnisse und der Forschungslücken.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind ambulante Dienste, häusliche Pflege, Pflegebedürftigkeit, Soziale Pflegeversicherung, sowie die Bedürfnisse von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde Pflegebedürftigkeit vor der Reform 2017 definiert?
Bis 2016 basierte die Einstufung auf dem zeitlichen Hilfebedarf bei Verrichtungen der Grundpflege (Körperpflege, Ernährung, Mobilität) und wurde in drei Pflegestufen unterteilt.
Was änderte sich mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff ab 2017?
Der Fokus verschob sich von Minutenwerten hin zur individuellen Beeinträchtigung der Selbstständigkeit. Es wurden fünf Pflegegrade eingeführt, die auch kognitive und psychische Belastungen (z.B. Demenz) besser berücksichtigen.
Welche Rolle spielen ambulante Dienste in der häuslichen Pflege?
Ambulante Dienste unterstützen Pflegebedürftige und ihre Angehörigen professionell zu Hause, um einen Heimaufenthalt zu vermeiden oder hinauszuzögern.
Was sind die Erwartungen an das Pflegestärkungsgesetz II (PSG II)?
Das PSG II soll eine gerechtere Leistungsverteilung ermöglichen, insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, und die Qualität der ambulanten Versorgung stärken.
Welche Bedürfnisse haben pflegende Angehörige?
Angehörige benötigen vor allem Entlastung durch professionelle Dienste, Beratung und eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, um einer eigenen Überlastung vorzubeugen.
- Quote paper
- Stephan Bartholomes (Author), 2017, Die Bedeutung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes unter Berücksichtigung ambulanter Dienste in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/513851