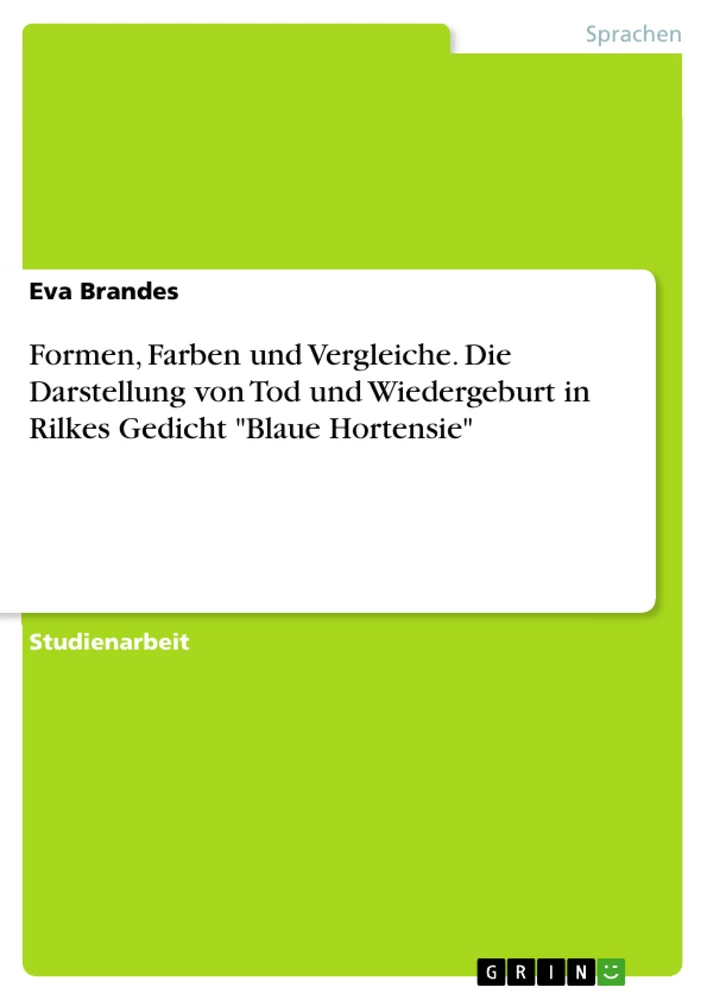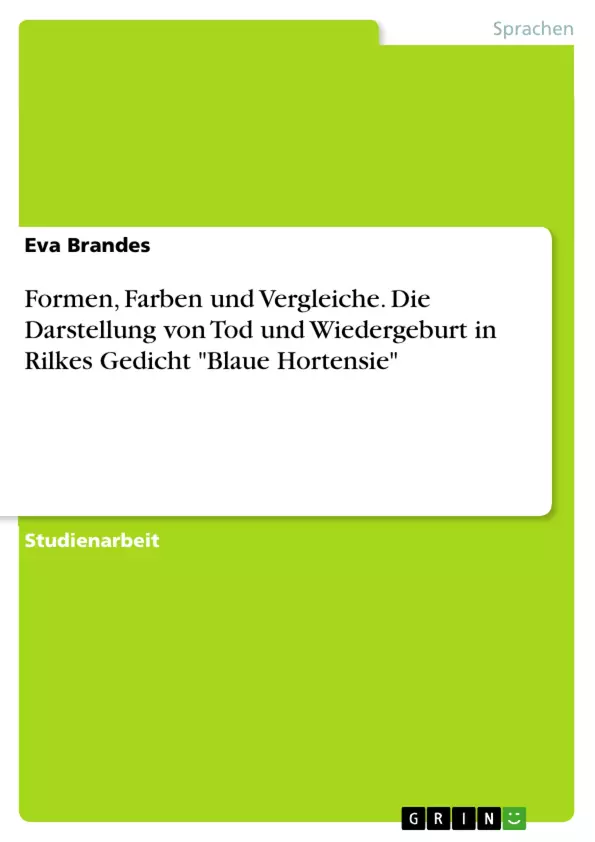„Im internationalen Kontext gesehen, stellen Rilkes Neue Gedichte eine der großen Errungenschaften der modernen Literatur dar.“ Das Neue an diesen Gedichten, die zwischen 1903 und 1907 hauptsächlich in Paris und Meudon entstanden, stellt die veränderte Sicht des Autors auf das Gegenständliche dar. Rilke offenbart seine Sensibilität und seine Erfahrungen mit den Dingen in der Welt und ist nicht mehr versucht, sie so objektiv und präzise wie möglich zu beschreiben. Innerhalb der Neuen Gedichte gibt es einen kleineren Zyklus von etwa neun Gedichten, die vom Leben in den Tod führen. Brinkmann bemerkt, dass sich Dinge bei Rilke wie auf magische Weise verselbstständigten und erlöst würden, sobald der Mensch ihr Wesen erkenne. Einen sehr wichtigen Wendepunkt innerhalb dieser „Todesdichtung“ stellt wiederum das Gedicht Blaue Hortensie dar, dessen Ende ein erneutes Aufleben beschreibt. Die in dem Gedicht thematisierte Pflanze kann sich kurz vor ihrem Tod einer Wiedergeburt erfreuen. Es scheint besonders die Malerei Manets und Cézannes gewesen zu sein, die den Autor dazu anregte, das Gedicht im Juli 1906 in Paris zu schreiben und dabei die Farben in den Mittelpunkt zu rücken. Mit den Gestaltungsmitteln in Rilkes Blaue Hortensie haben sich bereits zahlreiche Literaturforscher auseinandergesetzt. Auch die Themen Sterblichkeit, Tod und Leben werden im Zusammenhang mit diesem Gedicht immer wieder genannt. In welchem Verhältnis die Gestaltungsmittel zur Thematik stehen und inwiefern sie zur Darstellung von Tod und Wiedergeburt verhelfen, soll in dieser Arbeit untersucht werden. Dazu wird zunächst die Form des Gedichts analysiert und in einen Zusammenhang mit dem Inhalt gestellt. Anschließend wird der Fokus auf die Verwendung von Farbelementen gelegt, da diese im vorliegenden Gedicht besonders präsent sind. Dazu wird eine kurze Einleitung in die Farbsymbolik gegeben, um auf dieser Grundlage die Farben im Gedicht analysieren zu können. Im nächsten Schritt wird das Augenmerk auf die Benutzung der dem Gedicht innewohnenden Vergleiche gelegt, wobei vorab definiert wird, was dieses Stilmittel ausmacht.
Auf den gewonnenen Erkenntnissen aufbauend soll letztlich zu einer eigenen Schlussfolgerung gelangt werden, die den Zusammenhang zwischen der Darstellung von Tod und Wiedergeburt und den o.g. formalen, semantischen und rhetorischen Gestaltungsmitteln betrifft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Formale Analyse
- Semantische und rhetorische Analyse
- Farben
- Vergleiche
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Rilkes Gedicht „Blaue Hortensie“ und untersucht den Zusammenhang zwischen der Darstellung von Tod und Wiedergeburt und den formalen, semantischen und rhetorischen Gestaltungsmitteln. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Verwendung von Farben und Vergleichen, die in diesem Gedicht eine zentrale Rolle spielen.
- Analyse der formalen Struktur des Gedichts
- Untersuchung der Verwendung von Farben als Symbol
- Bedeutung und Funktion von Vergleichen im Gedicht
- Beziehung zwischen Gestaltungsmitteln und der Darstellung von Tod und Wiedergeburt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Gedicht „Blaue Hortensie“ in den Kontext der „Neuen Gedichte“ von Rainer Maria Rilke und beleuchtet die veränderte Sichtweise des Autors auf das Gegenständliche. Es wird darauf hingewiesen, dass das Gedicht einen wichtigen Wendepunkt innerhalb von Rilkes „Todesdichtung“ darstellt und die Wiedergeburt der Hortensie thematisiert.
Formale Analyse
Dieser Abschnitt analysiert die formale Struktur des Gedichts. Es wird festgestellt, dass Rilke die Form des Sonetts verwendet, jedoch mit einigen Abweichungen vom klassischen Schema. Der Fokus liegt dabei auf der Reimproblematik, dem Rhythmus und dem inhaltlichen Aufbau.
Semantische und rhetorische Analyse: Farben
Dieser Abschnitt untersucht die Bedeutung von Farben in „Blaue Hortensie“. Es wird eine kurze Einleitung in die Farbsymbolik gegeben, um die Bedeutung von Blau und Grün im Kontext des Gedichts zu analysieren.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenfelder des Textes sind: Rainer Maria Rilke, „Blaue Hortensie“, „Neue Gedichte“, Tod, Wiedergeburt, Farbsymbolik, Sonett, formale Analyse, semantische Analyse, rhetorische Analyse.
- Quote paper
- Eva Brandes (Author), 2017, Formen, Farben und Vergleiche. Die Darstellung von Tod und Wiedergeburt in Rilkes Gedicht "Blaue Hortensie", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/513880