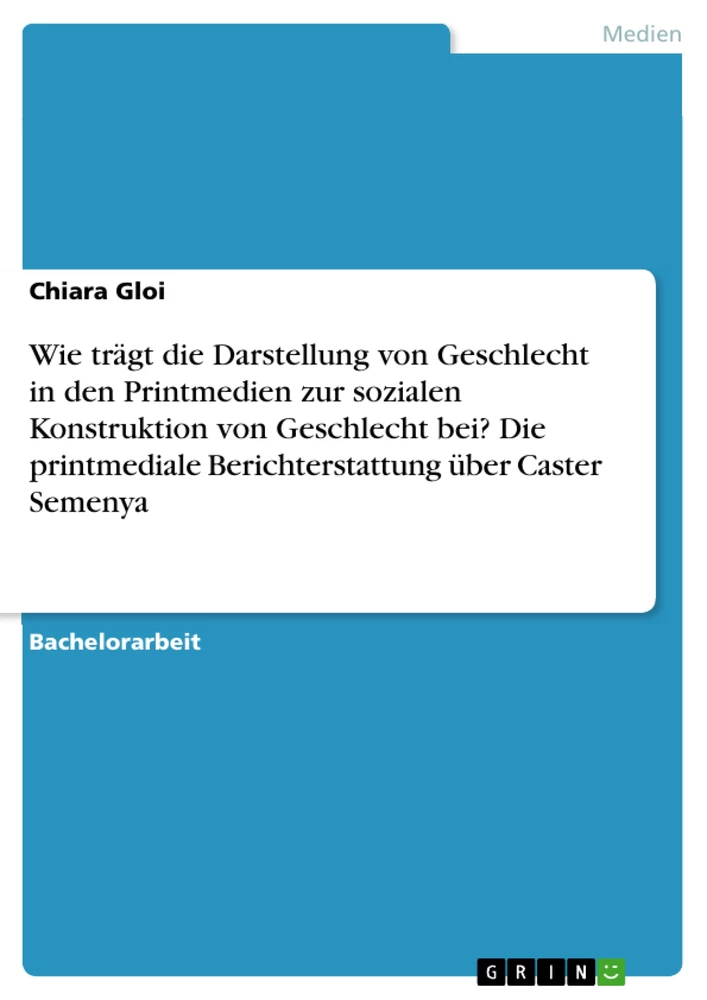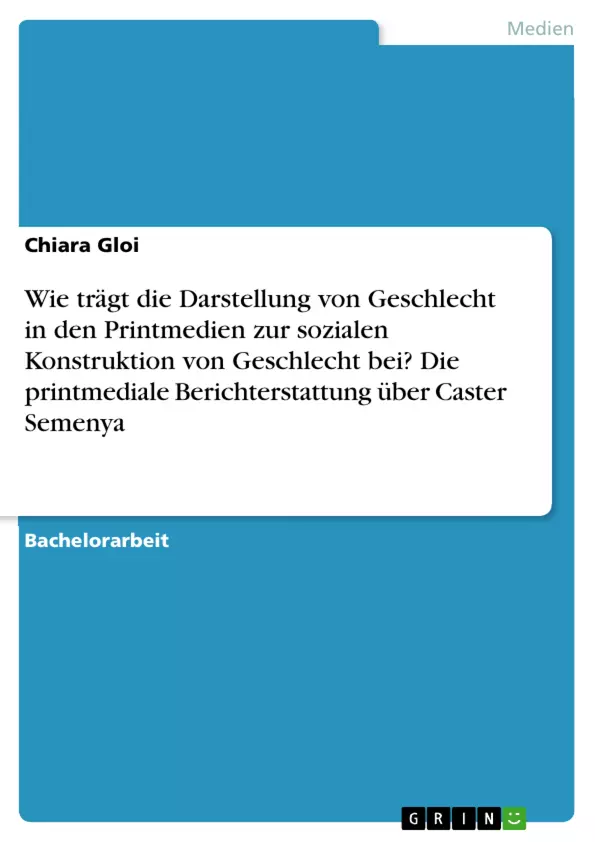Ziel der Arbeit ist es zu zeigen, wie die Darstellung von Geschlecht in den Printmedien, in diesem Fall am Beispiel Caster Semenya, zur sozialen Konstruktion von Geschlecht beiträgt.
Zunächst wird der Frage nachgegangen, was die Mehrheit unserer Gesellschaft unter dem Begriff des Geschlechtes versteht und inwiefern dieser differenziert werden kann. Hierbei soll zunächst auf Ansätze der Frauen- und Geschlechterforschung eingegangen werden, die auf der Unterscheidung zwischen biologischem und psychosozialem Geschlecht basieren. Diese sollen im Anschluss um ein konstruktivistisches Verständnis von Geschlecht, entlang des Konzeptes der sozialen Konstruktion erweitert und im Folgenden - angesichts der zentralen Bedeutung von Massenmedien - beleuchtet werden. Anschließend soll der Diskurs über den Fall von Caster Semenya in groben Zügen skizziert werden, um so wichtige Ereignisse chronologisch einordnen zu können. An dieser Stelle soll der Begriff der Intersexualität in einem Exkurs kurz erläutert werden. Auf dieser Grundlage wird im Anschluss der Fokus auf die printmediale Berichterstattung und die Darstellung über das Geschlecht von Caster Semenya gerichtet. Vertiefend wird der Frage nachgegangen, wie das Geschlecht von Caster Semenya in den Jahren 2009 und 2019 printmedial dargestellt wurde und ob sich die Darstellung in diesen zehn Jahren verändert hat. Diese Fragestellungen sollen stets vor dem Hintergrund der sozialen Konstruktion von Geschlecht untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.2 Vorgehen und Ziel der Untersuchung
- 1.3 Forschungsstand
- 2. Geschlecht
- 2.1 Biologisches Geschlecht
- 2.2 Psychosoziales Geschlecht
- 3. Soziale Konstruktion von Geschlecht
- 3.1 Soziale Konstruktion von Geschlecht in den Medien
- 4. Der Fall Caster Semenya
- 4.1 Exkurs: Intersexualität
- 5. Methode
- 5.1 Fragestellungen
- 5.2 Qualitative Inhaltsanalyse als Methode
- 5.2.1 Strukturierte Inhaltsanalyse nach Mayring
- 5.3 Durchführung
- 5.3.1 Bestimmung Ausgangsmaterial
- 5.4 Kategoriensystem
- 6. Analyseergebnisse
- 6.1 Süddeutsche Zeitung 2009
- 6.2 Frankfurter Allgemeine Zeitung 2009
- 6.3 Süddeutsche Zeitung 2019
- 6.4 Frankfurter Allgemeine Zeitung 2019
- 7. Ergebnisse
- 7.1 Forschungsfrage 1: Wie wird das Geschlecht in der printmedialen Berichterstattung 2009 und 2019 dargestellt?
- 7.2 Forschungsfrage 2: Hat sich die Darstellung über das Geschlecht in den zehn Jahren entscheidend verändert?
- 8. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die soziale Konstruktion von Geschlecht im Kontext der printmedialen Berichterstattung über Caster Semenya. Ziel ist es, die Darstellung von Geschlecht in der Berichterstattung aus den Jahren 2009 und 2019 zu analysieren und Veränderungen im Laufe der Zeit zu identifizieren.
- Soziale Konstruktion von Geschlecht
- Geschlechtliche Identität und Intersexualität
- Medien und Sport
- Diskriminierung und Stereotypisierung
- Normativität und Abweichung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der sozialen Konstruktion von Geschlecht ein und stellt den Fall Caster Semenya als Ausgangspunkt der Arbeit vor. Kapitel 2 definiert das Geschlecht und differenziert zwischen biologischem und psychosozialem Geschlecht. Kapitel 3 widmet sich der sozialen Konstruktion von Geschlecht und beleuchtet insbesondere die Rolle der Medien in diesem Prozess. In Kapitel 4 wird der Fall Caster Semenya näher betrachtet und der Begriff der Intersexualität erläutert. Kapitel 5 beschreibt die Methodik der Arbeit, die auf einer strukturierten Inhaltsanalyse nach Mayring basiert. Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse der Analyse der printmedialen Berichterstattung über Caster Semenya in den Jahren 2009 und 2019. Kapitel 7 diskutiert die Ergebnisse und beantwortet die Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Soziale Konstruktion von Geschlecht, Intersexualität, Caster Semenya, printmediale Berichterstattung, Geschlechtliche Identität, Sport, Medien, Diskriminierung, Stereotypisierung, Normativität, Abweichung, Qualitative Inhaltsanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Wie tragen Medien zur sozialen Konstruktion von Geschlecht bei?
Medien vermitteln Normen und Stereotypen. Durch die Art der Berichterstattung definieren sie, was als „normales“ männliches oder weibliches Verhalten gilt.
Warum ist der Fall Caster Semenya so relevant?
Der Fall der Leichtathletin löste eine weltweite Debatte über Intersexualität, Testosteronwerte und die binäre Geschlechterordnung im Sport aus.
Was ist der Unterschied zwischen biologischem und psychosozialem Geschlecht?
Biologisches Geschlecht (Sex) bezieht sich auf körperliche Merkmale, während psychosoziales Geschlecht (Gender) die kulturell geprägte Identität und Rolle beschreibt.
Wie hat sich die Berichterstattung zwischen 2009 und 2019 verändert?
Die Arbeit analysiert mittels Inhaltsanalyse der Süddeutschen Zeitung und FAZ, ob sich die Darstellung von Caster Semenya über zehn Jahre hinweg gewandelt hat.
Was bedeutet Intersexualität im sportlichen Kontext?
Es beschreibt Menschen, deren biologische Merkmale nicht eindeutig der binären Norm von „männlich“ oder „weiblich“ zugeordnet werden können, was zu regulatorischen Herausforderungen führt.
- Citar trabajo
- Chiara Gloi (Autor), 2019, Wie trägt die Darstellung von Geschlecht in den Printmedien zur sozialen Konstruktion von Geschlecht bei? Die printmediale Berichterstattung über Caster Semenya, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/513896