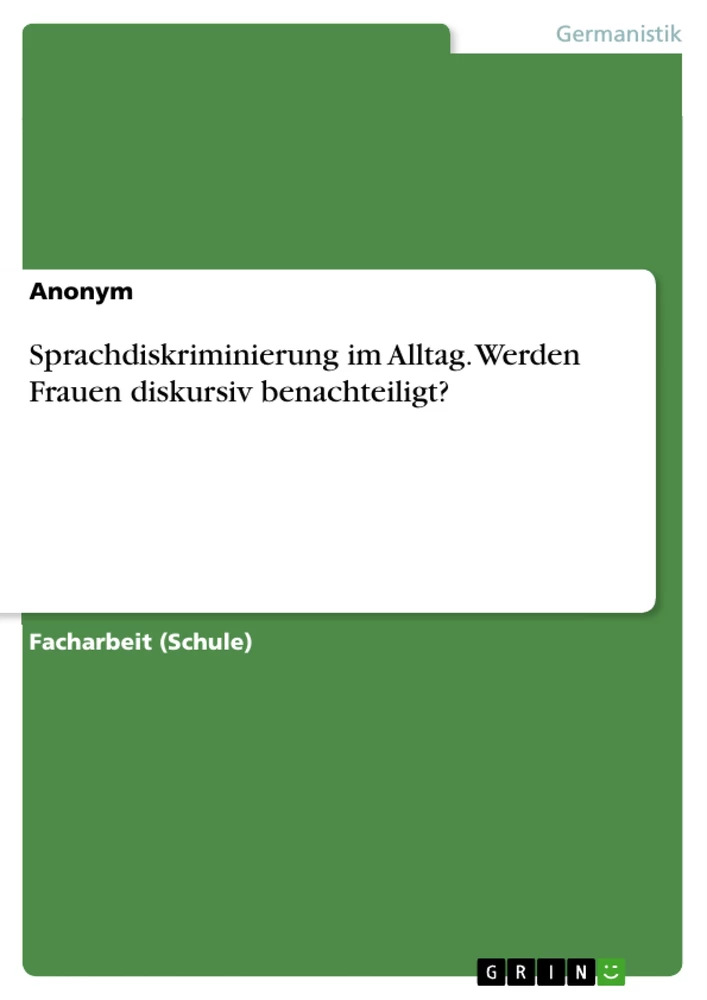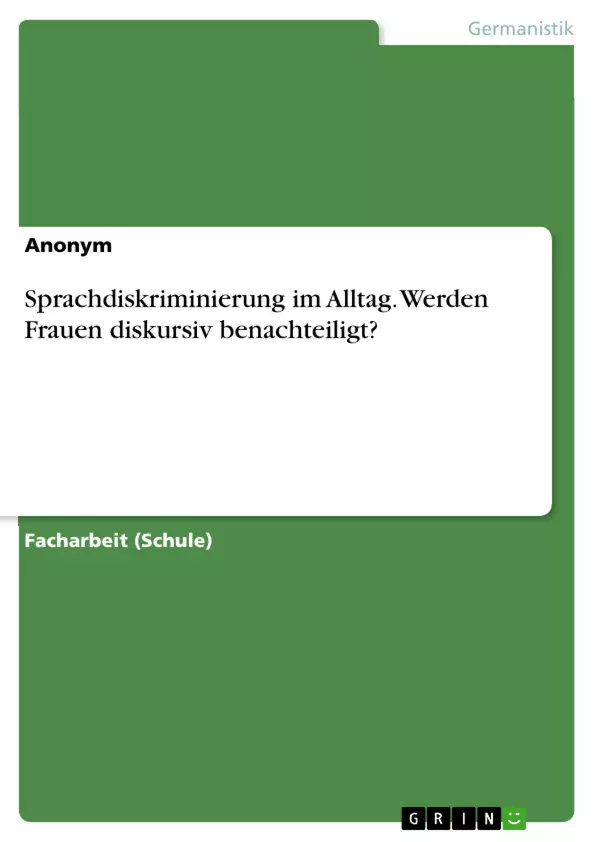Ist die deutsche Sprache frauenfeindlich? Werden Frauen unzureichend beachtet? Zwar sind Männer und Frauen laut Gesetz gleichgestellt, doch sind sie es auch in unseren Köpfen und in unserer Sprache? Mit der vorliegenden Facharbeit wird beiden Positionen nachgegangen und eben diese Frage genauer untersucht.
Um diese Fragen klären zu können, wendet sich die Autorin zuerst der allgemeinen Diskriminierung durch Sprache im Alltag zu und versucht dann die Frage zu beantworten, ob die Muttersprache unser Denken beeinflusst. Danach geht sie auf die Genderdiskriminierung und auf die gendergerechte Sprache ein.
Abschließend wird eine Umfrage folgen, die zeigt, wie viele Bürgerinnen und Bürger die gendergerechte Sprache verwenden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Diskriminierung im Alltag
- 3. Diskriminierung in unserer Sprache
- 3.1 Diskriminierung als sprachliches Grundprinzip
- 3.2 Beeinflusst Sprache unser Denken?
- 3.2.1 Raum- und Zeitvorstellungen
- 3.2.2 Facetten der Erinnerung
- 4. Genderdiskriminierung im Alltag
- 4.1 Feministische Sprachkritik
- 4.2 Lösungsansätze der gendergerechten Sprache
- 4.3 Gendergerechte Sprache Pro und Contra
- 5. Umfrage: Gendergerechte Sprache
- 5.1 Fragestellungen und Hypothesen
- 5.2 Durchführung
- 5.3 Auswertung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit untersucht die Frage, ob die deutsche Sprache Frauen benachteiligt. Sie beleuchtet die allgemeine Diskriminierung durch Sprache im Alltag und geht der Frage nach, inwiefern die Muttersprache unser Denken beeinflusst. Ein Schwerpunkt liegt auf der Genderdiskriminierung und der gendergerechten Sprache. Die Arbeit wird durch eine Umfrage ergänzt, die die Verwendung gendergerechter Sprache in der Bevölkerung untersucht.
- Diskriminierung durch Sprache im Alltag
- Der Einfluss der Muttersprache auf das Denken
- Genderdiskriminierung in der deutschen Sprache
- Gendergerechte Sprache: Argumente pro und contra
- Empirische Untersuchung zur Verwendung gendergerechter Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Genderdiskriminierung in der deutschen Sprache ein und stellt die Forschungsfrage nach einer möglichen Benachteiligung von Frauen in der Sprache. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die verschiedenen Aspekte, die untersucht werden, darunter allgemeine Diskriminierung, der Einfluss der Sprache auf das Denken und die Diskussion um gendergerechte Sprache. Die Einleitung verdeutlicht die Relevanz des Themas im Kontext aktueller gesellschaftlicher Debatten und der linguistischen Forschung.
2. Diskriminierung im Alltag: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Formen von Diskriminierung, die im Alltag auftreten können. Es differenziert zwischen personaler, direkter, indirekter und institutioneller Diskriminierung, jeweils mit Beispielen. Die Ausführungen zeigen, wie Diskriminierung in verschiedenen Bereichen des Lebens auftritt und wie sie sich in unterschiedlichen Formen manifestiert. Die Kapitel verdeutlicht die Vielschichtigkeit von Diskriminierung und ihre weitreichenden Auswirkungen.
3. Diskriminierung in unserer Sprache: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Sprache bei der Diskriminierung. Es wird argumentiert, dass Sprache nicht nur ein Medium der Diskriminierung ist, sondern dass Diskriminierung auch in den grundlegenden Strukturen der Sprache verankert sein kann. Der Abschnitt 3.1 beleuchtet den Begriff „Diskriminierung“ in seiner etymologischen Entwicklung und dessen Bedeutungswandel vom „Trennen“ zum „Abwerten“. Abschnitt 3.2 erörtert den Einfluss der Sprache auf unser Denken und beleuchtet den Zusammenhang zwischen Sprache, Wahrnehmung und Kognition anhand von Raum- und Zeitvorstellungen.
Schlüsselwörter
Diskriminierung, Sprache, Gender, Gendergerechte Sprache, Muttersprache, Denken, Wahrnehmung, Gleichstellung, Feministische Sprachkritik, Soziale Ungleichheit, Alltagsdiskriminierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Facharbeit: Genderdiskriminierung in der deutschen Sprache
Was ist der Gegenstand dieser Facharbeit?
Die Facharbeit untersucht die Frage, ob die deutsche Sprache Frauen benachteiligt. Sie analysiert die allgemeine Diskriminierung durch Sprache im Alltag und den Einfluss der Muttersprache auf unser Denken. Ein Schwerpunkt liegt auf der Genderdiskriminierung und gendergerechter Sprache, ergänzt durch eine empirische Umfrage zur Verwendung gendergerechter Sprache in der Bevölkerung.
Welche Themen werden in der Facharbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Diskriminierung durch Sprache im Alltag, den Einfluss der Muttersprache auf das Denken, Genderdiskriminierung in der deutschen Sprache, gendergerechte Sprache (Pro und Contra) und eine empirische Untersuchung zur Verwendung gendergerechter Sprache.
Wie ist die Facharbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Diskriminierung im Alltag, Diskriminierung in unserer Sprache (inkl. Unterkapiteln zu Diskriminierung als sprachliches Grundprinzip und dem Einfluss von Sprache auf unser Denken), Genderdiskriminierung im Alltag (inkl. Unterkapiteln zu feministischer Sprachkritik, Lösungsansätzen und Pro/Contra-Argumenten zur gendergerechten Sprache), eine Umfrage zur gendergerechten Sprache (inkl. Fragestellungen, Durchführung und Auswertung) und ein Fazit.
Was wird in Kapitel 1 (Einleitung) behandelt?
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach einer möglichen Benachteiligung von Frauen in der Sprache vor, skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die untersuchten Aspekte (allgemeine Diskriminierung, Einfluss der Sprache auf das Denken, gendergerechte Sprache). Sie verdeutlicht die Relevanz des Themas.
Was wird in Kapitel 2 (Diskriminierung im Alltag) behandelt?
Kapitel 2 beschreibt verschiedene Formen von Diskriminierung (personale, direkte, indirekte, institutionelle) mit Beispielen und zeigt deren Vielschichtigkeit und Auswirkungen.
Was wird in Kapitel 3 (Diskriminierung in unserer Sprache) behandelt?
Kapitel 3 untersucht die Rolle der Sprache bei der Diskriminierung. Es argumentiert, dass Diskriminierung in den Strukturen der Sprache verankert sein kann. Es beleuchtet den Begriff „Diskriminierung“ etymologisch und erörtert den Einfluss der Sprache auf unser Denken anhand von Raum- und Zeitvorstellungen.
Was wird in Kapitel 4 (Genderdiskriminierung im Alltag) behandelt?
Kapitel 4 befasst sich mit Genderdiskriminierung, feministischer Sprachkritik und Lösungsansätzen der gendergerechten Sprache. Es diskutiert Argumente für und gegen gendergerechte Sprache.
Was wird in Kapitel 5 (Umfrage: Gendergerechte Sprache) behandelt?
Kapitel 5 beschreibt eine empirische Untersuchung zur Verwendung gendergerechter Sprache: Fragestellungen, Hypothesen, Durchführung und Auswertung der Umfrage.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Facharbeit?
Schlüsselwörter sind: Diskriminierung, Sprache, Gender, Gendergerechte Sprache, Muttersprache, Denken, Wahrnehmung, Gleichstellung, Feministische Sprachkritik, Soziale Ungleichheit, Alltagsdiskriminierung.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Sprachdiskriminierung im Alltag. Werden Frauen diskursiv benachteiligt?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/513917