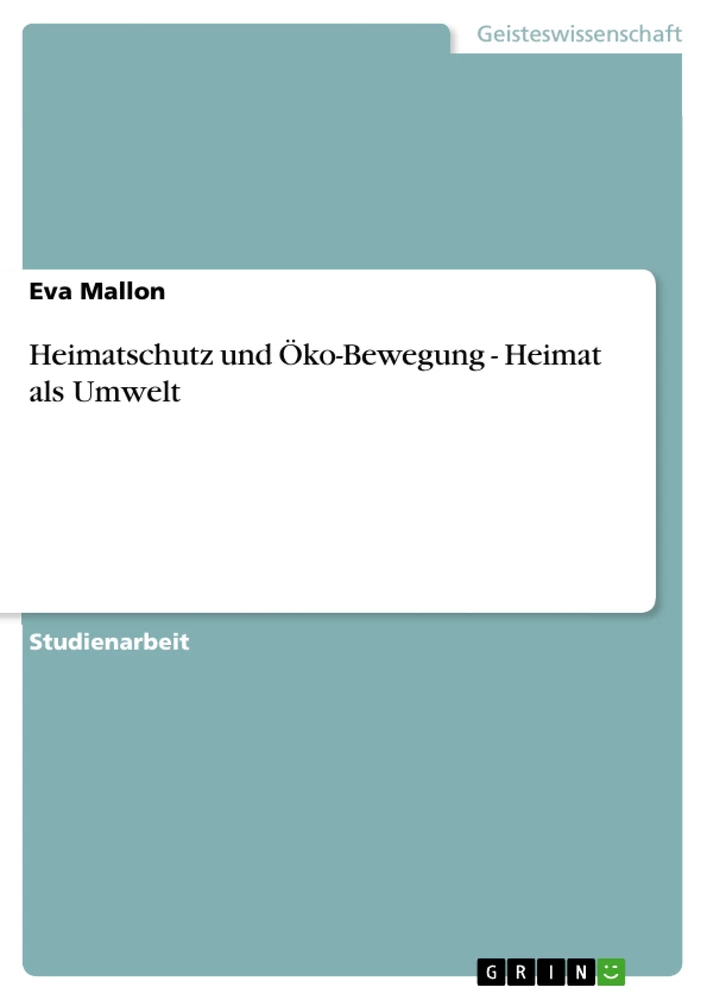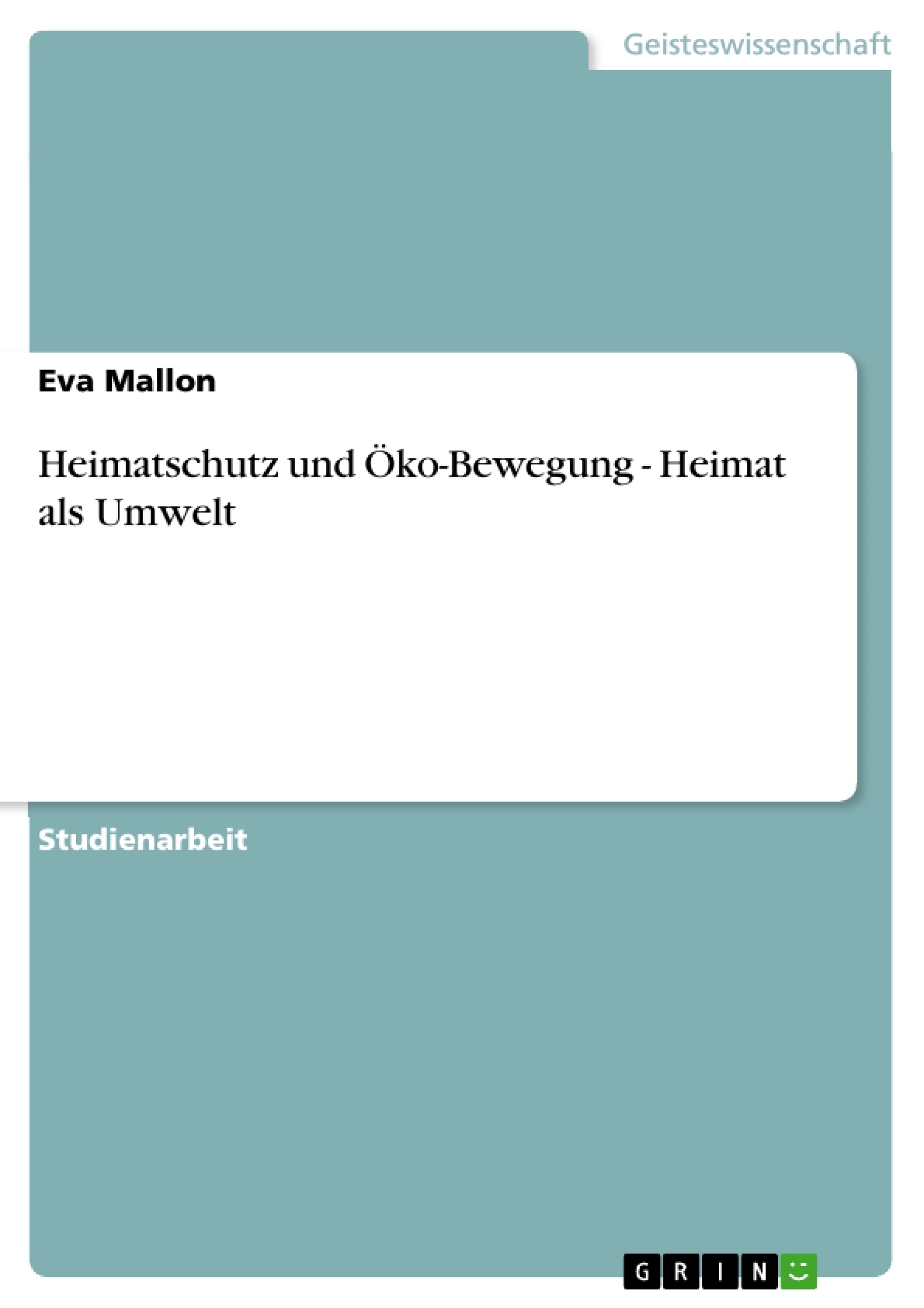Der Begriff Heimat lässt sich schwer in eine allgemein gültige Definition fassen, da seine Bedeutung stark vom zeitlichen sowie kulturellen Kontext abhängig ist. Ferner unterliegt er einer individuellen Bedeutungsbemessung, was die Auseinandersetzung unter wissenschaftlichen Bedingungen erschwert. Gegenstand dieser Arbeit ist die kulturanthropologische Untersuchung der Lebensumstände in der Zeit zwischen der Jahrhundertwende und den 1970er Jahren in Deutschland - ein Zeitraum, der von gravierenden Veränderungen der Lebensumstände gekennzeichnet ist. Fokus der Arbeit ist die Wahrnehmung der Heimat als Umwelt und somit Lebensgrundlage der Menschen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einführung in die Begriffe Heimat, Natur und Umwelt
- 2.1. Heimat
- 2.2. Natur
- 2.3. Umwelt
- 3. Auswirkungen von Industrialisierung und Urbanisierung in Deutschland im 19. Jahrhundert: Vom Wandel der Umwelt und des Umgangs mit der Natur
- 3.1. Industrialisierung
- 3.2. Urbanisierung
- 4. Die Entstehung eines Umweltbewußtseins als bürgerliche (Gegen-)Bewegung
- 5. Gesellschaftliche Bewegungen Anfang des 20. Jahrhunderts: Lebensreform und Wandervogel
- 5.1. Lebensreformbewegung
- 5.2. Jugendbewegung Wandervogel
- 6. Der Naturschutzverband Bund Heimatschutz
- 6.1. Gründer
- 6.2. Ziele
- 6.3. Kritik
- 7. Einflüsse auf das Umweltbewußtsein: Gesellschaft und Umweltpolitik in den 1970er Jahren
- 8. Naturschutzbewegung: BUND - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
- 8.1. Gründer
- 8.2. Ziele
- 8.3. Mitgliederzahlen
- 9. Resümee
- 9.1. Der Körper als Heimat
- 9.2. Umweltschutz in der Werbung und Wellnessbewegung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem komplexen Verhältnis zwischen Heimat und Umwelt, insbesondere mit dem Schutz der Umwelt als Lebensgrundlage. Die Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung des Umweltbewußtseins in Deutschland, ausgehend von der Jahrhundertwende bis in die 1970er Jahre. Dabei werden wichtige gesellschaftliche und politische Einflüsse auf die Umweltwahrnehmung und -schutzbewegung beleuchtet.
- Die Entwicklung des Begriffs „Heimat“ und dessen Bedeutung für die Umwelt
- Die Auswirkungen von Industrialisierung und Urbanisierung auf die Umwelt und den Umgang mit der Natur
- Die Entstehung des Umweltbewußtseins als bürgerliche Gegenbewegung
- Die Rolle von Naturschutzverbänden wie dem Bund Heimatschutz und dem BUND
- Die Bedeutung des Umweltbewußtseins für die Gesellschaft und die Umweltpolitik in den 1970er Jahren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Begriff „Heimat“ in den Mittelpunkt und untersucht dessen vielschichtige Bedeutung. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Facetten des Begriffs, sowohl in Bezug auf den lokalen Fokus als auch auf das Gefühl der Zugehörigkeit.
Kapitel 2 führt die zentralen Begriffe „Heimat“, „Natur“ und „Umwelt“ ein und beleuchtet deren historische Entwicklung und Bedeutung. Es wird darauf hingewiesen, dass der Begriff „Umwelt“ erst im frühen 20. Jahrhundert im biologischen Sinn verwendet wurde.
Kapitel 3 analysiert die Auswirkungen von Industrialisierung und Urbanisierung in Deutschland im 19. Jahrhundert auf die Umwelt und das Verhältnis des Menschen zur Natur. Die tiefgreifenden Veränderungen, die durch diese Prozesse ausgelöst wurden, führten zu einer veränderten Wahrnehmung der Umwelt und des Bedürfnisses nach Umweltschutz.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Heimat, Umwelt, Naturschutz, Lebensreform, Wandervogelbewegung, Industrialisierung, Urbanisierung, Umweltbewußtsein, Heimatschutz, BUND, Umweltpolitik, 19. und 20. Jahrhundert, Deutschland.
- Quote paper
- Eva Mallon (Author), 2005, Heimatschutz und Öko-Bewegung - Heimat als Umwelt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51409