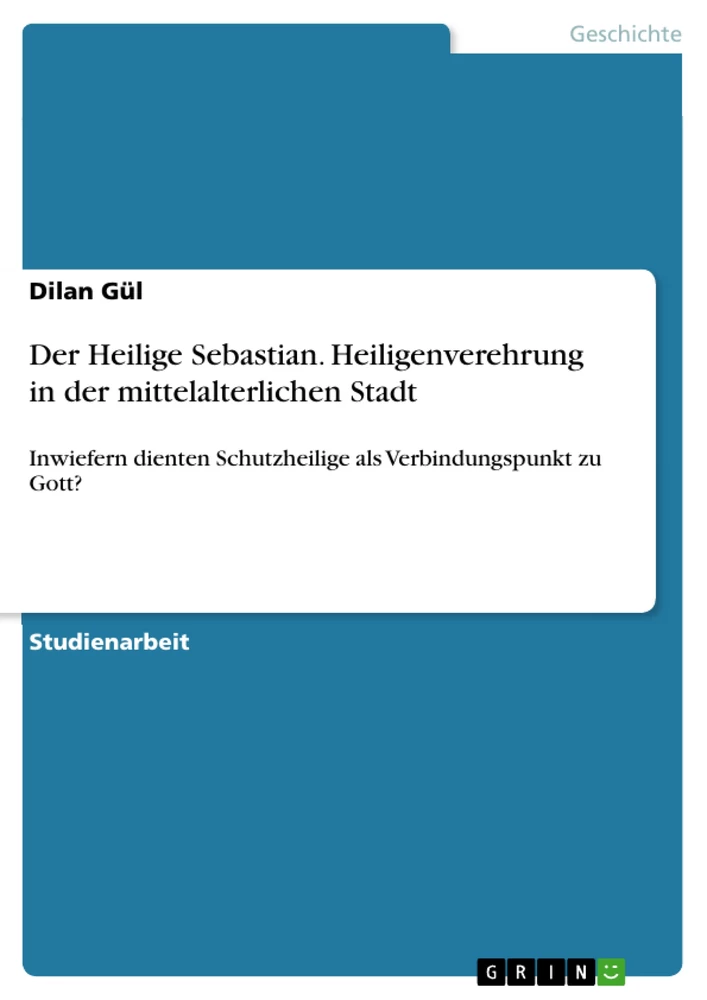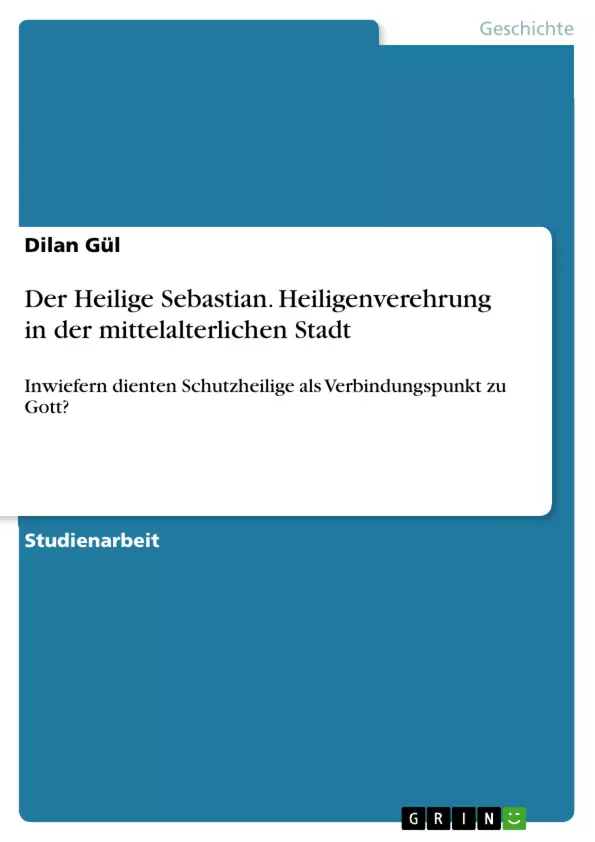Diese Arbeit thematisiert die Heiligenverehrung in der mittelalterlichen Stadt. Hierzu soll am Beispiel vom Heiligen Sebastian die Frage beantwortet werden, inwiefern Schutzheilige als Verbindungspunkt zu Gott dienten. Zur Beantwortung dieser Leitfrage wird zunächst auf die Heiligenverehrung im Mittelalter eingegangen, um anschließend den Heiligen Sebastian in seiner Person und Verehrung zu thematisieren. Dabei wird auf die gesundheitliche und religiöse Bedeutungszuschreibung Bezug genommen, um die Rolle im Leben der mittelalterlichen Bürger/innen herauszuarbeiten.
Wohl zu keiner anderen mittelalterlichen Thematik wie der Heiligenverehrung existieren so viele schriftliche, visuelle und materielle Zeugnisse. Heiligenviten, liturgische Quellen oder Sammlungen von Kandaren sind erhalten geblieben. Dies lag vermutlich an der enormen Bedeutungszuschreibung der Bevölkerung an die Heiligen. Ob die Geburt Christi oder die Mariä Himmelfahrt: In der mittelalterlichen Stadt war das Leben der Menschen durch die Festtage der verehrten Heilige gegliedert. Diese Tage gaben der Bevölkerung Tage der Freude und der Ruhe vor. Dabei handelte es sich bei den Festtagen um den Geburtstag der heiligen Person und damit dem Tag, an dem sie in den Himmel aufgenommen wurden.
Obwohl es sich bei Heiligkeiten um Totalphänomene der Vormoderne handelt, ist ein langsames Verblassen der Heiligenwelt festzustellen. Dabei ist der Kontakt zu Heiligen, ungeachtet der Epoche, in der Geschichte unumgehbar. Doch da es sich bei dem gewonnenen Wissen um kein erfahrungsgebundenes handelt, ging der Sinn für die Heiligen vermutlich innerhalb des Rationalismus verloren. Trotz dessen scheint das Interesse weiterhin zu bestehen, denn auch in der heutigen Zeit werden Wege zu Grabstätten gepilgert oder Gebetshäuser auf Gräbern errichtet. Laut einer Statistik des Pilgerbüros von Santiago de Compostela hat die Pilgerzahl in den letzten zehn Jahren um 250 % zugenommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Heiligenverehrung im Mittelalter
- Geschichte
- Schutzheilige
- Die heilige Stadt
- Der Heilige Sebastian
- Zur Person
- Verehrung
- Darstellung
- Gesundheitliche Bedeutungszuschreibung
- Religiöse Bedeutungszuschreibung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Heiligenverehrung im mittelalterlichen städtischen Kontext, insbesondere die Rolle von Schutzheiligen als Verbindungspunkt zu Gott. Am Beispiel des Heiligen Sebastian wird analysiert, wie seine Verehrung die Lebenswelt der mittelalterlichen Bevölkerung prägte und welche Bedeutung ihm in gesundheitlicher und religiöser Hinsicht zugeschrieben wurde.
- Heiligenverehrung im Mittelalter und ihre historische Entwicklung
- Die Funktion von Schutzheiligen als Vermittler zwischen Gott und Mensch
- Die Person und Verehrung des Heiligen Sebastian
- Gesundheitliche und religiöse Bedeutungszuschreibungen des Heiligen Sebastian
- Die Rolle des Heiligen Sebastian im städtischen Leben des Mittelalters
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die Heiligenverehrung im Mittelalter, speziell die Rolle von Schutzheiligen als Verbindung zu Gott, anhand des Heiligen Sebastian. Die Einleitung hebt die umfangreichen schriftlichen und materiellen Zeugnisse zur Heiligenverehrung hervor und verweist auf das nachlassende Interesse im Rationalismus, während dennoch heutige Pilgerfahrten die anhaltende Bedeutung dieses Phänomens belegen. Die Arbeit gliedert sich in die Untersuchung der mittelalterlichen Heiligenverehrung, die Analyse des Heiligen Sebastian und die Beantwortung der Leitfrage im Fazit.
Heiligenverehrung im Mittelalter: Dieses Kapitel erörtert die historische Entwicklung der Heiligenverehrung vom frühchristlichen Märtyrerkult bis ins Hochmittelalter. Es beschreibt die Veränderung des Heiligkeitsverständnisses von der anfänglichen Heiligkeit der gesamten Gemeinde hin zur Kanonisierung einzelner Personen. Der Abschnitt über Schutzheilige erklärt deren Funktion als Fürsprecher bei Gott und deren Bedeutung im religiösen Leben der Menschen. Schließlich wird der Einfluss der Heiligenverehrung auf die städtische Kultur im Mittelalter beleuchtet, insbesondere die Rolle von Stadtpatronen und die Entstehung heiliger Städte.
Der Heilige Sebastian: Dieser Kapitelteil konzentriert sich auf den Heiligen Sebastian. Es wird zunächst seine Lebensgeschichte, die aufgrund problematischer Quellenlage stark von Legenden geprägt ist, dargestellt. Seine Verehrung wird detailliert beschrieben, einschließlich seines Festtages, seiner Patronate und der Verehrung seiner Reliquien. Der Abschnitt über die Darstellung des Heiligen in der Kunst beleuchtet die verschiedenen künstlerischen Interpretationen seines Martyriums und seines Aussehens. Die gesundheitliche und religiöse Bedeutung, die ihm zugeschrieben wurde, wird ausführlich erklärt, wobei die Rolle in der Bekämpfung von Seuchen und als Vermittler des christlichen Glaubens hervorgehoben wird.
Schlüsselwörter
Heiligenverehrung, Mittelalter, Schutzheilige, Stadtpatron, Heiliger Sebastian, Märtyrerkult, Religiöse Bedeutungszuschreibung, Gesundheitliche Bedeutungszuschreibung, Reliquien, Volksheilkunde, Gott, Verbindungspunkt, Glaube, Christentum, Rom.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Heiligenverehrung am Beispiel des Heiligen Sebastian
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Heiligenverehrung im mittelalterlichen städtischen Kontext, insbesondere die Rolle von Schutzheiligen als Verbindungspunkt zu Gott. Am Beispiel des Heiligen Sebastian wird analysiert, wie seine Verehrung die Lebenswelt der mittelalterlichen Bevölkerung prägte und welche Bedeutung ihm in gesundheitlicher und religiöser Hinsicht zugeschrieben wurde.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der Heiligenverehrung im Mittelalter, die Funktion von Schutzheiligen, die Person und Verehrung des Heiligen Sebastian, die ihm zugeschriebenen gesundheitlichen und religiösen Bedeutungen sowie seine Rolle im städtischen Leben des Mittelalters. Es werden schriftliche und materielle Zeugnisse sowie die problematische Quellenlage zur Biografie des Heiligen Sebastian berücksichtigt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Heiligenverehrung im Mittelalter (inkl. Geschichte, Schutzheiligen und heiligen Städten), ein Kapitel zum Heiligen Sebastian (inkl. Lebensgeschichte, Verehrung, Darstellung und Bedeutungszuschreibungen) und ein Fazit.
Wie wird der Heilige Sebastian in der Arbeit behandelt?
Der Heilige Sebastian dient als Fallbeispiel. Die Arbeit analysiert seine Lebensgeschichte (unter Berücksichtigung der legendären Elemente), seine Verehrung (Festtage, Patronate, Reliquien), seine künstlerische Darstellung und die ihm zugeschriebene gesundheitliche und religiöse Bedeutung (z.B. in Bezug auf Seuchenbekämpfung und Glaubensvermittlung).
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit verweist auf die umfangreichen schriftlichen und materiellen Zeugnisse zur Heiligenverehrung im Mittelalter. Die problematische Quellenlage bei der Rekonstruktion der Lebensgeschichte des Heiligen Sebastian wird explizit angesprochen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit der Arbeit wird in der Zusammenfassung der Kapitel nicht explizit aufgeführt, liefert aber die Antwort auf die Leitfrage der Arbeit bezüglich der Bedeutung der Heiligenverehrung und des Heiligen Sebastian im Mittelalter.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Heiligenverehrung, Mittelalter, Schutzheilige, Stadtpatron, Heiliger Sebastian, Märtyrerkult, Religiöse Bedeutungszuschreibung, Gesundheitliche Bedeutungszuschreibung, Reliquien, Volksheilkunde, Gott, Verbindungspunkt, Glaube, Christentum, Rom.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Die Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt und dient der Analyse von Themen im Mittelalter. Die OCR-Daten sind ausschließlich für den akademischen Gebrauch vorgesehen.
- Quote paper
- Dilan Gül (Author), 2019, Der Heilige Sebastian. Heiligenverehrung in der mittelalterlichen Stadt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/514388