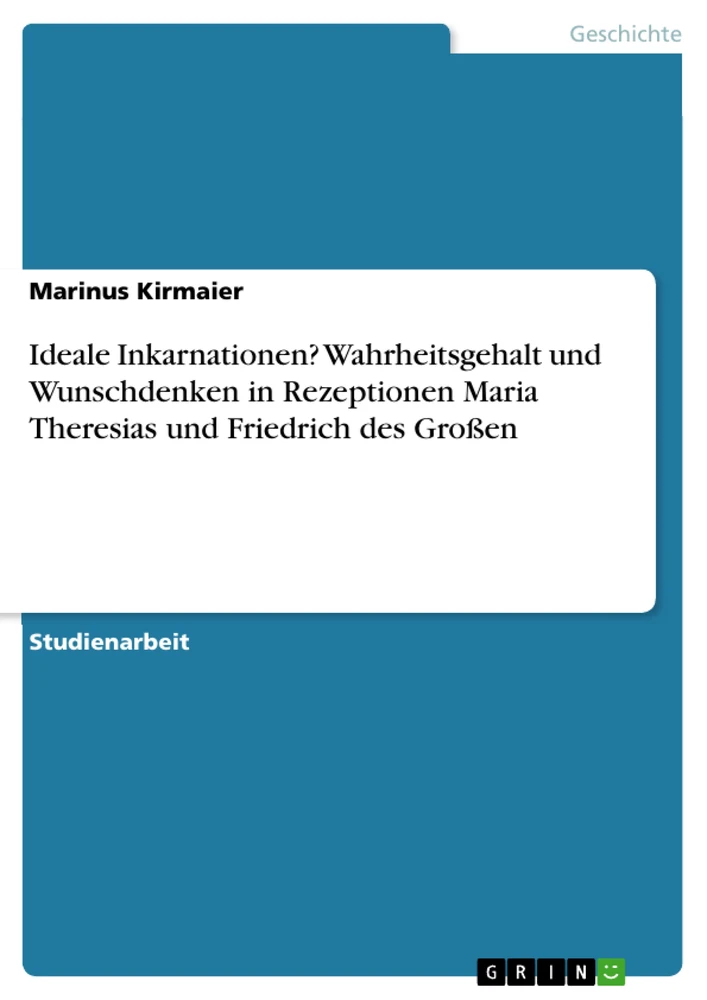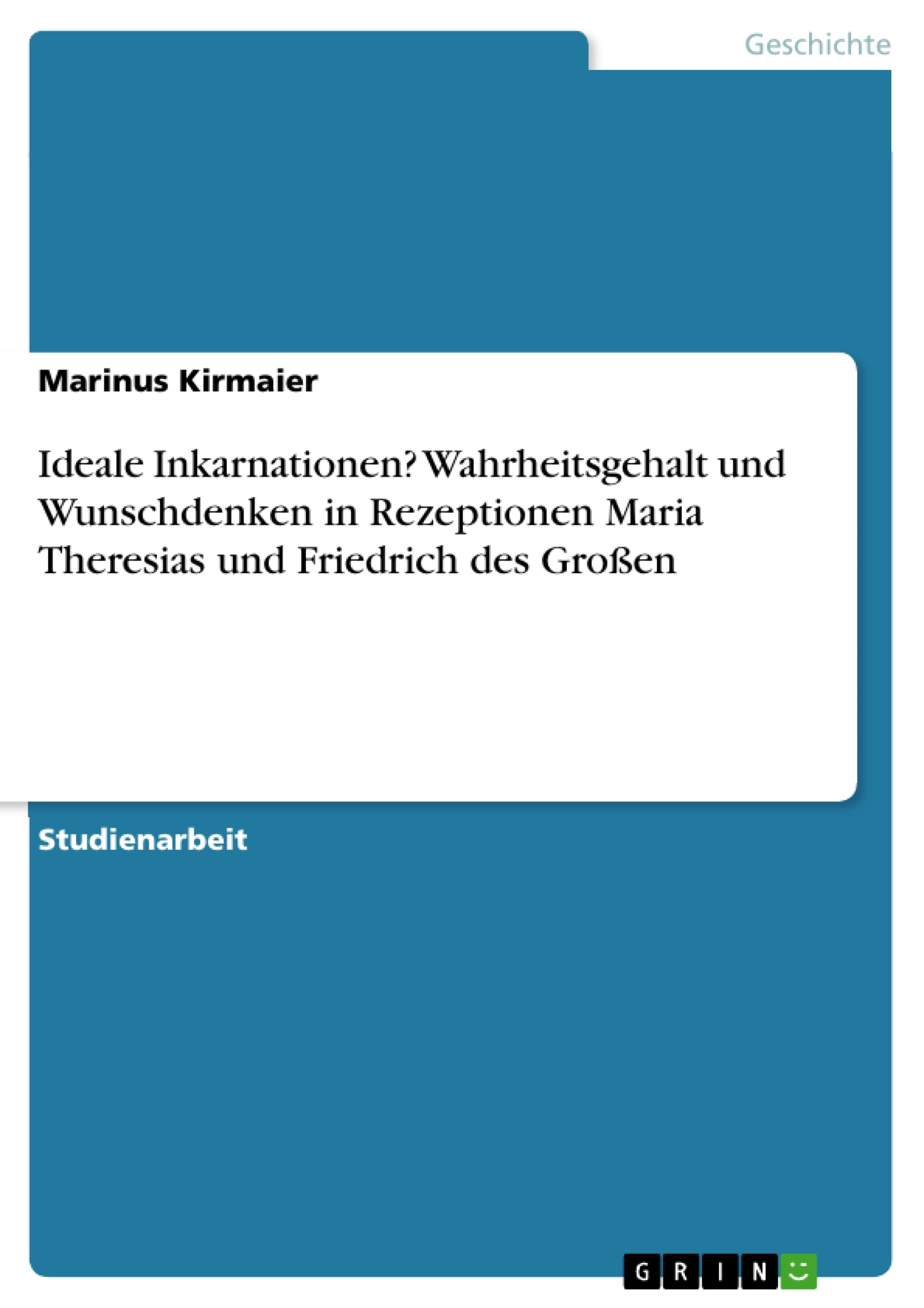In dieser Arbeit soll es darum gehen, die Biographien von Maria Theresia und Friedrich II. anhand von zeitgenössischen Rezeptionen zu charakterisieren, und darüber hinaus die Rezeptionen beider zu späteren Zeitpunkten gegenüberzustellen.
Diese Zeitpunkte stellen Hochphasen dar, in welchen die beiden besonders rezipiert wurden, das soll aber nicht heißen, dass man die Monarchen in der Geschichtsforschung ansonsten nicht betrachtet hätte, nur würde dies den Rahmen einer Hausarbeit sprengen, die Rezeptionen der beiden vom Zeitpunkt ihres Todes bis heute miteinander zu vergleichen. Daher sollen hier der Zeitraum um die Einigungskriege im späten 19. Jahrhundert in erster Linie und in zweiter die Zeit des Aufstiegs der Nationalsozialisten, also Ende der 1920er Jahre bis in den Zweiten Weltkrieg hinein, den Fokus dieser Arbeit bilden.
Zunäcsht erfolgt deshalb ein Überblick über Biographien und Rezeptionen der beiden Monarchen zu Lebzeiten, bevor ein vergleichender Vorgang für Rezeptionen und Biographien der beiden Herrrscher aus dem 19. - und 20. Jahrhundert erfolgt. Abschließend werden die gesammelten Ergebnisse nochmals zusammengefasst und ein abschließendes Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Das preußisch-österreichische Verhältnis im 18. Jahrhundert – ein Vorwort…
- Überblick über beide Biographien und ihre Rezeption zu Lebzeiten
- Friedrich II.: Im Feldlager daheim?
- Maria Theresia: Wiener Idylle?
- Überblick der Rezeptionen von beiden Monarchen im 19. und 20. Jahrhundert
- Der „Alte Fritz“ als Reichsgründer
- Maria Theresia als „Magna Mater Austriae“
- Fazit: Zwei Biographien zwischen Idealisierung und Stigmatisierung…
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Biographien von Maria Theresia und Friedrich II. und ihren Rezeptionen in verschiedenen historischen Zeitpunkten. Ziel ist es, die zeitgenössischen Rezeptionen beider Monarchen zu analysieren und sie mit späteren Rezeptionen, insbesondere im 19. Jahrhundert und in der Zeit des Nationalsozialismus, zu vergleichen. Die Arbeit soll aufzeigen, wie die beiden Monarchen im Laufe der Geschichte interpretiert und instrumentalisiert wurden, und wie ihre Biographien durch die jeweiligen historischen Kontexte geprägt wurden.
- Das preußisch-österreichische Verhältnis im 18. Jahrhundert
- Die Rezeption von Maria Theresia und Friedrich II. zu Lebzeiten
- Die Rezeption der beiden Monarchen im 19. Jahrhundert und in der Zeit des Nationalsozialismus
- Die Verwendung von historischen Figuren als politische Argumente
- Idealisierung und Stigmatisierung in der Geschichtsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Das preußisch-österreichische Verhältnis im 18. Jahrhundert – ein Vorwort
Dieses Kapitel beleuchtet den Konflikt zwischen Österreich und Preußen im 18. Jahrhundert, insbesondere im Kontext des Erbfolgekrieges um Schlesien. Die Rivalität der beiden Mächte wird dargestellt und die unterschiedlichen Ansprüche auf Schlesien erläutert. Der Fokus liegt auf der Rolle Maria Theresias und Friedrich II. im Konflikt und den Ursachen für ihre jeweilige Position.
Überblick über beide Biographien und ihre Rezeption zu Lebzeiten
Friedrich II.: Im Feldlager daheim?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Biografie Friedrichs II. im Kontext der frühen Rezeption. Die schwierige Beziehung zu seinem Vater, König Friedrich Wilhelm I., wird beleuchtet, sowie die Schwierigkeiten, die Friedrich mit der militaristischen Erziehung erfuhr. Die Fluchtpläne Friedrichs und seine Hinwendung zu Philosophie und Kunst im Kontrast zur militärischen Ausrichtung seines Vaters werden ausführlich dargestellt. Die Rezeption Friedrichs zu Lebzeiten wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, u.a. durch die Beschreibungen des französischen Diplomaten Lord Tyrconnel und durch die komplexe Beziehung zu Voltaire. Die Rezeption Friedrichs als „Philosophenkönig“ wird im Kontext des Schlossbaus von Sanssouci und der Freundschaft mit Voltaire beschrieben.
Maria Theresia: Wiener Idylle?
Dieses Kapitel soll die Biografie Maria Theresias und ihre Rezeption zu Lebzeiten beleuchten. Es wird auf die besondere Situation der Habsburger Monarchie eingegangen und die Bedeutung der Pragmatischen Sanktion im Kontext der Thronfolge erläutert. Der Fokus liegt auf der Rolle Maria Theresias im Kampf um die österreichischen Erblande und der Herausforderungen, die mit der Thronbesteigung einer Frau verbunden waren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der Rezeption von historischen Figuren, insbesondere Maria Theresia und Friedrich II., in verschiedenen historischen Kontexten. Wichtige Schlagwörter sind: Preußen, Österreich, Habsburger, Hohenzollern, Schlesien, Pragmatische Sanktion, Siebenjähriger Krieg, Rezeption, Historiographie, Idealisierung, Stigmatisierung, Geschichte als politisches Argument, Friedrich der Große, „Alte Fritz“, Maria Theresia, „Magna Mater Austriae“, Voltaire, Lord Tyrconnel.
Häufig gestellte Fragen
Welche historischen Persönlichkeiten werden in dieser Arbeit verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Biographien und Rezeptionen von Maria Theresia von Österreich und Friedrich II. von Preußen (Friedrich der Große).
Welche Zeiträume der Rezeption stehen im Fokus?
Der Fokus liegt auf der Zeit der Einigungskriege im späten 19. Jahrhundert sowie auf der Zeit des Nationalsozialismus (Ende der 1920er Jahre bis zum Zweiten Weltkrieg).
Wie wurde Friedrich II. zu Lebzeiten wahrgenommen?
Friedrich II. wurde oft als „Philosophenkönig“ rezipiert, was im Kontrast zu seiner militärischen Erziehung und der schwierigen Beziehung zu seinem Vater stand.
Was bedeutet die Bezeichnung „Magna Mater Austriae“ für Maria Theresia?
Dieser Begriff beschreibt die spätere Idealisierung Maria Theresias als Landesmutter Österreichs, insbesondere in der Rezeption des 19. und 20. Jahrhunderts.
Welche Rolle spielt der Konflikt um Schlesien in der Arbeit?
Der Konflikt um Schlesien und der Österreichische Erbfolgekrieg werden als zentraler Hintergrund für das preußisch-österreichische Verhältnis im 18. Jahrhundert beleuchtet.
Was ist das Ziel der Untersuchung der Rezeptionen?
Ziel ist es aufzuzeigen, wie historische Figuren als politische Argumente instrumentalisiert wurden und wie sich die Wahrnehmung zwischen Idealisierung und Stigmatisierung bewegt.
- Arbeit zitieren
- Marinus Kirmaier (Autor:in), 2019, Ideale Inkarnationen? Wahrheitsgehalt und Wunschdenken in Rezeptionen Maria Theresias und Friedrich des Großen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/514397