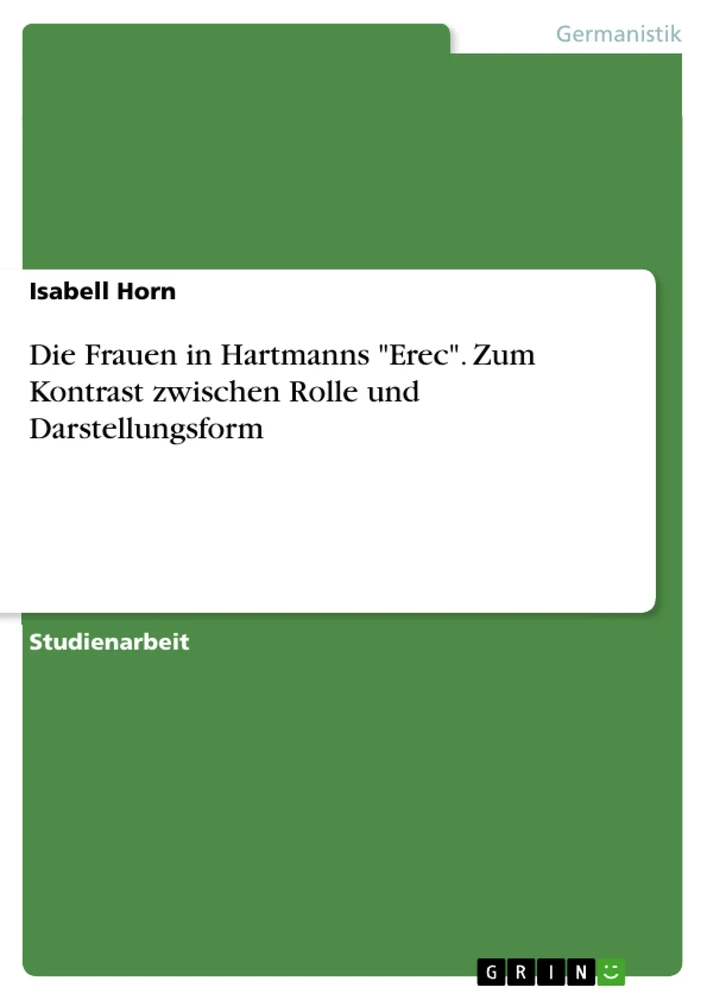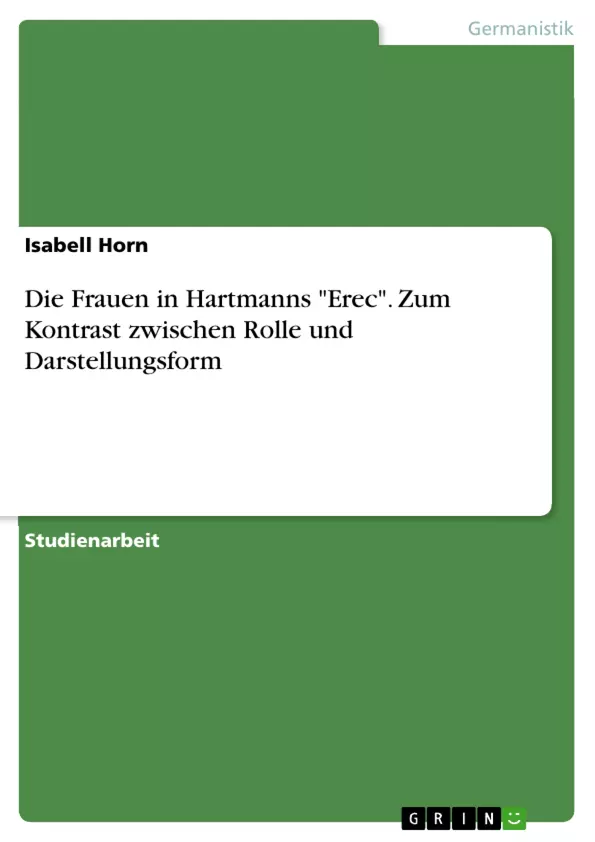In dieser Arbeit werden die Darstellung der wenigen Frauen in Hartmanns-"Erec" analysiert. Zum einen wird die optische Erscheinung der Frauen und damit einhergehend auch die Kleidung sowie deren Farben und Materialien herausgearbeitet. Zugleich werden Charakterzüge der Frauen anhand passender Textstellen aufgezeigt und mögliche Wertungen durch den Erzähler oder durch andere Figuren herangezogen.
Als Erec und Enite zum ersten Mal gemeinsam an den Artushof kommen, werden sie feierlich empfangen. Obwohl viele der Ritter der Tafelrunde keinen Einfluss auf die Handlung ausüben, werden ihre Namen und ihre Herkunftsorte über mehrere Seiten aufgelistet. Demgegenüber stehen weibliche Figuren, deren Auftritte relevant für den Verlauf der Handlung sind, sie aber dennoch namenlos bleiben, wie zum Beispiel die Jungfrau aus dem Wald oder die 80 Witwen. Auch im Vergleich zum Originaltitel Erec et Enide von Chrétien de Troyes, rückt Hartmann einzig und allein Erec in den Mittelpunkt, da er Enite im Titel nicht nennt. Daraus könnte eine ungleiche Wertung von Mann und Frau geschlossen werden. Ist es nicht Enite, die Erec mehrmals vor dem Tod bewahrt? Heilt ihn nicht Fâmurgâns Pflaster, das im Besitz von Königin Ginower und Guivreiz‘ Schwestern ist? Welche Wirkung haben diese Frauen und welche Rolle spielen sie in der Geschichte? Der Umfang dieser Arbeit lässt eine Beschreibung jeder weiblichen Figur nicht zu. Als Beispiel wird Enite deutlicher im Fokus stehen.
Insbesondere die Szene, in der Erecs erste Begegnung mit Enite und ihrer Familie beschrieben wird, dient hierbei als Grundlage. Weitere Frauen, die näher betrachtet werden sollen, sind die Schwestern von Guivreiz, die Zauberin Fâmurgân, die Frau im Wald und die 80 Witwen. Zuletzt folgen Erläuterungen zu allgemeinen Aussagen über die Frauen im Erec.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Darstellung der Frauen in Hartmanns Erec
- Enite als weibliche Unterstützung für den Helden Erec
- Enites Schönheit und ihre Kleidung
- Enites Charakterzüge und ihre Entwicklung
- Guivreiz Schwestern und die Zauberin Fâmurgân
- Die Frau im Wald und die 80 Witwen aus der „Joie de la curt“-Episode
- Allgemeine Aussagen über die Frauen in Hartmanns Erec
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Darstellung der Frauen in Hartmanns Erec und untersucht, wie sie in der Handlung und durch den Erzähler charakterisiert werden. Ziel ist es, die Rolle und Bedeutung der weiblichen Figuren im Kontext der höfischen Gesellschaft des Mittelalters zu beleuchten.
- Die optische Darstellung der Frauen, insbesondere die Kleidung und die Farbgebung
- Die Charakterzüge der Frauen und ihre Entwicklung im Laufe der Geschichte
- Die Wertung der Frauen durch den Erzähler und andere Figuren
- Die Beziehung zwischen Schönheit, Reichtum und gesellschaftlicher Stellung
- Die Rolle der Frauen als Unterstützung und Hilfe für den Helden Erec
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und hebt die Besonderheiten der Darstellung von Frauen in Hartmanns Erec im Vergleich zu anderen höfischen Romanen hervor.
- Die Darstellung der Frauen in Hartmanns Erec: Dieses Kapitel behandelt die Darstellung von Frauen im Erec im Allgemeinen und fokussiert dabei auf Enite als weibliche Unterstützung für den Helden Erec.
- Enite als weibliche Unterstützung für den Helden Erec: Dieser Unterabschnitt untersucht Enites Schönheit und Kleidung, die von Hartmann sehr detailliert beschrieben wird. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Symbolik der Farben gelegt. Darüber hinaus werden Enites Charakterzüge und ihre Entwicklung im Laufe der Geschichte beleuchtet.
- Guivreiz Schwestern und die Zauberin Fâmurgân: Dieser Unterabschnitt befasst sich mit den Schwestern von Guivreiz und der Zauberin Fâmurgân, die wichtige Rollen in der Handlung spielen.
- Die Frau im Wald und die 80 Witwen aus der „Joie de la curt“-Episode: Dieser Unterabschnitt beleuchtet die Figuren der Frau im Wald und der 80 Witwen aus der „Joie de la curt“-Episode.
- Allgemeine Aussagen über die Frauen in Hartmanns Erec: Dieser Unterabschnitt fasst die allgemeinen Aussagen über die Frauen in Hartmanns Erec zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der Darstellung von Frauen in der höfischen Literatur, insbesondere in Hartmanns Erec. Schlüsselbegriffe sind: höfische Gesellschaft, Frauenbild, Schönheit, Kleidung, Charakter, Enite, Fâmurgân, Guivreiz, die Frau im Wald, die 80 Witwen, soziale Stellung, Reichtum, Symbolik, mittelalterliche Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Wie werden Frauen in Hartmanns „Erec“ dargestellt?
Die Darstellung erfolgt oft über die optische Erscheinung, Kleidung und Symbolik, wobei Frauen meist eine unterstützende Rolle für den männlichen Helden einnehmen.
Welche Rolle spielt Enite in der Geschichte?
Enite ist die zentrale weibliche Figur; sie bewahrt Erec mehrmals vor dem Tod, wird jedoch im Titel des Werks (im Gegensatz zum französischen Original) nicht genannt.
Was symbolisiert die Kleidung der Frauen im Erec?
Farben und Materialien der Kleidung dienen als Indikatoren für Schönheit, Reichtum und die soziale Stellung der Figuren innerhalb der höfischen Gesellschaft.
Wer sind die „80 Witwen“ in der Erzählung?
Sie erscheinen in der „Joie de la curt“-Episode und stehen exemplarisch für namenlose weibliche Figuren, deren Schicksal dennoch relevant für den Handlungsverlauf ist.
Welche übernatürlichen Frauenfiguren kommen vor?
Die Arbeit erwähnt die Zauberin Fâmurgân, deren heilendes Pflaster eine entscheidende Rolle für Erecs Genesung spielt.
- Quote paper
- Isabell Horn (Author), 2019, Die Frauen in Hartmanns "Erec". Zum Kontrast zwischen Rolle und Darstellungsform, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/514757