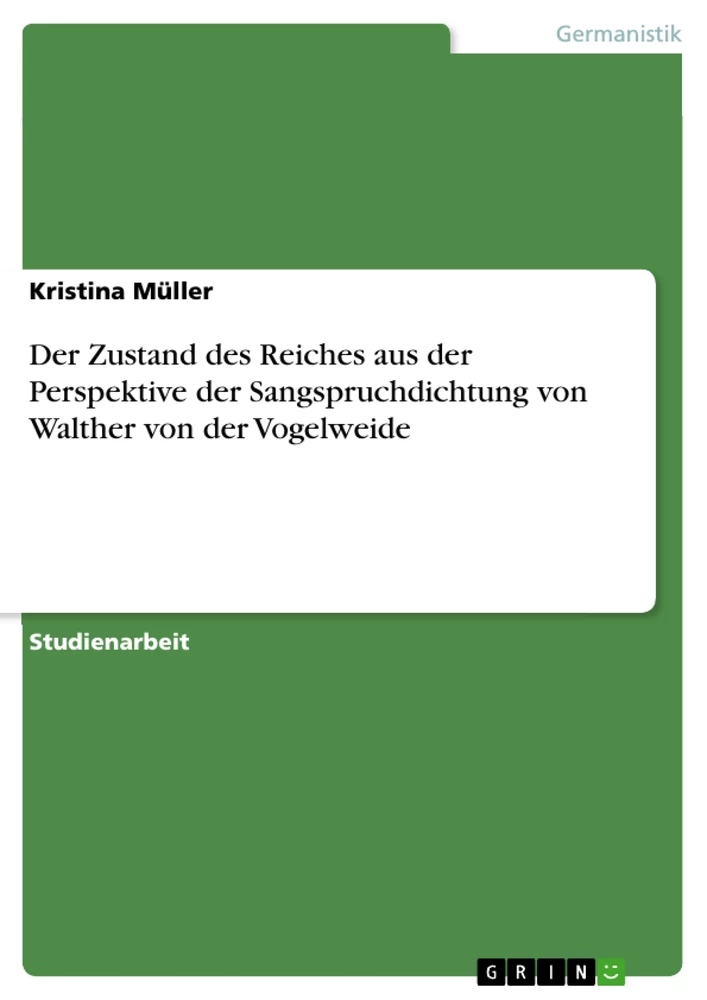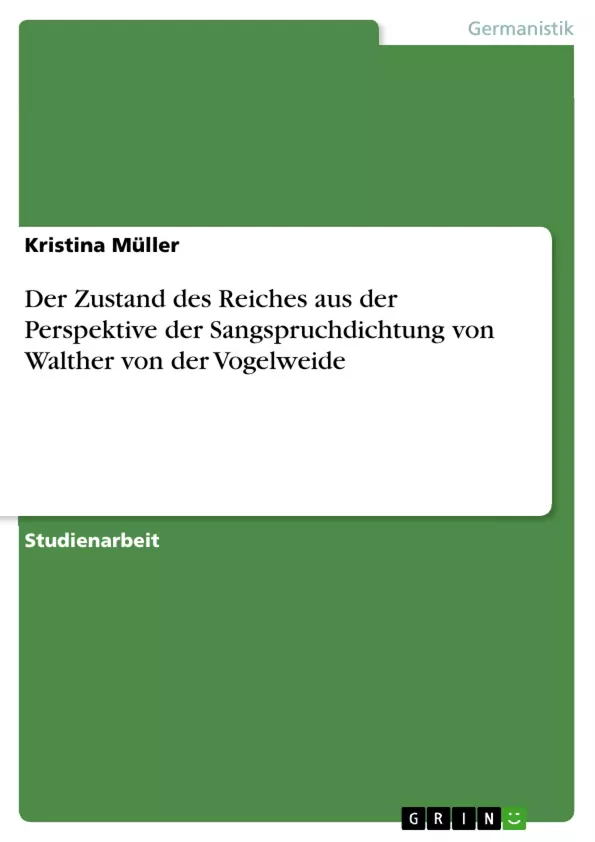Walther von der Vogelweide gilt als der erste mittelalterliche Dichter, der sowohl Minnelyrik als auch politische Sangspruchdichtung verfasst. In seinen Tönen spielt er oftmals auf die politische Situation im Reich an. Er übt Kritik an dem jeweiligen Herrscher oder lobt diesen und bittet um finanzielle Unterstützung. Zu Walthers Lebzeiten gibt es genügend wichtige politische Ereignisse, die es wert sind, besungen zu werden. Drei große Ereignisse, die Walther ausführlich kommentiert, sind die Doppelwahl von 1198, die Krönung Ottos IV. nach der Ermordung des Staufers Philipp von Schwaben und das Doppelkönigtum von Otto IV. und Friedrich II., das zur Abdankung Ottos und der Krönung des Kindkönigs Heinrich VII. führte.
Man nimmt an, dass Walther dem niederen Adel entstammt und somit die Möglichkeit hatte, eine Schule zu besuchen. Die Dichtkunst erlernt er eventuell am Wiener Hof. Er ist nicht belehnt, hat also keinen festen Wohnsitz. Dies zwingt ihn dazu, im Reich herumzureisen um an verschiedenen Höfen Station zu machen, um sich den Lebensunterhalt zu „ersingen“. Als fahrender Sänger ist er darauf angewiesen, potente Mäzene zu haben, die ihn unterstützen. Er bezieht in seinem Leben politische Stellung zu verschiedenen Herrschern als Kritiker und wechselt dabei häufig seinen Standpunkt.
Die vorliegende Hausarbeit zum Thema „Der Zustand des Reiches aus der Perspektive der Sangspruchdichtung Walthers von der Vogelweide“ soll einen Überblick über die politische Sangspruchdichtung geben. Die Analyse ist in vier Aspekte untergliedert, weil es hauptsächlich die vier Könige und Kaiser dieser Zeit sind, die Walther in seinen Texten erwähnt und die reichspolitisch relevant waren. Kleinere Fürsten und der Papst werden nicht behandelt. In der Hausarbeit werden Strophen bearbeitet, in denen die Reichsherrscher direkt angesprochen werden oder indirekt erwähnt werden. Außerdem sind sowohl positive als auch negative Strophen dargestellt, um zu zeigen, wie weitgefächert das Spektrum von Walthers Dichtkunst war. Es werden Strophen zu Philipp von Schwaben, Otto IV., Friedrich II. und Heinrich VII. aus Walthers Sangsprüchen vorgestellt, kommentiert und analysiert, so dass Walthers politische Einstellungen und der geschichtliche Hintergrund deutlich werden. Hierzu wird Fachliteratur zu Rate gezogen und zu jeder Strophe zusammenfassend dargestellt...
Inhaltsverzeichnis
- Vorinformation
- Sprachliche und inhaltliche Analyse von Walthers Spruchdichtung
- Philipp von Schwaben
- Die Reichsklage L 8,4
- Die Weltklage L 8,28
- Kronenspruch L 18,29
- Magdeburger Weihnacht L 19,5
- Otto IV
- Kreuzzugsermahnung L 12,18
- Otto-Friedrich-Vergleich L 26,33
- Friedrich II
- Gut und Ehre L 31,13
- Feinde des Heiligen Landes L 10,9
- Heinrich VII
- Erziehungsschwierigkeiten L 101,23
- Werteverlust L 102, 15
- Philipp von Schwaben
- Auswertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die politische Sangspruchdichtung Walthers von der Vogelweide, indem sie einen Überblick über seine politischen Äußerungen in Bezug auf die vier wichtigsten Herrscher seiner Zeit (Philipp von Schwaben, Otto IV., Friedrich II. und Heinrich VII.) gibt. Die Analyse konzentriert sich auf ausgewählte Strophen, die sowohl positive als auch negative Bewertungen der jeweiligen Herrscher enthalten.
- Analyse der politischen Sangspruchdichtung Walthers von der Vogelweide
- Bewertung der Herrschaft der Kaiser und Könige Philipp von Schwaben, Otto IV., Friedrich II. und Heinrich VII. durch Walther
- Zusammenhang zwischen Walthers politischen Standpunkten und den historischen Ereignissen seiner Zeit
- Die Rolle von Sangsprüchen als Mittel politischer Kommentierung im Mittelalter
- Sprachliche und stilistische Analyse ausgewählter Strophen
Zusammenfassung der Kapitel
Vorinformation: Diese Einleitung stellt Walther von der Vogelweide als bedeutenden mittelalterlichen Dichter vor, der sowohl Minnelyrik als auch politische Sangspruchdichtung verfasste. Sie beschreibt seinen sozialen Hintergrund, seine Lebensweise als fahrender Sänger und seine wechselnden politischen Positionen gegenüber verschiedenen Herrschern. Die Arbeit selbst wird als Überblick über seine politische Sangspruchdichtung vorgestellt, fokussiert auf die vier Kaiser und Könige, die Walther in seinen Texten erwähnt.
Sprachliche und inhaltliche Analyse von Walthers Spruchdichtung: Dieses Kapitel beginnt mit einer Einführung in die historische Situation, die den Kontext für Walthers politische Dichtungen bildet. Es beleuchtet die Machtkämpfe zwischen den Staufern und den Welfen, insbesondere den Erbstreit nach dem Tod Heinrichs VI. Die darauffolgenden Unterkapitel analysieren Walthers Strophen zu Philipp von Schwaben, Otto IV., Friedrich II., und Heinrich VII., jeweils in Bezug auf den historischen Kontext und die politischen Botschaften der Gedichte.
2.1. Philipp von Schwaben: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Strophen, die sich mit Philipp von Schwaben auseinandersetzen. Es wird u.a. die „Reichsklage“ (L 8,4) untersucht, welche die damalige Zeit als von Unruhe und Bürgerkrieg geprägt darstellt, sowie die „Weltklage“ (L 8,28), die die politische Lage kritisiert und Philipp von Schwaben direkt anspricht. Der „Kronenspruch“ (L 18,29) wird als Ausdruck der Unterstützung für Philipps Herrschaft interpretiert. Die Analyse beleuchtet die sprachlichen Mittel, die Walther einsetzt, um seine Kritik oder Unterstützung auszudrücken, sowie die Symbolik seiner Poesie im Kontext der politischen Ereignisse.
Schlüsselwörter
Walther von der Vogelweide, Sangspruchdichtung, politische Lyrik, Mittelalter, Staufer, Welfen, Philipp von Schwaben, Otto IV., Friedrich II., Heinrich VII., Reichsklage, Weltklage, Machtpolitik, Herrscherkritik, mittelhochdeutsche Literatur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur sprachlichen und inhaltlichen Analyse von Walthers Spruchdichtung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die politische Sangspruchdichtung Walthers von der Vogelweide, insbesondere seine Äußerungen zu den Herrschern Philipp von Schwaben, Otto IV., Friedrich II. und Heinrich VII. Sie untersucht ausgewählte Strophen, um sowohl positive als auch negative Bewertungen der jeweiligen Herrscher zu identifizieren und zu interpretieren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Analyse der politischen Sangspruchdichtung Walthers, der Bewertung der Herrschaft der genannten Kaiser und Könige durch Walther, dem Zusammenhang zwischen Walthers politischen Standpunkten und den historischen Ereignissen seiner Zeit, der Rolle von Sangsprüchen als Mittel politischer Kommentierung im Mittelalter und der sprachlichen und stilistischen Analyse ausgewählter Strophen.
Welche Strophen von Walther werden im Einzelnen untersucht?
Die Analyse umfasst folgende Strophen: Die Reichsklage (L 8,4), die Weltklage (L 8,28), den Kronenspruch (L 18,29), die Magdeburger Weihnacht (L 19,5), die Kreuzzugsermahnung (L 12,18), den Otto-Friedrich-Vergleich (L 26,33), Gut und Ehre (L 31,13), Feinde des Heiligen Landes (L 10,9), Erziehungsschwierigkeiten (L 101,23) und Werteverlust (L 102, 15).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Vorinformation, die Walther von der Vogelweide und den Kontext seiner politischen Lyrik einführt, eine sprachliche und inhaltliche Analyse der Spruchdichtung, die jeweils die Strophen zu Philipp von Schwaben, Otto IV., Friedrich II. und Heinrich VII. im Detail untersucht und eine abschließende Auswertung.
Welchen historischen Kontext beleuchtet die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext der Machtkämpfe zwischen den Staufern und den Welfen, insbesondere den Erbstreit nach dem Tod Heinrichs VI., um die politischen Äußerungen Walthers besser zu verstehen.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen: Walther von der Vogelweide, Sangspruchdichtung, politische Lyrik, Mittelalter, Staufer, Welfen, Philipp von Schwaben, Otto IV., Friedrich II., Heinrich VII., Reichsklage, Weltklage, Machtpolitik, Herrscherkritik, mittelhochdeutsche Literatur.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Personen gedacht, die sich für mittelhochdeutsche Literatur, politische Lyrik des Mittelalters, Walther von der Vogelweide und die Geschichte des Heiligen Römischen Reiches interessieren. Sie eignet sich besonders für akademische Zwecke und die Analyse literarischer und historischer Themen.
- Quote paper
- Kristina Müller (Author), 2003, Der Zustand des Reiches aus der Perspektive der Sangspruchdichtung von Walther von der Vogelweide, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51483