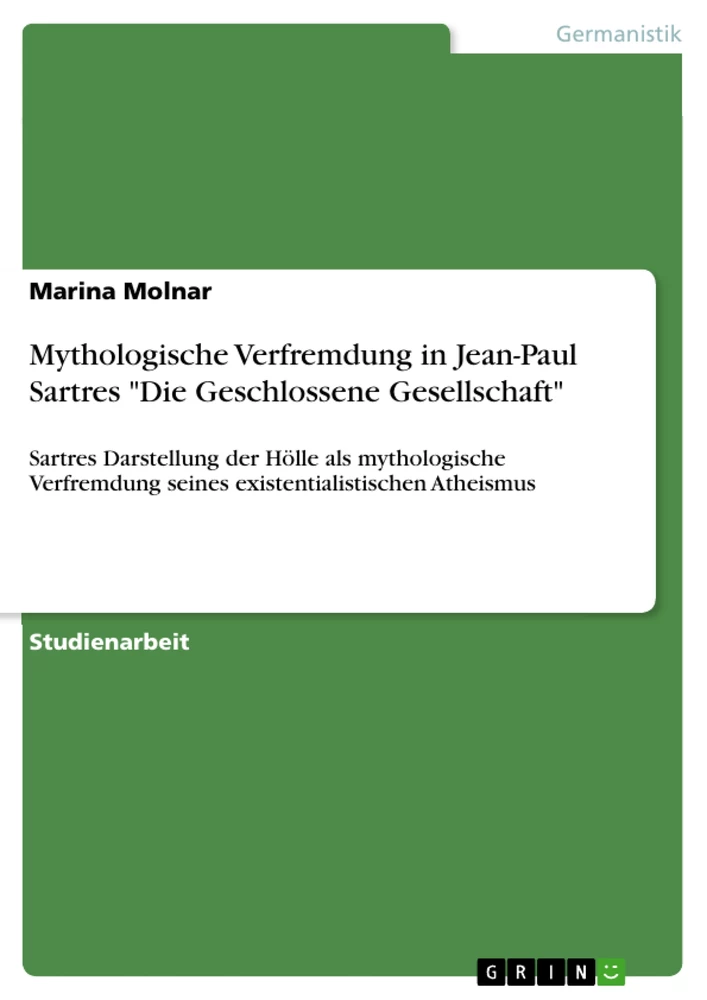Die Arbeit beschäftigt sich damit, wie Sartre seine philosophischen Theorien ausgehend von seinem Atheismus in einem seiner bedeutendsten und gelungensten Werke "Geschlossene Gesellschaft" verarbeitet, indem er die Methode der mythologischen Verfremdung anwendet. Zu diesem Zweck wird zunächst Sartres atheistischer Existentialismus in seinen Grundzügen erläutert. Anschließend wird erörtert, wie das Mittel der mythologischen Verfremdung in der modernen Literatur eingesetzt wird, um ein atheistisches Konzept, wie Sartres zu transportieren. Schließlich wird These für These gezeigt, wie Sartre anhand der mythologischen Verfremdung strukturell und inhaltlich seine Philosophie in Literatur verpackt.
Als einer der radikalsten und einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts fasziniert das Phänomen Jean-Paul Sartre bis heute. Der Einfluss seiner Philosophie, einer atheistisch angelegten Form des Existentialismus, prägt die Nachkriegszeit, während er durch seinen Lebenswandel, seine persönliche Präsenz und seine literarischen Erfolge als Inbegriff des französischen Intellektuellen gilt. Sartre ist sowohl als Literat als auch als Philosoph in Erinnerung geblieben.
Als Philosoph steht Sartre in der Tradition von Kirkegaard, Husserl und besonders Heidegger. Als Existentialist greift seine Philosophie die Fragen nach dem guten Leben auf, die seit der griechischen Philosophie Grundlage der praktischen Philosophie ist, und lässt sich damit nicht mit den gleichen Maßstäben messen, die man auf die wissenschaftliche Philosophie anwendet. Sartres Philosophie baut zudem auf einem positiven Atheismus-Begriff auf, der die Existenz Gottes nicht nur verneint, sondern sich aktiv gegen die Religion und ihre Strukturen wendet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sartres Konzept eines atheistischen Existentialismus
- Sartres Atheismus-Begriff
- Sartres philosophische Hauptthesen
- Die mythologische Verfremdung als Mittel moderner Literatur
- Der Mythos in der modernen Literatur
- Der Mythos bei Sartre als Verfremdung
- Die literarische Verarbeitung der philosophischen Theorie anhand der mythologischen Verfremdung in „huis clos“
- Objektwelt/Subjektwelt
- Der Raum
- Der Tod
- Der Mensch ist nichts, als die Summe seiner Handlungen.
- Der Mensch ist verantwortlich und verlassen.
- Der Existentialismus ist ein Sozialismus.
- Es gibt keine festgeschriebene Moral.
- Der Existentialismus ist ein Optimismus und die Rolle der Freiheit.
- Die Existenz geht der Essenz voraus. Sartres Hölle als mythologische Verfremdung
- Objektwelt/Subjektwelt
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit der Interpretation von Jean-Paul Sartres philosophischen Thesen im Kontext seines Theaterstücks „huis clos“. Ziel ist es, die methodische Verwendung der mythologischen Verfremdung als Mittel der literarischen Darstellung des atheistischen Existentialismus zu analysieren. Dabei werden die zentralen Argumente und Themen des Existentialismus Sartres im Hinblick auf die Gestaltung des Dramas untersucht.
- Die Konzeption des atheistischen Existentialismus bei Sartre
- Die Rolle der mythologischen Verfremdung in der modernen Literatur
- Die Umsetzung von Sartres Thesen in „huis clos“
- Die Darstellung der Hölle als Metapher für die menschliche Existenz
- Die Bedeutung der Freiheit und Verantwortung im existenzialistischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den thematischen Rahmen der Arbeit vor, indem sie einen Überblick über Sartres Leben und Werk gibt. Sie fokussiert auf seine philosophischen Einflüsse und die Bedeutung seiner atheistischen Form des Existentialismus. Die folgenden Kapitel analysieren den atheistischen Existentialismus bei Sartre und die Methode der mythologischen Verfremdung in der modernen Literatur.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen und Konzepten des atheistischen Existentialismus von Jean-Paul Sartre, insbesondere mit der Rolle der mythologischen Verfremdung in seiner Dramaturgie. Die Schlüsselbegriffe umfassen Themen wie Freiheit, Verantwortung, Existenz, Essenz, Hölle, "Die Hölle, das sind die anderen", und die Rolle der Literatur als Medium der Philosophie. Die Arbeit betrachtet „huis clos“ als Beispiel für Sartres Verwendung der mythologischen Verfremdung als Mittel zur Darstellung seiner philosophischen Thesen.
- Quote paper
- Marina Molnar (Author), 2016, Mythologische Verfremdung in Jean-Paul Sartres "Die Geschlossene Gesellschaft", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/514896