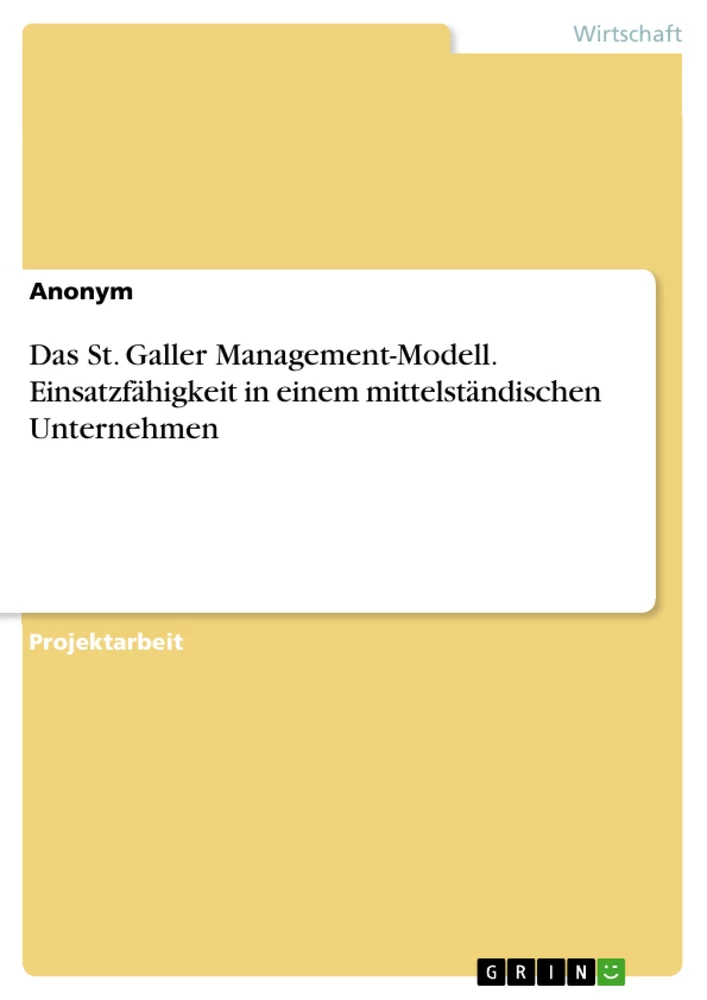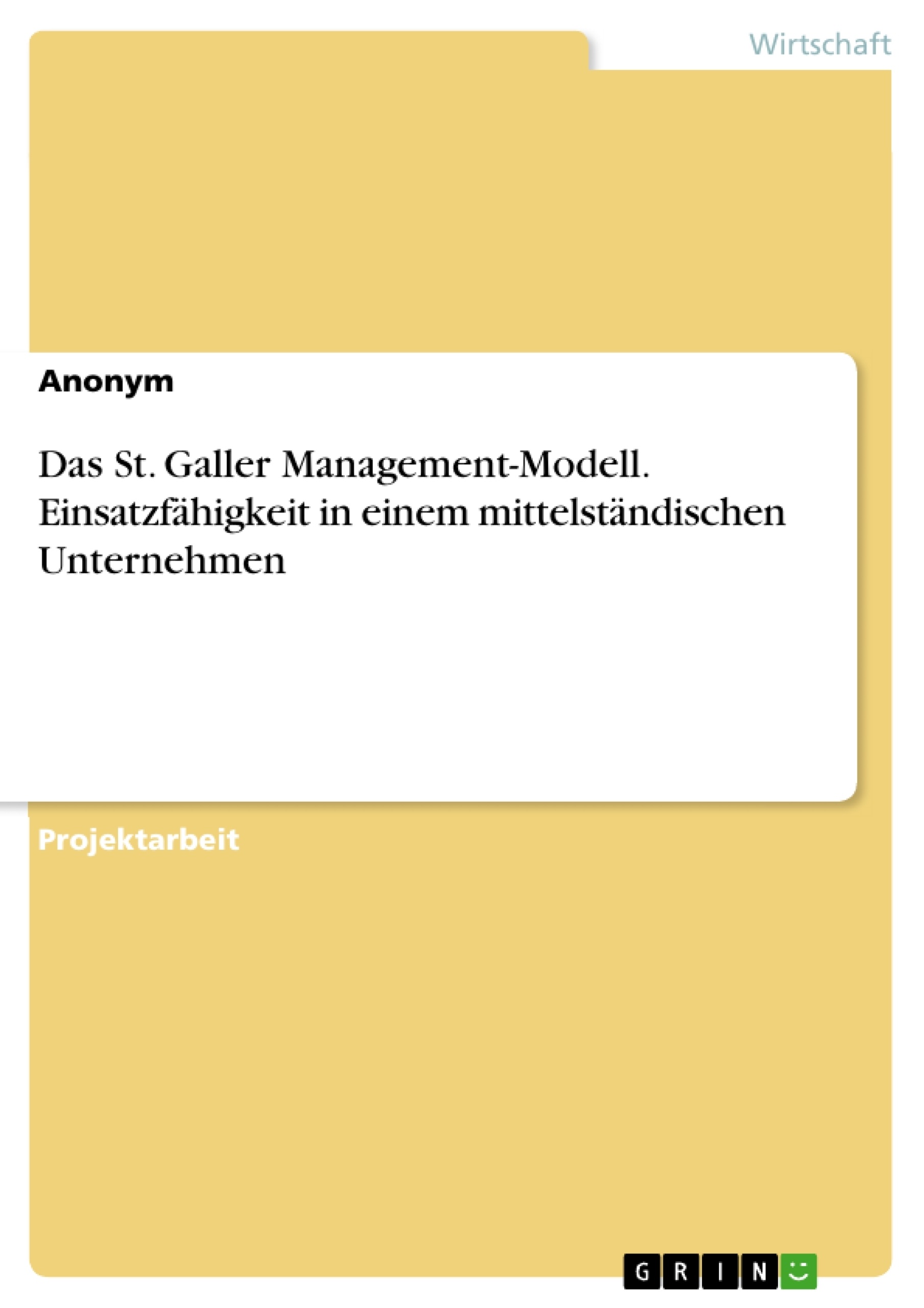Das Ziel der Arbeit ist die Erörterung der Einsatzfähigkeit des St. Galler Management-Modells am Beispiel eines deutschen mittelständischen Unternehmens. Elementarziele sind die Vorstellung der Kernaspekte und der wesentlichen Entwicklungsstufen des St. Galler Management-Modells, um eine Grundlage für das weitere Verständnis des Themas zu schaffen. Zudem erfolgt eine kurze Definition über mittelständische Unternehmen sowie die Vorstellung eines ausgewählten Unternehmens.
Zunächst folgt die Darstellung der Grundlagen, der Historie und der Entstehung des St. Galler Management-Modell. Die vier Generationen des Modells werden kurz erläutert, wobei speziell auf das dritte St. Galler Management-Modell eingegangen wird. Anschließend erfolgt eine kurze Definition mittelständischer Unternehmen. Zudem wird das ausgewählte Unternehmen vorgestellt. Danach wird das dritte St. Galler Managementmodell an dem ausgewählten Unternehmen angewandt und die sechs Schlüsselkategorien des Modells aufgegriffen und mit praxisrelevanten Beispielen sowie Handlungsmöglichkeiten unterlegt.
Treiber für die rasanten Änderungen im Wirtschaftsleben und die sukzessiv wachsenden Anforderungen an das Management von Unternehmen sind der technische Fortschritt, die Globalisierung und die Digitalisierung mit der zunehmenden Vernetzung ganzer Wirtschaftszweige. Durch die steigenden Anforderungen und wachsende Konkurrenz sind kleine und mittelständische Unternehmen zu einer Anpassung gezwungen, um nicht vom Markt zu verschwinden. Zur Unterstützung des Umgangs mit diesen Herausforderungen und dem Treffen korrekter Entscheidungen gibt es Modelle, wie das St. Galler Management-Modell. Dieses Modell ist eine Hilfestellung für Führungskräfte zur nachhaltigen Sicherung des Erfolges der Unternehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Einleitung
- Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Das St. Galler Management-Modell
- Grundlagen des St. Galler Management-Modells
- Entwicklungsstufen des St. Galler Management-Modells
- Neues (drittes) St. Galler Management-Modell
- Charakterisierung mittelständischer Unternehmen in Deutschland
- Definition mittelständische Unternehmen
- Vorstellung des ausgewählten Unternehmens: Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten Stuttgart
- Einsatz des St. Galler Managementmodells am ausgewählten Unternehmen
- Umweltsphären
- Anspruchsgruppen
- Interaktionsthemen
- Prozesse
- Ordnungsmomente
- Entwicklungsmodi
- Zusammenfassung und kritische Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Anwendbarkeit des St. Galler Management-Modells auf ein deutsches mittelständisches Unternehmen. Es werden die Kernaspekte und Entwicklungsstufen des Modells vorgestellt, um dessen Verständnis zu fördern. Zusätzlich wird eine Definition mittelständischer Unternehmen gegeben und die Wilhelma als Fallbeispiel präsentiert.
- Anwendbarkeit des St. Galler Management-Modells in der Praxis
- Charakterisierung mittelständischer Unternehmen
- Analyse der Wilhelma als Fallbeispiel
- Die verschiedenen Entwicklungsstufen des St. Galler Management-Modells
- Die sechs Schlüsselkategorien des St. Galler Management-Modells
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, beschreibt die Herausforderungen für Unternehmen im Kontext von technischem Fortschritt, Globalisierung und Digitalisierung und hebt die Notwendigkeit von Anpassungsfähigkeit hervor. Es benennt das St. Galler Management-Modell als Hilfsmittel zur Bewältigung dieser Herausforderungen und definiert das Hauptziel der Arbeit: die Untersuchung der Einsatzfähigkeit des Modells in einem deutschen mittelständischen Unternehmen. Die steigenden Anforderungen und der wachsende Wettbewerb zwingen kleine und mittlere Unternehmen zur Anpassung, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
Das St. Galler Management-Modell: Dieses Kapitel erläutert die Grundlagen, die Historie und die Entwicklung des St. Galler Management-Modells. Es werden die verschiedenen Generationen des Modells vorgestellt, mit einem besonderen Fokus auf das dritte Modell. Das Modell dient als Orientierungshilfe für Führungskräfte zur nachhaltigen Sicherung des Unternehmenserfolges, indem es hilft, Wichtiges von weniger Wichtigem zu unterscheiden, ohne konkrete Handlungsanweisungen zu geben.
Charakterisierung mittelständischer Unternehmen in Deutschland: Dieses Kapitel liefert eine Definition mittelständischer Unternehmen und präsentiert die Wilhelma, Zoologisch-Botanischer Garten Stuttgart, als ausgewähltes Fallbeispiel für die Anwendung des St. Galler Management-Modells. Der Fokus liegt auf der Vorstellung des Unternehmens und seiner spezifischen Eigenschaften im Kontext der mittelständischen Unternehmenslandschaft in Deutschland.
Einsatz des St. Galler Managementmodells am ausgewählten Unternehmen: Dieses Kapitel wendet das dritte St. Galler Management-Modell auf die Wilhelma an. Es analysiert die sechs Schlüsselkategorien des Modells (Umweltsphären, Anspruchsgruppen, Interaktionsthemen, Prozesse, Ordnungsmomente und Entwicklungsmodi) anhand praxisrelevanter Beispiele und Handlungsmöglichkeiten im Kontext des Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten Stuttgart.
Schlüsselwörter
St. Galler Management-Modell, Mittelständische Unternehmen, Wilhelma, Anpassungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit, Management, Digitalisierung, Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Anwendung des St. Galler Management-Modells auf die Wilhelma
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Anwendbarkeit des St. Galler Management-Modells auf ein deutsches mittelständisches Unternehmen, den Wilhelma Zoologisch-Botanischen Garten Stuttgart. Sie analysiert die Kernaspekte und Entwicklungsstufen des Modells und präsentiert die Wilhelma als Fallbeispiel.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Grundlagen des St. Galler Management-Modells, die Charakterisierung mittelständischer Unternehmen in Deutschland, die Anwendung des Modells auf die Wilhelma und eine kritische Reflexion der Ergebnisse. Es werden die sechs Schlüsselkategorien des Modells (Umweltsphären, Anspruchsgruppen, Interaktionsthemen, Prozesse, Ordnungsmomente und Entwicklungsmodi) im Detail analysiert.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Untersuchung der Anwendbarkeit des St. Galler Management-Modells in der Praxis an einem konkreten Beispiel – der Wilhelma. Es soll gezeigt werden, wie das Modell Führungskräften als Orientierungshilfe zur nachhaltigen Sicherung des Unternehmenserfolges dienen kann.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zum St. Galler Management-Modell, ein Kapitel zur Charakterisierung mittelständischer Unternehmen und die Wilhelma als Fallbeispiel, ein Kapitel zur Anwendung des Modells auf die Wilhelma und eine abschließende Zusammenfassung und kritische Reflexion.
Was sind die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: St. Galler Management-Modell, Mittelständische Unternehmen, Wilhelma, Anpassungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit, Management, Digitalisierung, Globalisierung.
Welche Aspekte des St. Galler Management-Modells werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Grundlagen, die Historie und die Entwicklung des St. Galler Management-Modells, insbesondere das dritte Modell. Der Fokus liegt auf den sechs Schlüsselkategorien und deren Anwendung auf die Wilhelma.
Wie wird die Wilhelma in der Arbeit betrachtet?
Die Wilhelma dient als Fallbeispiel für die Anwendung des St. Galler Management-Modells. Die Arbeit präsentiert das Unternehmen und analysiert dessen spezifische Eigenschaften im Kontext der mittelständischen Unternehmenslandschaft in Deutschland.
Welche Herausforderungen werden für Unternehmen im Kontext der Arbeit genannt?
Die Arbeit hebt die Herausforderungen für Unternehmen durch technischen Fortschritt, Globalisierung und Digitalisierung hervor und betont die Notwendigkeit von Anpassungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit.
Was ist das Ergebnis der Anwendung des St. Galler Management-Modells auf die Wilhelma?
Das Ergebnis der Anwendung wird im Kapitel "Einsatz des St. Galler Managementmodells am ausgewählten Unternehmen" detailliert dargestellt und in der Zusammenfassung kritisch reflektiert. Es umfasst eine Analyse der sechs Schlüsselkategorien des Modells im Kontext der Wilhelma.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker, die sich mit dem St. Galler Management-Modell, mittelständischen Unternehmen und der Anwendung von Managementmodellen in der Praxis befassen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Das St. Galler Management-Modell. Einsatzfähigkeit in einem mittelständischen Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/515166