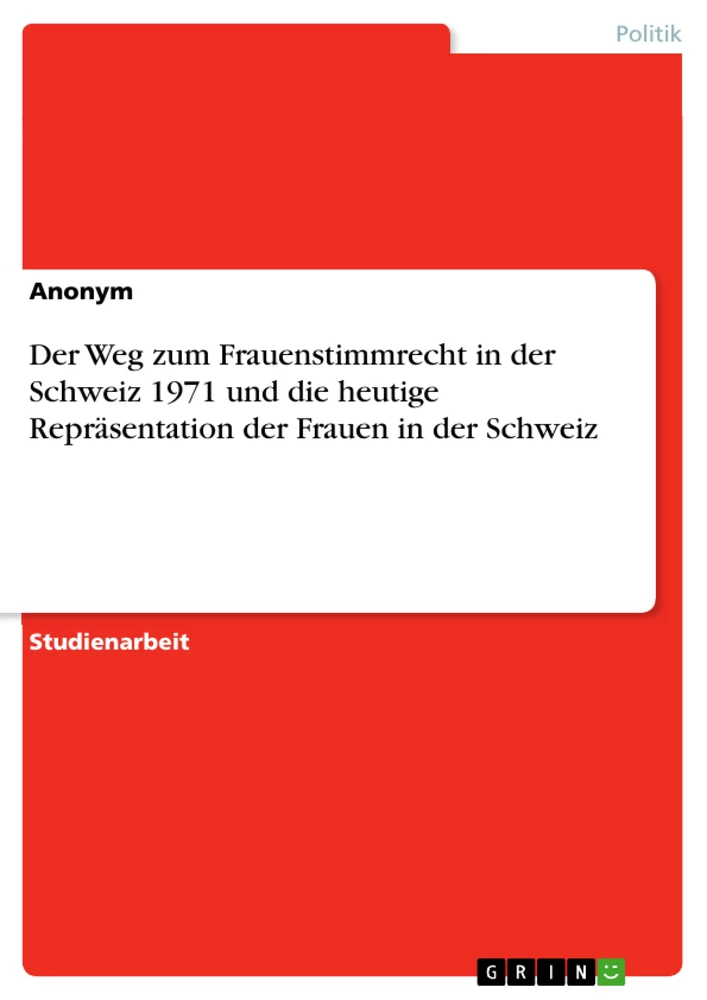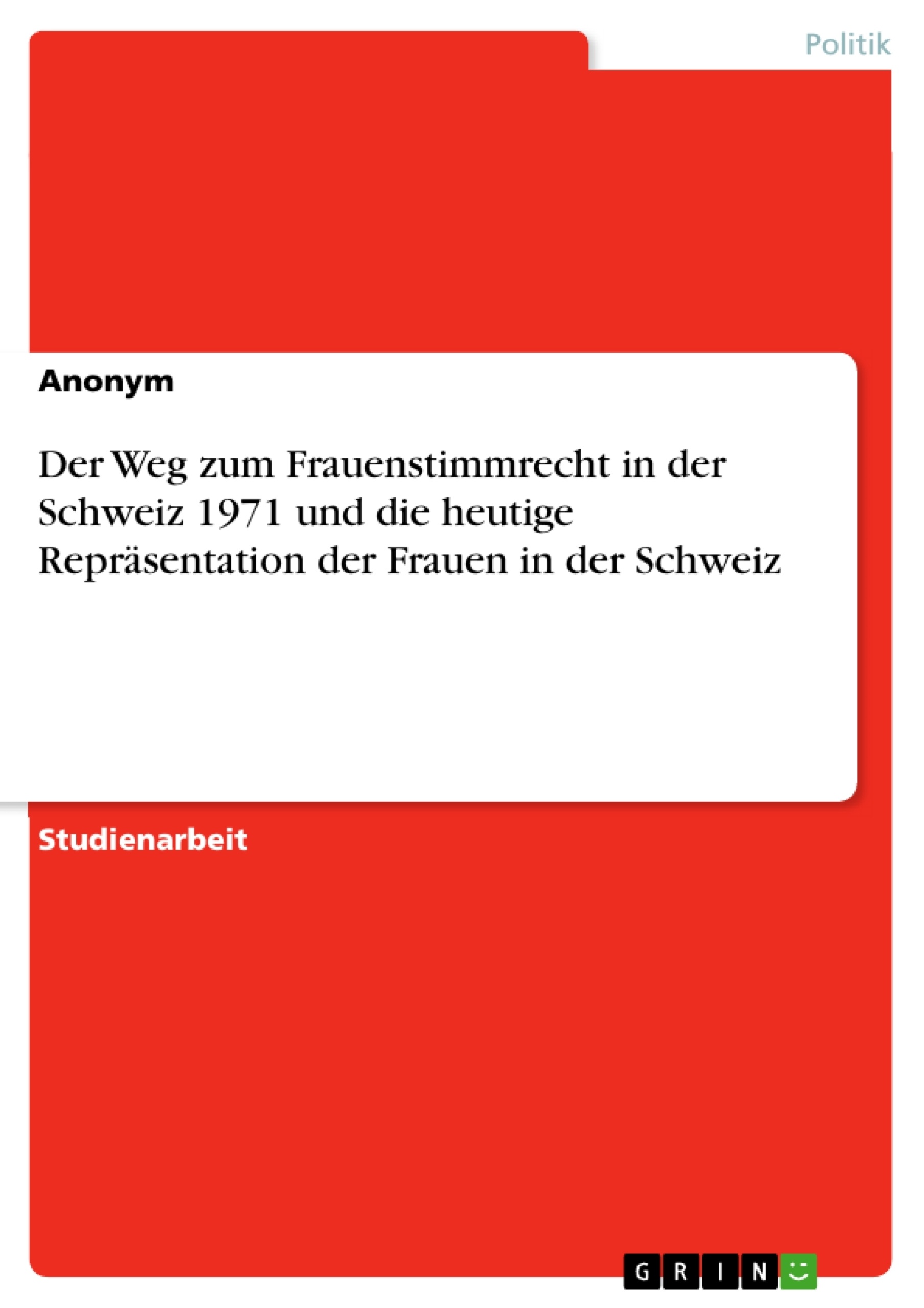Einleitung
Die heutige Schweiz gilt als ein modernes Land, welches besonders stolz auf die ausgeprägte Mitbestimmung seiner Bürger durch viele direktdemokratische Elemente ist. Der Souverän - das schweizerische Volk - wählt das Parlament, die Regierung und das oberste Gericht. Darüber hinaus entscheiden alle Stimmberechtigten über Änderungen der Verfassung und den Beitritt zu bestimmten internationalen Organisationen in einem obligatorischen Referendum und können Gesetzesänderungen und Beschlüsse zu völkerrechtlichen Verträgen mit einem fakultativen Referendum anstreben. So "haben alle mündigen Schweizerinnen und Schweizer ab 18 Jahren das aktive und passive Wahlrecht; d.h. sie dürfen sowohl wählen, als auch sich selbst zur Wahl stellen"1.
Beschäftigt man sich mit dem politischen System der Schweiz ist zu bemerken, dass selbstverständlich Männer und Frauen in schweizerischen Institutionen vertreten sind und politische Ämter innehaben. Ganz nach dem Wert der Gleichberechtigung von Mann und Frau kann sich jeder Bürger der Schweiz am politischen System partizipieren und eigene Vorschläge einbringen. Bei den letzten Nationalratswahlen im Jahr 2003 wurden 26% Frauen und 74% Männer in das Parlament gewählt. Doch war es immer so leicht für Frauen ihre Stimm- und Wahlrechte wahrzunehmen? Wie kam es dazu, dass die Schweiz erst 1971 als eines der letzten europäischen Länder das Frauenstimmrecht auf eidgenössischer Ebene einführte? Wieso mussten die Frauen 123 Jahre seit der Gründung der Schweiz auf ihre politische Gleichstellung warten?
Diese Fragen drängen sich dem Beobachter förmlich auf, wenn er sich über das politische System der Schweiz und speziell über die Rolle der Frau in diesem informiert. In meiner Hausarbeit möchte ich vor allem jene Gründe untersuchen, die diese Verzögerung der politischen Gleichberechtigung der Frauen bewirkten. Beleuchten möchte ich in diesem Zusammenhang den langen Weg zur Einführung des FSR auf eidgenössischer und kantonaler Ebene. Angefangen im 18. und 19. Jahrhundert, in denen sich erste Vorläufer des Kampfes für das FSR abzeichneten, möchte ich den anschließenden zeitlichen Verlauf in zwei Phasen unterteilen. Nachdem ich die Entwicklungen von 1900 bis 1959 dargestellt und analysiert haben werde, wird in einem zweiten Schritt der Zeitraum zwischen den beiden Volksabstimmungen 1959 und 1971 in seinen Entwicklungen darstellen werden...
---
1 Schweizerische Bundeskanzlei: Der Bund kurz erklärt 2005, 27. Aufl., Bern 2005, S.16.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Kampf auf eidgenössischer Ebene
- 2.1 Entwicklungen des 18. und 19. Jahrhunderts
- 2.2 1900-1959 Vorstöße und Verschleppungstaktiken
- 2.3 1959-1971 Endspurt
- 3. Der Kampf auf kantonaler Ebene
- 4. Verfassungsartikel zum Stimm- und Wahlrecht der Frauen
- 4.1 Bundesverfassung 1848
- 4.2 Bundesverfassung 1874
- 4.3 Bundesverfassung 1999
- 5. Sind die Frauen heute den Männern politisch gleichgestellt? - Aktuelle Entwicklungen am Beispiel der Wahlen 2002/2003
- 5.1 passives Wahlrecht der Frauen
- 5.1.1 Nationalratswahlen 2003
- 5.1.2 Ständeratswahlen 2002/2003
- 5.1.3 Bundesratswahlen 2003
- 5.1.4 Kantonale Wahlen 2000-2003
- 5.2 aktives Wahlrecht der Frauen
- 5.1 passives Wahlrecht der Frauen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Gründe für die verspätete Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz bis 1971. Sie beleuchtet den langen Kampf um die politische Gleichberechtigung von Frauen auf eidgenössischer und kantonaler Ebene und analysiert die Entwicklungen von den Anfängen im 18. und 19. Jahrhundert bis zum Endspurt in den 1960er Jahren. Die Arbeit untersucht auch die aktuelle Repräsentation von Frauen in der Politik und stellt die Frage nach der tatsächlichen Erreichung der politischen Gleichstellung.
- Der Kampf um das Frauenstimmrecht auf eidgenössischer Ebene
- Der Kampf um das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene
- Die Entwicklung des Frauenstimmrechts in der Schweizerischen Bundesverfassung
- Die politische Repräsentation von Frauen in der Schweiz (2002/2003)
- Die Frage nach der tatsächlichen politischen Gleichstellung von Frauen in der Schweiz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor. Sie beschreibt das scheinbare Paradoxon einer modernen, direktdemokratischen Schweiz, die erst 1971 das Frauenstimmrecht auf eidgenössischer Ebene einführte. Die Arbeit fokussiert auf die Ursachen dieser Verzögerung und untersucht den Weg zur Einführung des Frauenstimmrechts auf eidgenössischer und kantonaler Ebene, sowie die aktuelle politische Situation der Frauen in der Schweiz. Der Fokus liegt auf der Entwicklung bis 1971 und einem Vergleich mit der Situation zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Die Frage nach der Erreichung der politischen Gleichstellung wird als Leitfrage formuliert.
2. Der Kampf auf eidgenössischer Ebene: Dieses Kapitel beschreibt den langen Kampf der Frauen um das Stimmrecht auf nationaler Ebene. Es beginnt mit den ersten Ansätzen im 18. und 19. Jahrhundert, wo Frauenvereine zwar existierten, sich aber zunächst auf soziale und zivilrechtliche Anliegen konzentrierten. Die Verfassungsrevisionen von 1848 und 1874 ignorierten das Frauenwahlrecht. Ab 1886 werden die Forderungen nach politischer Gleichberechtigung verstärkt, werden aber immer wieder verzögert und abgelehnt. Das Kapitel unterteilt die Entwicklung in verschiedene Phasen, um den langen und mühsamen Weg zum Erfolg zu beleuchten und die verschiedenen Strategien und Hindernisse aufzuzeigen.
3. Der Kampf auf kantonaler Ebene: Dieses Kapitel befasst sich mit dem parallelen Kampf der Frauen um das Stimmrecht auf kantonaler Ebene. Im Gegensatz zum Kapitel über den eidgenössischen Kampf, fokussiert dieses Kapitel auf die diversen regionalen Entwicklungen und die unterschiedlichen Strategien und Erfolge in den einzelnen Kantonen. Es analysiert, wie die kantonalen Entwicklungen den nationalen Kampf beeinflussten und welche Rolle regionale Unterschiede spielten. Es wird auf die spezifischen Herausforderungen und Erfolge auf kantonaler Ebene eingegangen.
4. Verfassungsartikel zum Stimm- und Wahlrecht der Frauen: Dieses Kapitel analysiert die relevanten Artikel der Schweizer Bundesverfassungen von 1848, 1874 und 1999 im Hinblick auf das Stimm- und Wahlrecht der Frauen. Es zeigt die Abwesenheit von expliziten Frauenrechten in den frühen Verfassungen auf und beleuchtet die schrittweise Veränderung der rechtlichen Grundlage für die politische Partizipation von Frauen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der gesetzlichen Bestimmungen und ihrer Bedeutung im Kontext des Kampfes um das Frauenstimmrecht.
5. Sind die Frauen heute den Männern politisch gleichgestellt? - Aktuelle Entwicklungen am Beispiel der Wahlen 2002/2003: Dieses Kapitel analysiert die politische Repräsentation von Frauen in der Schweiz anhand der Wahlen von 2002 und 2003. Es untersucht sowohl das aktive als auch das passive Wahlrecht und beleuchtet die Wahlbeteiligung von Frauen, ihre Vertretung in den verschiedenen politischen Gremien (Nationalrat, Ständerat, Bundesrat) und die Verteilung auf verschiedene Parteien. Der Vergleich der Ergebnisse erlaubt eine Einschätzung, inwiefern die Frauen in der Schweizer Politik tatsächlich gleichberechtigt vertreten sind und ob der jahrhundertelange Kampf sein Ziel erreicht hat.
Schlüsselwörter
Frauenstimmrecht, politische Gleichstellung, Schweiz, Frauenbewegung, direkte Demokratie, Bundesverfassung, Nationalratswahlen, Ständeratswahlen, Bundesratswahlen, kantonale Wahlen, politische Partizipation, geschlechtsspezifische Ungleichheiten.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Der Kampf um das Frauenstimmrecht in der Schweiz
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den langen Kampf um die Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz bis 1971. Sie analysiert die Entwicklungen auf eidgenössischer und kantonaler Ebene, von den Anfängen im 18. und 19. Jahrhundert bis zum Erreichen des Ziels in den 1970er Jahren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der aktuellen politischen Repräsentation von Frauen und der Frage nach der tatsächlichen politischen Gleichstellung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Kampf um das Frauenstimmrecht auf nationaler und kantonaler Ebene, die Entwicklung des Frauenstimmrechts in der Schweizerischen Bundesverfassung (1848, 1874 und 1999), die politische Repräsentation von Frauen in der Schweiz (2002/2003) und die Frage nach der tatsächlichen Erreichung der politischen Gleichstellung.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Der Kampf auf eidgenössischer Ebene, Der Kampf auf kantonaler Ebene, Verfassungsartikel zum Stimm- und Wahlrecht der Frauen und Sind die Frauen heute den Männern politisch gleichgestellt? - Aktuelle Entwicklungen am Beispiel der Wahlen 2002/2003. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas und liefert eine detaillierte Analyse.
Welche Zeiträume werden in der Hausarbeit betrachtet?
Die Hausarbeit betrachtet den Zeitraum vom 18. und 19. Jahrhundert bis zu den Wahlen von 2002/2003. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung bis 1971 (Einführung des Frauenstimmrechts auf eidgenössischer Ebene) und einem Vergleich mit der Situation zu Beginn des 21. Jahrhunderts.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Quelle ist eine OCR-Version eines Textes, der einen umfassenden Überblick über den Kampf um das Frauenstimmrecht in der Schweiz bietet. Genaueres über die konkreten Quellen wird im Text nicht angegeben.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Hausarbeit?
Die Hausarbeit zeigt den langen und mühsamen Kampf der Frauen um politische Gleichberechtigung in der Schweiz auf. Sie analysiert die verschiedenen Strategien, Hindernisse und regionalen Unterschiede. Die Analyse der Wahlergebnisse von 2002/2003 erlaubt eine Einschätzung, inwieweit die politische Gleichstellung tatsächlich erreicht wurde.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Frauenstimmrecht, politische Gleichstellung, Schweiz, Frauenbewegung, direkte Demokratie, Bundesverfassung, Nationalratswahlen, Ständeratswahlen, Bundesratswahlen, kantonale Wahlen, politische Partizipation, geschlechtsspezifische Ungleichheiten.
Für wen ist diese Hausarbeit relevant?
Diese Hausarbeit ist relevant für alle, die sich für die Geschichte des Frauenstimmrechts in der Schweiz, die Frauenbewegung und die politische Gleichstellung von Frauen interessieren. Sie eignet sich für akademische Zwecke, insbesondere für Studierende der Geschichte, Politikwissenschaft und Gender Studies.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2005, Der Weg zum Frauenstimmrecht in der Schweiz 1971 und die heutige Repräsentation der Frauen in der Schweiz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51518