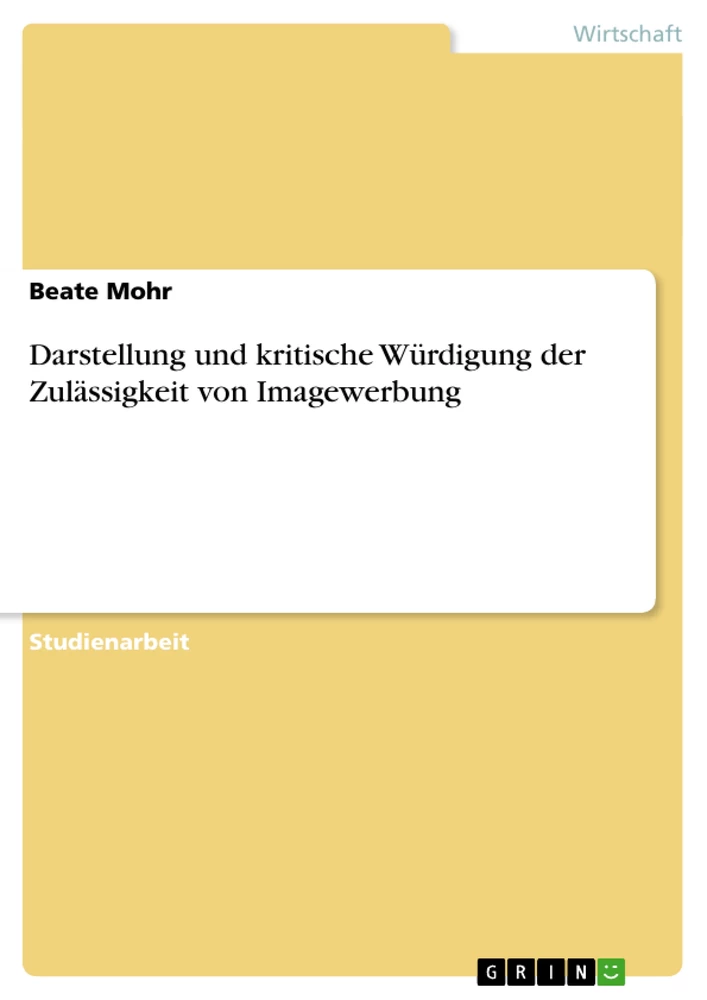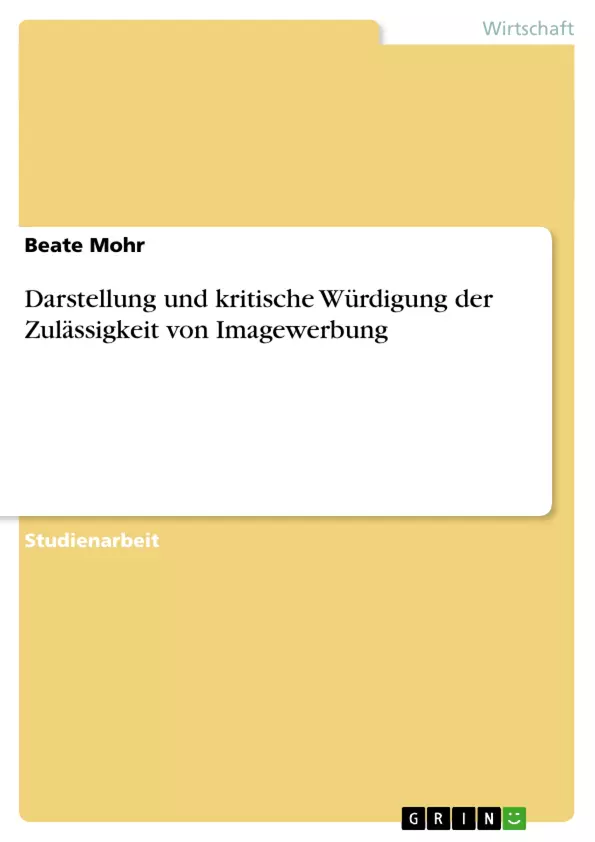Einleitung
„Mehr Werbung bedeutet mehr Wettbewerb.“ Diese bereits im Jahre 1963 von dem damaligen Präsidenten der EWG-Kommission getroffene Aussage zeigt, dass Werbung seit jeher zentraler Bestandteil der Wirtschaftswelt ist.1 In Deutschland wird Werbung grundsätzlich eine positive Grundstimmung entgegen gebracht. Im Jahr 1995 waren 41,7 Prozent der Auffassung, dass Werbung „ganz hilfreich für die Verbraucher“ sei. Heute bestätigen dies 50,3 Prozent der Befragten. Sogar 60,3 Prozent waren 2003 der Meinung, dass Werbung „manchmal recht nützliche Hinweise über neue Produkte“ gebe.2 Dass Werbung dabei keine reine Informationsweitergabe mehr darstellt, zeigt die Tatsache, dass 36,2 Prozent angaben, Werbung besitze für sie Unterhaltungswert. Die grundsätzliche Akzeptanz von Werbung wird auch dadurch deutlich, dass der Aussage „Ohne Werbung wäre unser Leben schöner!“ nur noch 4,7 Prozent der Befragten zustimmten.3 Werbung als Kommunikationsmaßnahme wird von der Mehrzahl der Bürger somit als Bestandteil des täglichen Lebens gesehen.
Die Tatsache, dass ein Bundesbürger in der heutigen Zeit durchschnittlich 8 Stunden am Tag mit der Nutzung von Medien verbringt – im Jahr 1999 waren es lediglich 6,5 Stunden – belegt, dass er einen Großteil seines Tages Werbemaßnahmen ausgesetzt ist.4 Werbespots im Fernsehen, Anzeigen in der Zeitung, Plakate, Internetwerbung und Radiospots beeinflussen den Verbraucher zu jeder Tageszeit. Es erscheint daher nicht verwunderlich, wenn Menschen über Reizüberflutung und Abstumpfung klagen.5 Rein informative Produktwerbung erregt somit heute nur noch schwer die Aufmerksamkeit der Verbraucher. Daher muss die Werbebranche versuchen, sich durch neue Methoden die Aufmerksamkeit der Bürger zu sichern.
---
1 Vgl. Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (Hrsg.), Werbung in Deutschland 2004, Berlin 2004, Verlag edition ZAW, S. 78.
2 Vgl. a.a.O.
3 Vgl. a.a.O.
4 Vgl. ebenda, S. 18.
5 Vgl. Internetpräsenz Profundus, abgerufen unter www.derprofundis.de/ Profil/Marketing/body_marketing.html, am 27.09.2004.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsdefinition
- 2.1 Werbung als wirtschaftlicher und rechtlicher Begriff
- 2.2 Imagewerbung als Teil der gefühlsbetonten Werbung
- 2.2.1 Reine Imagewerbung
- 2.2.2 Imagewerbung mit Appell
- 2.2.3 Imagewerbung mit Schock
- 2.2.4 Abgrenzung zu anderen Werbearten
- 3 Rechtliche Zulässigkeit von Imagewerbung
- 3.1 Anwendbares Recht
- 3.2 Allgemeine Darstellung des Kernbereichs des UWG
- 3.3 Rechtliche Schranken von Imagewerbung
- 3.3.1 Allgemeine Einführung
- 3.3.2 Imagewerbung mit Appell an die soziale Verantwortung
- 3.3.2.1 Allgemeines
- 3.3.2.2 Praxisbeispiel Krombacher Regenwald Projekt
- 3.3.3 Imagewerbung mit dem Element des Schocks
- 3.3.3.1 Allgemeines
- 3.3.3.2 Praxisbeispiel Benetton Werbekampagne
- 4 Kritische Würdigung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Zulässigkeit von Imagewerbung. Ziel ist es, den Begriff der Imagewerbung zu definieren, die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen zu beleuchten und eine kritische Würdigung der Zulässigkeit vorzunehmen.
- Definition und Abgrenzung von Imagewerbung
- Rechtliche Grundlagen der Imagewerbung im UWG
- Analyse der rechtlichen Schranken von Imagewerbung
- Fallbeispiele (Krombacher, Benetton)
- Kritische Auseinandersetzung mit der Zulässigkeit von Imagewerbung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Untersuchung zur Zulässigkeit von Imagewerbung. Sie gibt einen Überblick über die folgenden Kapitel und die behandelten Aspekte.
2 Begriffsdefinition: Dieses Kapitel befasst sich mit der präzisen Definition von Werbung im wirtschaftlichen und rechtlichen Kontext. Es differenziert anschließend zwischen verschiedenen Arten von Imagewerbung (reine Imagewerbung, Imagewerbung mit Appell, Imagewerbung mit Schockelement) und grenzt diese von anderen Werbeformen ab. Der Fokus liegt auf der Klärung der Begrifflichkeiten, die für das Verständnis der rechtlichen Analyse im folgenden Kapitel unerlässlich sind.
3 Rechtliche Zulässigkeit von Imagewerbung: Der zentrale Teil der Arbeit analysiert die rechtliche Zulässigkeit von Imagewerbung, insbesondere im Kontext des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Das Kapitel beleuchtet zunächst die anwendbaren Rechtsnormen und beschreibt den Kernbereich des UWG. Im Detail werden die rechtlichen Schranken der Imagewerbung untersucht, unter Berücksichtigung von Imagewerbung mit Appell an die soziale Verantwortung (am Beispiel des Krombacher Regenwaldprojekts) und Imagewerbung mit Schockeffekten (am Beispiel der Benetton-Kampagne). Die Analyse der Fallbeispiele verdeutlicht die praktische Anwendung der rechtlichen Rahmenbedingungen.
Schlüsselwörter
Imagewerbung, Werbung, UWG, Lauterkeitsrecht, soziale Verantwortung, Schockwerbung, Rechtliche Zulässigkeit, Krombacher, Benetton.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Zulässigkeit von Imagewerbung
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die rechtliche Zulässigkeit von Imagewerbung. Sie definiert den Begriff der Imagewerbung, beleuchtet die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen und bietet eine kritische Würdigung der Zulässigkeit.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Imagewerbung, rechtliche Grundlagen im UWG, Analyse rechtlicher Schranken, Fallbeispiele (Krombacher, Benetton), und eine kritische Auseinandersetzung mit der Zulässigkeit von Imagewerbung.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, eine Begriffsdefinition von Imagewerbung (inklusive verschiedener Arten wie reine Imagewerbung, Imagewerbung mit Appell und mit Schockeffekt), eine Analyse der rechtlichen Zulässigkeit im Kontext des UWG (mit Fokus auf anwendbarem Recht und rechtlichen Schranken), und schliesslich eine kritische Würdigung und ein Fazit.
Welche Arten von Imagewerbung werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen reiner Imagewerbung, Imagewerbung mit Appell und Imagewerbung mit Schockelement. Diese werden definiert und voneinander abgegrenzt.
Welches Recht ist für die Zulässigkeit von Imagewerbung relevant?
Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) bildet den zentralen rechtlichen Rahmen für die Analyse der Zulässigkeit von Imagewerbung. Die Arbeit beleuchtet die anwendbaren Rechtsnormen und den Kernbereich des UWG.
Welche Fallbeispiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Imagewerbung des Krombacher Regenwaldprojekts (als Beispiel für Imagewerbung mit Appell an die soziale Verantwortung) und die Benetton-Kampagne (als Beispiel für Imagewerbung mit Schockeffekten).
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Seminararbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Imagewerbung, Werbung, UWG, Lauterkeitsrecht, soziale Verantwortung, Schockwerbung, Rechtliche Zulässigkeit, Krombacher, Benetton.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Seminararbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel: Einleitung, Begriffsdefinition, Rechtliche Zulässigkeit von Imagewerbung und Schlussfolgerungen.
Was ist das Ziel der Seminararbeit?
Das Ziel ist die umfassende Untersuchung der Zulässigkeit von Imagewerbung unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und einer kritischen Bewertung.
- Quote paper
- Beate Mohr (Author), 2004, Darstellung und kritische Würdigung der Zulässigkeit von Imagewerbung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51537