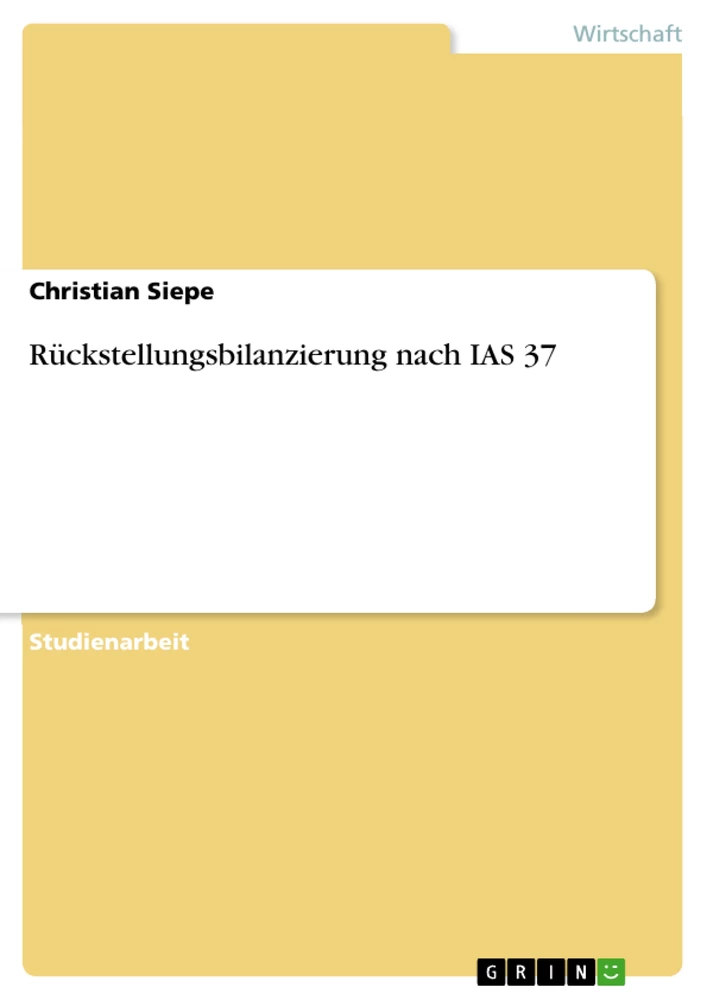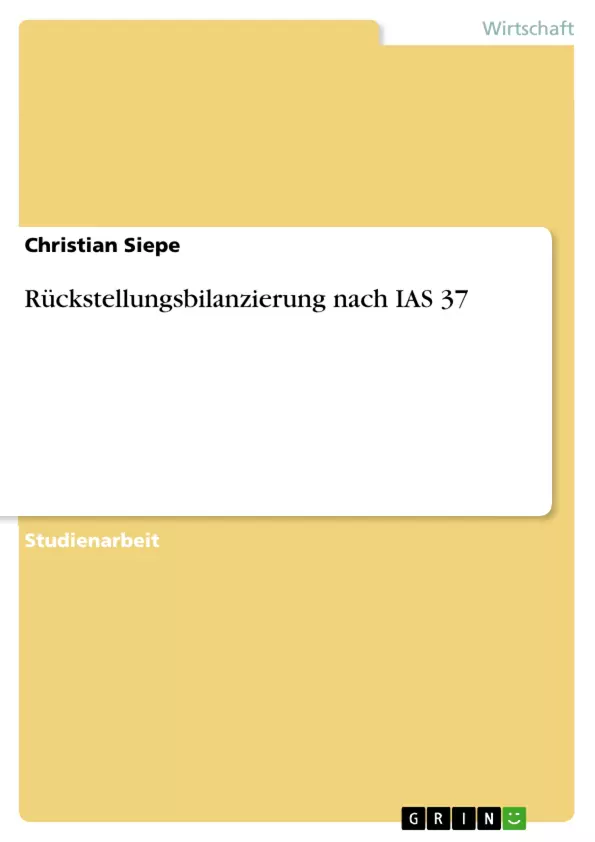Problemstellung
Eine zentrale Aufgabe jeder Rechnungslegung ist, die am Bilanzstichtag bestehenden Lasten und die damit verbundenen künftigen Ausgaben abzubilden. Die Bilanzierung sicherer Verpflichtungen, wie etwa Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, gestaltet sich dabei weniger problematisch als die Bilanzierung von Rückstellungen für ungewisse Verpflichtungen. Den Rückstellungskriterien kommt daher die Funktion zu, die passivierungspflichtigen Sachverhalte möglichst trennscharf und den Zwecken des Jahresabschlusses entsprechend zu definieren.1 Die Behandlung dieser bedeutenden Bilanzposition beeinflusst in erheblichem Maße die Zweckadäquanz eines Rechnungslegungssystems.2 Die Regelungen zur Rückstellungsbilanzierung nach IFRS und nach HGB weisen zumindest im Detail nicht unerhebliche Unterschiede auf. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die abweichende Zielsetzung der beiden Rechnungslegungssysteme. Der Zweck der IFRS besteht in der Vermittlung entscheidungsnützlicher Informationen, während das HGB auf die Ermittlung und Begrenzung eines ausschüttungsfähigen Gewinns abstellt. Informationen müssen im System der IFRS sowohl relevant, d. h. materiell bedeutsam, als auch zuverlässig, also möglichst unbeeinflusst durch Wahlrechte und Ermessensentscheidungen, sein. Folglich stehen auch bei der Rückstellungsbilanzierung nach IFRS nicht der Gläubigerschutz und das Vorsichtsprinzip, sondern die Informationsbedürfnisse der Bilanzadressaten im Vordergrund.3
Der Rechnungsinhalt eines Standards ist am Rechnungszweck zu messen.4 Die vorliegende Arbeit verfolgt daher zum einen das Ziel, die Vorschriften zur Rückstellungsbilanzierung nach IAS 37 zu erläutern, wesentliche konzeptionelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten zum HGB aufzuzeigen und die Vereinbarkeit von IAS 37 mit der Gesamtzielsetzung der IFRS zu hinterfragen. Besonders problembehaftet erscheint in diesem Zusammenhang die Berücksichtigung von Wahrscheinlichkeiten auf der Ansatzebene. In einem zweiten Schritt erfolgt die Darstellung und kritische Würdigung der geplanten Änderungen zur Rückstellungsbilanzierung durch ED IAS 37...
---
1 Vgl. Euler/Engel-Ciric (2004), S. 140.
2 Vgl. Pfitzer/Kahre (2004), S. 203.
3 Vgl. Lüdenbach (2003), S. 44-47; vgl. auch: Ruhnke (2005), S. 547.
4 Vgl. Haaker (2005 b), S. 8.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung
- 2. Regelungsinhalt und terminologische Grundlagen von IAS 37
- 2.1 Anwendungsbereich und Zielsetzung
- 2.2 Begriffliche Abgrenzungen der Rückstellungen von den sonstigen Schulden und Eventualschulden
- 3. Einzelaspekte der Bilanzierung von Rückstellungen
- 3.1 Allgemeine Ansatzvorschriften für Rückstellungen
- 3.2 Besonderheiten beim Ansatz von Drohverlustrückstellungen
- 3.3 Ansatz und Verhältnis von Aufwands- und Restrukturierungsrückstellungen
- 3.4 Zugangs- und Folgebewertung von Rückstellungen
- 3.5 Ausweis- und Angabepflichten
- 4. Geplante Änderungen der Rückstellungsbilanzierung durch ED IAS 37
- 4.1 Präzisierung von Anwendungsbereich und Terminologie
- 4.2 Die Abschaffung des Wahrscheinlichkeitskriteriums beim Rückstellungsansatz
- 4.3 Die Berücksichtigung von Eintrittswahrscheinlichkeiten bei der Bewertung
- 4.4 Kritische Würdigung des Standardentwurfs
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vorschriften zur Rückstellungsbilanzierung nach IAS 37. Ziel ist es, die Vorschriften zu erläutern, konzeptionelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten zum HGB aufzuzeigen und die Vereinbarkeit von IAS 37 mit der Gesamtzielsetzung der IFRS zu hinterfragen. Ein weiterer Fokus liegt auf der kritischen Würdigung geplanter Änderungen durch ED IAS 37 und der Analyse, inwiefern sich konzeptionelle Verbesserungen ergeben.
- Erläuterung der Vorschriften zur Rückstellungsbilanzierung nach IAS 37
- Vergleich der Vorschriften von IAS 37 mit dem HGB
- Bewertung der Vereinbarkeit von IAS 37 mit den IFRS-Zielen
- Analyse der geplanten Änderungen durch ED IAS 37
- Kritische Würdigung der konzeptionellen Verbesserungen und des Konkretisierungsbedarfs
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung: Die Arbeit behandelt die Herausforderungen der Bilanzierung ungewisser Verpflichtungen (Rückstellungen) und die Unterschiede zwischen IFRS und HGB bezüglich der Zielsetzung und der Berücksichtigung von Wahrscheinlichkeiten bei der Bilanzierung. Die Arbeit untersucht die Vorschriften von IAS 37 und geplante Änderungen (ED IAS 37).
2. Regelungsinhalt und terminologische Grundlagen von IAS 37: Dieses Kapitel definiert den Anwendungsbereich und die Zielsetzung von IAS 37. Es befasst sich mit der Abgrenzung von Rückstellungen zu anderen Schulden und Eventualschulden und legt die terminologischen Grundlagen für das Verständnis des Standards fest. Die unterschiedlichen Zielsetzungen von IFRS (entscheidungsnützlich) und HGB (Gewinn-Ermittlung und -Begrenzung) werden als Grund für die Unterschiede in der Regulierung hervorgehoben. Die Bedeutung von Relevanz und Zuverlässigkeit der Informationen im IFRS-Kontext wird betont.
3. Einzelaspekte der Bilanzierung von Rückstellungen: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Bilanzierung von Rückstellungen nach IAS 37. Es behandelt die allgemeinen Ansatzvorschriften, Besonderheiten beim Ansatz von Drohverlustrückstellungen, den Umgang mit Aufwands- und Restrukturierungsrückstellungen, die Zugangs- und Folgebewertung sowie die Ausweis- und Angabepflichten. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung des Standards und der Berücksichtigung verschiedener Szenarien. Die Kapitelteile beleuchten die unterschiedlichen Aspekte der Rückstellungsbilanzierung und die damit verbundenen Herausforderungen. Die Bedeutung der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bei der Bewertung und die Berücksichtigung der verschiedenen Arten von Rückstellungen werden ausführlich erläutert.
4. Geplante Änderungen der Rückstellungsbilanzierung durch ED IAS 37: Dieses Kapitel analysiert den Exposure Draft zu IAS 37 und seine geplanten Änderungen. Es befasst sich mit der Präzisierung von Anwendungsbereich und Terminologie, der Abschaffung des Wahrscheinlichkeitskriteriums beim Ansatz von Rückstellungen und der Berücksichtigung von Eintrittswahrscheinlichkeiten bei der Bewertung. Eine kritische Würdigung des Standardentwurfs hinsichtlich konzeptioneller Verbesserungen und weiterem Konkretisierungsbedarf rundet das Kapitel ab. Der Fokus liegt auf der Bewertung der Auswirkungen der vorgeschlagenen Änderungen auf die Informationsqualität und die praktische Anwendung des Standards. Die Diskussion der geplanten Änderungen liefert eine wichtige Perspektive auf die zukünftige Entwicklung der Rückstellungsbilanzierung.
Schlüsselwörter
IAS 37, Rückstellungen, Bilanzierung, IFRS, HGB, Wahrscheinlichkeit, Drohverlustrückstellungen, Restrukturierungsrückstellungen, ED IAS 37, Informationsbedürfnisse, Vorsichtsprinzip, Relevanz, Zuverlässigkeit.
Häufig gestellte Fragen zu: Untersuchung der Rückstellungsbilanzierung nach IAS 37
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Vorschriften zur Rückstellungsbilanzierung nach IAS 37, erläutert diese, zeigt konzeptionelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten zum HGB auf und hinterfragt die Vereinbarkeit von IAS 37 mit den IFRS-Zielen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der kritischen Würdigung geplanter Änderungen durch ED IAS 37 und der Analyse resultierender konzeptioneller Verbesserungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Erläuterung der Vorschriften zur Rückstellungsbilanzierung nach IAS 37, Vergleich mit dem HGB, Bewertung der Vereinbarkeit von IAS 37 mit den IFRS-Zielen, Analyse der geplanten Änderungen durch ED IAS 37 und kritische Würdigung der konzeptionellen Verbesserungen und des Konkretisierungsbedarfs. Im Detail werden der Anwendungsbereich, die Zielsetzung, die Abgrenzung von Rückstellungen zu anderen Schulden und Eventualschulden, der Ansatz von Rückstellungen (inkl. Drohverlust- und Restrukturierungsrückstellungen), die Bewertung, der Ausweis und die Angabepflichten behandelt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Problemstellung, 2. Regelungsinhalt und terminologische Grundlagen von IAS 37, 3. Einzelaspekte der Bilanzierung von Rückstellungen, 4. Geplante Änderungen der Rückstellungsbilanzierung durch ED IAS 37 und 5. Zusammenfassung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Rückstellungsbilanzierung nach IAS 37 und den geplanten Änderungen.
Was sind die zentralen Unterschiede zwischen IAS 37 und HGB bezüglich der Rückstellungsbilanzierung?
Die Arbeit hebt die unterschiedlichen Zielsetzungen von IFRS (entscheidungsnützlich) und HGB (Gewinn-Ermittlung und -Begrenzung) als Grund für die Unterschiede in der Regulierung hervor. Konkrete Unterschiede werden in den einzelnen Kapiteln im Detail erläutert, insbesondere hinsichtlich des Wahrscheinlichkeitskriteriums und der Bewertung von Rückstellungen.
Welche geplanten Änderungen durch ED IAS 37 werden analysiert?
Analysiert werden die Präzisierung von Anwendungsbereich und Terminologie, die Abschaffung des Wahrscheinlichkeitskriteriums beim Ansatz von Rückstellungen und die Berücksichtigung von Eintrittswahrscheinlichkeiten bei der Bewertung. Die Arbeit bewertet die Auswirkungen der vorgeschlagenen Änderungen auf die Informationsqualität und die praktische Anwendung des Standards.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: IAS 37, Rückstellungen, Bilanzierung, IFRS, HGB, Wahrscheinlichkeit, Drohverlustrückstellungen, Restrukturierungsrückstellungen, ED IAS 37, Informationsbedürfnisse, Vorsichtsprinzip, Relevanz, Zuverlässigkeit.
Welche konzeptionellen Verbesserungen werden durch ED IAS 37 angestrebt?
Die Arbeit analysiert, inwiefern der ED IAS 37 konzeptionelle Verbesserungen im Bereich der Rückstellungsbilanzierung bringt und ob weiterer Konkretisierungsbedarf besteht. Der Fokus liegt auf der Verbesserung der Informationsqualität und der praktischen Anwendbarkeit des Standards.
- Citation du texte
- Christian Siepe (Auteur), 2005, Rückstellungsbilanzierung nach IAS 37, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51596