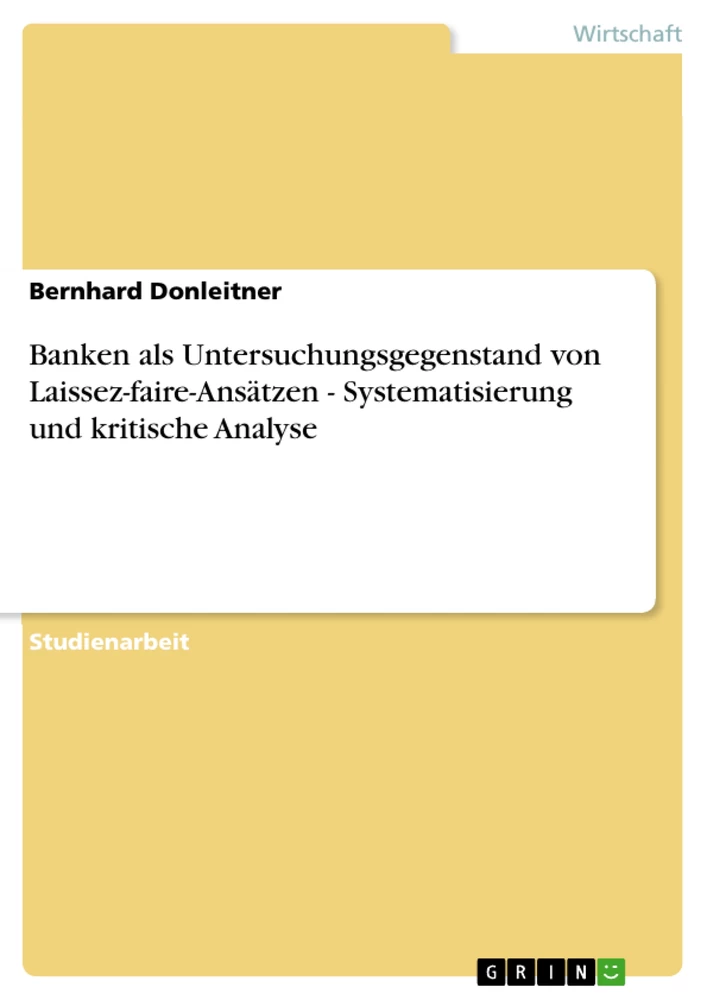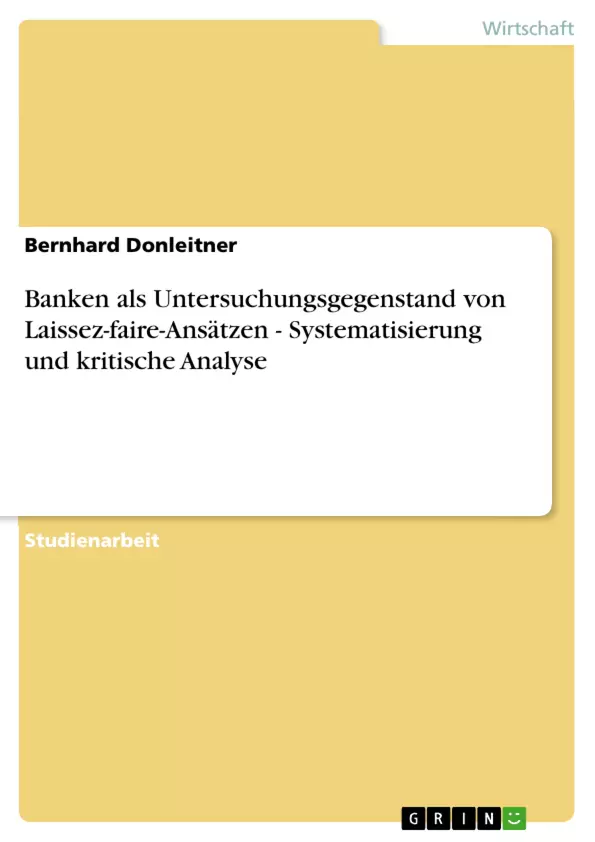Banken und ihre Sonderstellung in der Volkswirtschaft
Die Banken spielen in den Volkswirtschaften des 21. Jahrhunderts eine wesentliche Rolle, da sie untereinander in vielfältiger Weise verknüpft sind und weil sie praktisch mit allen Wirtschaftsteilnehmern in engen finanziellen Beziehungen stehen. Störungen innerhalb des Bankenbereichs können daher, durch Überspringen (externe Effekte), sehr leicht auch die Unternehmen des nicht finanziellen Sektors und die öffentlichen Haushalte in ihrer Tätigkeit schwerwiegend beeinflussen.1
Banken zwischen Regulierung und Laissez-faire
Die Vorherrschaft von Zentralbankverfassungen in unseren modernen Volkswirtschaften täuscht darüber hinweg, dass es auch grundsätzliche Alternativen hierzu gibt, wie wettbewerbliche Geldverfassungen in den sich entwickelnden Industriestaaten des 18. und 19. Jahrhunderts gezeigt haben. Die Diskussion über wettbewerbliche Geldverfassungen hat in den letzten 30 Jahren aus mehreren Gründen eine Renaissance erfahren. Gründe dafür sind Inflation und Konjunkturschwankungen und auch die Tatsache, dass sich Banken durch den technischen Fortschritt vermehrt mit kreativen Handlungen der Wirtschaftssubjekte konfrontiert sehen, die die Erscheinungsform (Netzgeld, cyber-cash, digital-cash) des Geldes stark verändern. Dies führt zu einer steigenden Komplexität des Geldangebots- und –nachfrageprozesses in modernen Gesellschaften, wodurch ohne weiteres Zutun der Zentralbank neues Geld geschaffen werden kann. Als Folge ergibt sich, dass die Notenbank die Kontrolle über den volkswirtschaftlichen Zahlungsmittelumlauf2 verliert, wodurch die Steuerung des Geldangebotsprozesses zunehmend schwierig, vielleicht schlichtweg unmöglich wird.3
---
1 vgl. Bitz (2003), in: Bankbetriebslehre/Bank- und Börsenwesen, Institutionelle Grundlagen des Bank- und Finanzwesens, S. 70.
2 Außengeld (outside money) wird in monopolistischen Währungsordnungen von der Zentralbank produziert. Instrumente dafür sind einerseits der Ankauf von staatlichen Wertpapieren, die sich in der Hand von privaten Wirtschaftssubjekten befinden und andererseits der Ankauf von Devisen. Das Innengeld (inside money) wird dagegen von Finanzintermediären, in der Regel Geschäftsbanken, produziert. Einer Geldproduktion (z.B. Sichtguthaben) steht hier eine gleich große Zunahme der privaten Verschuldung der Nichtbanken gegenüber; vgl. Prüßmann (2000), S. 141 – 142.
3 vgl. Geue (1999), S. 348.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Banken und ihre Sonderstellung in der Volkswirtschaft
- 1.2 Banken zwischen Regulierung und Laissez-faire
- 1.3 Zielsetzung der Arbeit
- 2. Theorien des Laissez-faire-Banking
- 2.1 Laissez-faire-Banking als heterogenes Forschungsgebiet
- 2.2 Systematisierungsansätze der Laissez-faire-Theorien
- 2.3 Free-Banking
- 2.3.1 Die Theorie des Free-Banking
- 2.3.2 Analyse des Free-Banking auf Grund der festgelegten Systematisierungsansätze
- 2.3.3 Kritik an der Free-Banking Theorie
- 2.3.4 Erfahrungen mit Free-Banking aus Schottland
- 2.4 Die Theorie des Wettbewerbs unterscheidbarer Währungen
- 2.4.1 Beschreibung des theoretischen Ansatzes
- 2.4.2 Analyse des Wettbewerbs der Währungen auf Grund der festgelegten Systematisierungsansätze
- 2.4.3 Kritik an der Theorie des Wettbewerbs der Währungen
- 2.5 New Monetary Economics - das BFH-System
- 2.5.1 Beschreibung des theoretischen Ansatzes
- 2.5.2 Analyse auf Grund der festgelegten Systematisierungskriterien
- 2.5.3 Kritik an der Theorie des New Monetary Economics
- 3. Banken als Untersuchungsgegenstand von Laissez-faire-Ansätzen
- 3.1 Bankleistungen in der realen Ordnung
- 3.2 Bankleistungen in der Modellwelt des Laissez-faire-Banking
- 4. Zusammenfassung und kritische Analyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Banken unter Laissez-faire-Ansätzen und analysiert verschiedene Theorien wettbewerblicher Geldverfassungen als Alternative zu zentralisierten Systemen. Das Hauptziel besteht darin, die Funktionsweise und die Vor- und Nachteile solcher Systeme zu beleuchten.
- Analyse verschiedener Laissez-faire-Banking-Theorien
- Untersuchung der Rolle von Banken in realen und modellhaften Wirtschaftssystemen
- Bewertung der Stabilität und Effizienz wettbewerblicher Geldverfassungen
- Kritik an staatlichen Interventionen in die Geldordnung
- Beurteilung der Bedeutung institutioneller Rahmenbedingungen für erfolgreiche wettbewerbliche Geldangebote
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses einführende Kapitel etabliert die zentrale Rolle von Banken in modernen Volkswirtschaften und deren enge Verflechtung mit allen Wirtschaftssektoren. Es hebt die Bedeutung von Störungen im Bankensektor hervor und deren weitreichende Folgen für Unternehmen und öffentliche Haushalte. Weiterhin wird der Gegensatz zwischen der vorherrschenden Zentralbankverfassung und alternativen wettbewerblichen Modellen diskutiert, insbesondere im Kontext von Inflation, Konjunkturschwankungen und dem technologischen Wandel im Zahlungsverkehr. Die Arbeit zielt auf eine Analyse von Banken unter Laissez-faire-Ansätzen ab, wobei die drei wichtigsten Theorien im Detail untersucht werden.
2. Theorien des Laissez-faire-Banking: Dieses Kapitel widmet sich der heterogenen Gruppe von Laissez-faire-Banking-Theorien, die sich gegen staatliche Interventionen in die Geldordnung wenden. Es werden systematische Ansätze zur Klassifizierung dieser Theorien vorgestellt, die sich auf den freien Wettbewerb von Währungen, die Abschaffung der Zentralbank und die Gestaltung institutioneller Rahmenbedingungen konzentrieren. Die Bedeutung stabiler institutioneller Arrangements für den Erfolg wettbewerblicher Geldsysteme wird betont.
3. Banken als Untersuchungsgegenstand von Laissez-faire-Ansätzen: Dieses Kapitel untersucht die Funktionen und Leistungen von Banken sowohl in der realen Wirtschaftsordnung als auch in einem modellhaften Laissez-faire-Banking-System. Es vergleicht die Rolle von Banken unter den verschiedenen regulatorischen Rahmenbedingungen und analysiert die Auswirkungen auf die Stabilität und Effizienz des Finanzsystems. Der Fokus liegt auf einem Vergleich zwischen Realität und Theorie.
Schlüsselwörter
Laissez-faire-Banking, Wettbewerbliche Geldverfassungen, Free-Banking, Zentralbank, Geldordnung, Währungspolitik, Bankenstabilität, Inflation, Konjunktur, institutionelle Rahmenbedingungen, Wettbewerbsordnung, Geldangebot, Transaktionskosten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Laissez-faire-Banking und Banken im Wettbewerb
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Banken unter dem Aspekt des Laissez-faire-Ansatzes und analysiert verschiedene Theorien wettbewerblicher Geldverfassungen als Alternative zu zentralisierten Systemen. Das Hauptziel ist die Beleuchtung der Funktionsweise und der Vor- und Nachteile solcher Systeme.
Welche Theorien des Laissez-faire-Banking werden behandelt?
Die Arbeit analysiert verschiedene Laissez-faire-Banking-Theorien, die sich gegen staatliche Interventionen in die Geldordnung wenden. Im Detail werden Free-Banking, die Theorie des Wettbewerbs unterscheidbarer Währungen und das BFH-System (New Monetary Economics) untersucht und systematisch verglichen.
Wie werden die Theorien des Laissez-faire-Banking systematisiert?
Die Arbeit präsentiert systematische Ansätze zur Klassifizierung der Laissez-faire-Theorien. Diese Ansätze konzentrieren sich auf den freien Wettbewerb von Währungen, die Abschaffung der Zentralbank und die Gestaltung institutioneller Rahmenbedingungen.
Welche Rolle spielen Banken in den untersuchten Modellen?
Die Arbeit untersucht die Funktionen und Leistungen von Banken sowohl in der realen Wirtschaftsordnung als auch in modellhaften Laissez-faire-Banking-Systemen. Es wird ein Vergleich der Rolle von Banken unter verschiedenen regulatorischen Rahmenbedingungen vorgenommen, mit Analyse der Auswirkungen auf die Stabilität und Effizienz des Finanzsystems.
Welche Kritikpunkte werden an den Laissez-faire-Ansätzen geäußert?
Die Arbeit beinhaltet eine kritische Analyse der verschiedenen Laissez-faire-Banking-Theorien, einschließlich Kritik an den jeweiligen theoretischen Ansätzen und einer Bewertung ihrer praktischen Umsetzbarkeit und möglicher Risiken.
Welche Bedeutung haben institutionelle Rahmenbedingungen?
Die Arbeit betont die Bedeutung stabiler institutioneller Arrangements für den Erfolg wettbewerblicher Geldsysteme. Die Auswirkungen unterschiedlicher institutioneller Rahmenbedingungen auf die Stabilität und Effizienz des Finanzsystems werden analysiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Laissez-faire-Banking, Wettbewerbliche Geldverfassungen, Free-Banking, Zentralbank, Geldordnung, Währungspolitik, Bankenstabilität, Inflation, Konjunktur, institutionelle Rahmenbedingungen, Wettbewerbsordnung, Geldangebot, Transaktionskosten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Theorien des Laissez-faire-Banking (mit Unterkapiteln zu Free-Banking, Wettbewerb unterscheidbarer Währungen und New Monetary Economics), ein Kapitel zu Banken als Untersuchungsgegenstand von Laissez-faire-Ansätzen und abschließend eine Zusammenfassung und kritische Analyse.
Wie wird die Rolle der Zentralbank bewertet?
Die Arbeit diskutiert den Gegensatz zwischen der vorherrschenden Zentralbankverfassung und alternativen wettbewerblichen Modellen, insbesondere im Kontext von Inflation, Konjunkturschwankungen und dem technologischen Wandel im Zahlungsverkehr. Es wird eine kritische Auseinandersetzung mit staatlichen Interventionen in die Geldordnung geführt.
- Arbeit zitieren
- Bernhard Donleitner (Autor:in), 2004, Banken als Untersuchungsgegenstand von Laissez-faire-Ansätzen - Systematisierung und kritische Analyse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51639