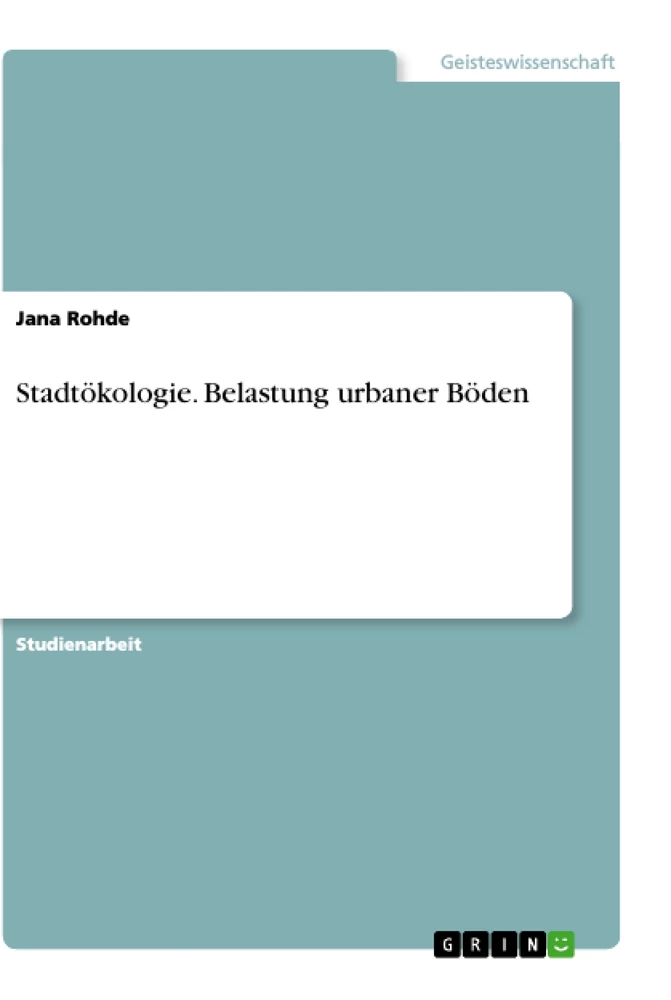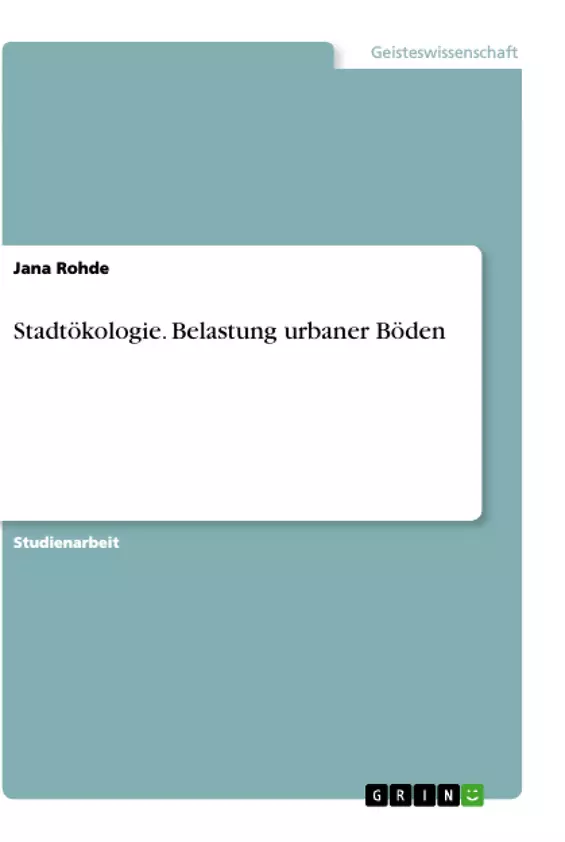Diese Arbeit untersucht, welche Maßnahmen getroffen werden können, um starke Belastung des Ökosystems Boden zu vermeiden und die Erhaltung der natürlichen Energie- und Stoffhaushalte zu gewährleisten. Um diese Frage beantworten zu können, werden zunächst die Hintergründe zur Entstehung der urbanen Böden näher betrachtet. Daraufhin werden die Eigenschaften urbaner Böden thematisiert. In diesem Abschnitt soll es folglich darum gehen, wie der urbane Boden zu charakterisieren ist und welche Besonderheiten er im Gegensatz zu natürlichen oder landwirtschaftlich genutzten Böden aufweist. Im darauf folgenden Abschnitt werden die städtischen Böden klassifiziert. Um auf die Leitfrage zurückzukommen, wird im Anschluss betrachtet, welche Belastung die urbanen Böden durch menschliche Eingriffe erfahren und welche Maßnahmen getroffen werden, um die Belastungen des Bodens abzudämmen.
In der Wirtschaft spielt der Boden eine entscheidende Rolle. Neben den Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital bietet er Unternehmen eine Grundlage zur Produktion. Vor allem in der heutigen Zeit in der die Industrie eine signifikante Rolle für die Wirtschaft eines Landes spielt, bekommt der Boden als Produktionsfaktor mehr Bedeutung zugesprochen. Jedoch stellt er viel mehr dar, als lediglich einen Produktionsfaktor. Er ist Lebens- und Erholungsraum. Um diesen bereitstellen zu können sind anthropogene Eingriffe in das Ökosystem nötig, welche den Boden belasten und den Energie- und Stoffhaushalt negativ beeinflussen. Das Konsumverhalten und die Lebensgewohnheiten des Menschen führen dazu, dass besonders in dicht bevölkerten Siedlungen der Boden an Heterogenität gewinnt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergründe zur Entstehung von urbanen Böden
- Urbane Böden
- Eigenschaften urbaner Böden
- Klassifikation urbaner Böden
- Belastung der Stadtböden und die Veränderung ihrer Funktionen
- Bodenschutzgesetz
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Eigenschaften urbaner Böden, ihre Belastung durch menschliche Aktivitäten und mögliche Schutzmaßnahmen. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen, die die spezifischen Bedingungen des urbanen Raums für die Bodenökologie darstellen.
- Entwicklung und Charakteristika urbaner Böden im Vergleich zu natürlichen Böden
- Bedeutung des Bodens als Produktionsfaktor und Lebensraum
- Einfluß von anthropogenen Eingriffen auf die Bodenfunktionen
- Schutzmaßnahmen und Strategien zur Erhaltung der Bodenqualität in städtischen Gebieten
- Relevanz des Bodenschutzes für die nachhaltige Stadtentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der urbanen Böden ein und erläutert deren Bedeutung als Produktionsfaktor und Lebensraum. Sie stellt die Herausforderungen für die Bodenökologie im Kontext des urbanen Raums dar.
Im zweiten Kapitel werden die Hintergründe zur Entstehung urbaner Böden beleuchtet. Die Industrialisierung und Suburbanisierung haben zu einer starken Beanspruchung und Verschlechterung von Böden geführt. Die Bebauung neuer Flächen und die damit verbundene Veränderung der Bodennutzung führten zur Bildung urbaner Böden.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Eigenschaften und der Klassifikation urbaner Böden. Die heterogene Struktur, die durch anthropogene Eingriffe entsteht, führt zu einer hohen Variabilität der Bodenbeschaffenheit. Die Kapitel beleuchtet auch die Belastung urbaner Böden durch menschliche Aktivitäten und die Veränderungen ihrer Funktionen.
Schlüsselwörter
Urbane Böden, Stadtökologie, Bodenfunktionen, Bodenbelastung, Bodenschutz, nachhaltige Stadtentwicklung, anthropogene Eingriffe, Industrialisierung, Suburbanisierung, Bodendegradation, Bodenklassifikation.
Häufig gestellte Fragen
Was sind urbane Böden?
Urbane Böden sind Böden in Städten und Siedlungsgebieten, die durch menschliche Aktivitäten (Bebauung, Versiegelung, Auftragung von Fremdstoffen) stark verändert wurden.
Welche Funktionen erfüllen Böden in der Stadt?
Sie dienen als Baugrund, Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Filter für das Grundwasser, Klimaregulator und als Erholungsraum für den Menschen.
Wie werden Stadtböden belastet?
Belastungen entstehen durch Bodenversiegelung, Schadstoffeinträge aus Industrie und Verkehr, Verdichtung durch Baumaßnahmen und die Einbringung von anthropogenem Material (Schutt, Abfall).
Was regelt das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)?
Das Gesetz dient dazu, die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen, schädliche Bodenveränderungen abzuwehren und Altlasten zu sanieren.
Warum ist Bodenversiegelung problematisch?
Versiegelte Flächen können kein Wasser mehr aufnehmen, was das Risiko von Überschwemmungen erhöht, das Stadtklima aufheizt und den natürlichen Stoffkreislauf unterbricht.
- Arbeit zitieren
- Jana Rohde (Autor:in), 2017, Stadtökologie. Belastung urbaner Böden, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/516588