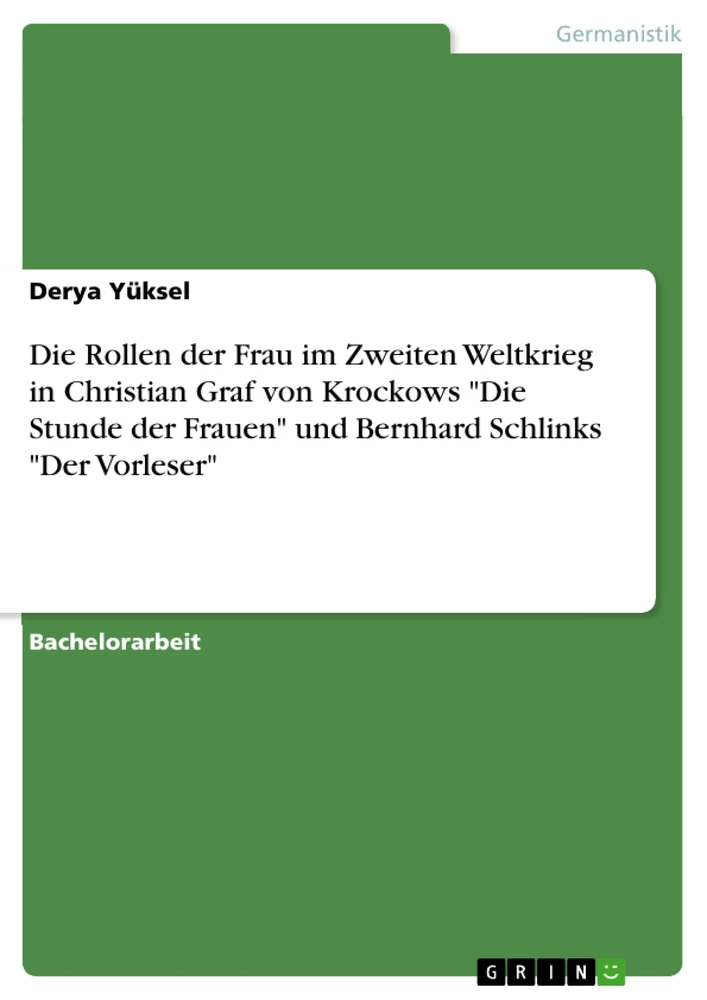In der Arbeit werden die Rolle der Frau im Zweiten Weltkrieg und ihre Darstellung in der Literatur beleuchtet. Hierfür werden zwei Werke betrachtet, die ein entgegengesetztes Bild der Rolle der Frau im Zweiten Weltkrieg porträtieren, aber gemein haben, dass sie die Frau als Subjekt und nicht als Objekt darstellen.
Um ein differenziertes Bild der Protagonistinnen zeichnen zu können, gilt es zunächst historisch zu erörtern, welche Rolle die Frau in der Zeit zwischen 1939 und 1945 gesamtgesellschaftlich spielte, um im Anschluss zu skizzieren, wie sich diese in der Literatur im Allgemeinen widerspiegelt. Anknüpfend werden die Werke "Die Stunde der Frauen. Ein Bericht aus Pommern 1944 bis 1947" von Christian Graf von Krockow und "Der Vorleser" von Bernhard Schlink inhaltlich vorgestellt und die Rollen ihrer Protagonistinnen ergründet.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dem interpretatorisch-analytischen Vergleich der beiden Werke. Hierbei gilt es insbesondere zu hinterfragen, was dazu geführt hat, dass die Frauen in ihrer individuellen Situation die Rolle einnehmen, die ihnen im Rahmen des jeweiligen Werkes zuteilwird. Es soll erörtert werden, ob sie selbstbestimmt agieren oder ob sie sich lediglich den äußeren Umständen anpassen und auf diese reagieren. Auch die Frage, weshalb sich die Protagonistinnen entscheiden, diametrale Wege einzuschlagen, gilt es zu analysieren. Ändert der Krieg ihre Maximen und ihr Wesen oder bleiben sie sich trotz der Widrigkeiten des Zweiten Weltkrieges treu?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Rolle der Frau zwischen 1939 und 1945
- 2.1 Das nationalsozialistische Frauenbild
- 2.2 Die Rolle der Ehefrau und Mutter im Nationalsozialismus
- 2.3 Die Berufstätigkeit der Frauen
- 3 Allgemeine Darstellung der Frau in der Literatur zum 2. WK.
- 3.1 Frauen als Opfer des Nationalsozialismus
- 3.2 Frauen als Kriegsbeute
- 3.3 Frauen als NS-Verbrecherinnen
- 4 Christian Graf von Krockow: Die Stunde der Frauen
- 4.1 Der Inhalt
- 4.2 Die Rolle der Frau
- 5 Bernhard Schlink: Der Vorleser
- 5.1 Der Inhalt
- 5.2 Die Rolle der Frau
- 6 Analytisch-interpretatorischer Vergleich der beiden Werke in Hinblick auf die Rolle der Frau im Zweiten Weltkrieg
- 7 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die vielschichtigen Rollen von Frauen im Zweiten Weltkrieg, indem sie einen vergleichenden Blick auf die literarische Darstellung in Christian Graf von Krockows "Die Stunde der Frauen" und Bernhard Schlinks "Der Vorleser" wirft. Ziel ist es, die oft einseitige Sichtweise auf Frauen im Kontext des Krieges zu überwinden und die Bandbreite ihrer Erfahrungen und Handlungen aufzuzeigen.
- Die gesellschaftliche Rolle der Frau im Nationalsozialismus
- Die literarische Darstellung von Frauen im Zweiten Weltkrieg
- Vergleichende Analyse der weiblichen Protagonistinnen in "Die Stunde der Frauen" und "Der Vorleser"
- Die Ambivalenz der weiblichen Rollen: Opfer, Täterin, Widerstandskämpferin
- Selbstbestimmung vs. Anpassung an die Umstände im Kontext des Krieges
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der vielschichtigen Rollen von Frauen im Zweiten Weltkrieg ein und begründet die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise, die über die gängigen Klischees von Opfer- oder Täterrolle hinausgeht. Sie kritisiert die einseitige Fokussierung auf männliche Perspektiven in der bisherigen Kriegsliteratur und kündigt die vergleichende Analyse von "Die Stunde der Frauen" und "Der Vorleser" an, um ein differenzierteres Bild der weiblichen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg zu zeichnen.
2 Die Rolle der Frau zwischen 1939 und 1945: Dieses Kapitel beleuchtet die gesellschaftliche Rolle der Frau im Nationalsozialismus, von der idealisierten Mutter und Ehefrau bis hin zur berufstätigen Frau in verschiedenen Bereichen. Es diskutiert die widersprüchlichen Erwartungen und die Belastungen, denen Frauen ausgesetzt waren, sowie die zunehmende weibliche Beteiligung an der Kriegswirtschaft und im militärischen Kontext. Die Darstellung des weiblichen Opfermythos und seine spätere Revision im Hinblick auf die Mitläufer- und Täterinnenschaft werden ebenfalls thematisiert.
3 Allgemeine Darstellung der Frau in der Literatur zum 2. WK.: Dieses Kapitel skizziert die gängigen literarischen Darstellungen von Frauen im Zweiten Weltkrieg, von den Opfern des NS-Regimes bis hin zu den Frauen, die als Kriegsbeute oder gar als NS-Verbrecherinnen fungierten. Es wird deutlich, dass die bestehenden literarischen Werke oft vereinfachte oder einseitige Perspektiven bieten und die Komplexität der weiblichen Rollen im Krieg unzureichend repräsentieren.
4 Christian Graf von Krockow: Die Stunde der Frauen: Die Zusammenfassung dieses Kapitels befasst sich mit dem Inhalt und der zentralen Rolle der weiblichen Protagonistin in Krockows Roman. Es wird untersucht, wie die Figur von Libussa Fritz Krockow die Herausforderungen des Krieges und der Nachkriegszeit meistert und wie ihre Handlungen die vielfältigen Aspekte weiblicher Widerstandsfähigkeit und Überlebensstrategien aufzeigen. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Mut, Courage und der Fähigkeit, in extremen Situationen zu überleben und anderen zu helfen.
5 Bernhard Schlink: Der Vorleser: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der weiblichen Hauptfigur in Schlinks "Der Vorleser". Es wird erörtert, wie Hanna Schmitz' Vergangenheit als KZ-Aufseherin ihre Gegenwart prägt und welche Auswirkungen ihre Taten auf die Erzählperspektive und die gesamte Handlung des Romans haben. Die Zusammenfassung verdeutlicht die Ambivalenz der Figur und die Frage nach Schuld, Verantwortung und dem Umgang mit der Vergangenheit.
Schlüsselwörter
Zweiter Weltkrieg, Frauenrolle, Nationalsozialismus, Literaturvergleich, Christian Graf von Krockow, Bernhard Schlink, "Die Stunde der Frauen", "Der Vorleser", Opfer, Täterin, Widerstand, Selbstbestimmung, Kriegsliteratur, feministische Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Frauenrolle im Zweiten Weltkrieg in "Die Stunde der Frauen" und "Der Vorleser"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die vielschichtigen Rollen von Frauen im Zweiten Weltkrieg anhand eines literaturwissenschaftlichen Vergleichs von Christian Graf von Krockows "Die Stunde der Frauen" und Bernhard Schlinks "Der Vorleser". Sie geht über die gängigen Klischees von Opfer- oder Täterrolle hinaus und beleuchtet die Bandbreite der weiblichen Erfahrungen und Handlungen im Kontext des Krieges.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die oft einseitige Sichtweise auf Frauen im Zweiten Weltkrieg zu überwinden und ein differenzierteres Bild ihrer Erfahrungen und Handlungen aufzuzeigen. Sie untersucht die gesellschaftliche Rolle der Frau im Nationalsozialismus und vergleicht die literarische Darstellung der weiblichen Protagonistinnen in den beiden Romanen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die gesellschaftliche Rolle der Frau im Nationalsozialismus, die literarische Darstellung von Frauen im Zweiten Weltkrieg, einen vergleichenden Analyse der weiblichen Protagonistinnen in "Die Stunde der Frauen" und "Der Vorleser", die Ambivalenz der weiblichen Rollen (Opfer, Täterin, Widerstandskämpferin) und den Gegensatz zwischen Selbstbestimmung und Anpassung an die Umstände des Krieges.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die Rolle der Frau zwischen 1939 und 1945, Allgemeine Darstellung der Frau in der Literatur zum 2. Weltkrieg, Christian Graf von Krockow: Die Stunde der Frauen, Bernhard Schlink: Der Vorleser, Analytisch-interpretatorischer Vergleich der beiden Werke, und Resümee.
Wie wird die Rolle der Frau im Nationalsozialismus dargestellt?
Das Kapitel "Die Rolle der Frau zwischen 1939 und 1945" beleuchtet die idealisierte Rolle der Mutter und Ehefrau, aber auch die berufstätige Frau im Nationalsozialismus. Es thematisiert die widersprüchlichen Erwartungen und Belastungen, denen Frauen ausgesetzt waren, sowie ihre zunehmende Beteiligung an der Kriegswirtschaft und im Militär. Der weibliche Opfermythos und seine Revision im Hinblick auf Mitläufer- und Täterinnenschaft werden diskutiert.
Wie werden Frauen in der Literatur zum Zweiten Weltkrieg dargestellt?
Das Kapitel "Allgemeine Darstellung der Frau in der Literatur zum 2. Weltkrieg" zeigt die gängigen literarischen Darstellungen von Frauen als Opfer, Kriegsbeute oder NS-Verbrecherinnen auf. Es kritisiert die oft vereinfachten und einseitigen Perspektiven und betont die unzureichende Repräsentation der Komplexität der weiblichen Rollen im Krieg.
Wie werden die Romane "Die Stunde der Frauen" und "Der Vorleser" analysiert?
Die Kapitel zu "Die Stunde der Frauen" und "Der Vorleser" analysieren jeweils die Rolle der weiblichen Protagonistin. Bei Krockow wird die Widerstandsfähigkeit und Überlebensstrategie der Figur beleuchtet, während bei Schlink die Ambivalenz von Hanna Schmitz und die Frage nach Schuld, Verantwortung und dem Umgang mit der Vergangenheit im Mittelpunkt stehen. Ein separates Kapitel vergleicht beide Romane hinsichtlich der Darstellung der Frauenrolle im Zweiten Weltkrieg.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zweiter Weltkrieg, Frauenrolle, Nationalsozialismus, Literaturvergleich, Christian Graf von Krockow, Bernhard Schlink, "Die Stunde der Frauen", "Der Vorleser", Opfer, Täterin, Widerstand, Selbstbestimmung, Kriegsliteratur, feministische Literaturwissenschaft.
- Quote paper
- Derya Yüksel (Author), 2019, Die Rollen der Frau im Zweiten Weltkrieg in Christian Graf von Krockows "Die Stunde der Frauen" und Bernhard Schlinks "Der Vorleser", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/516726