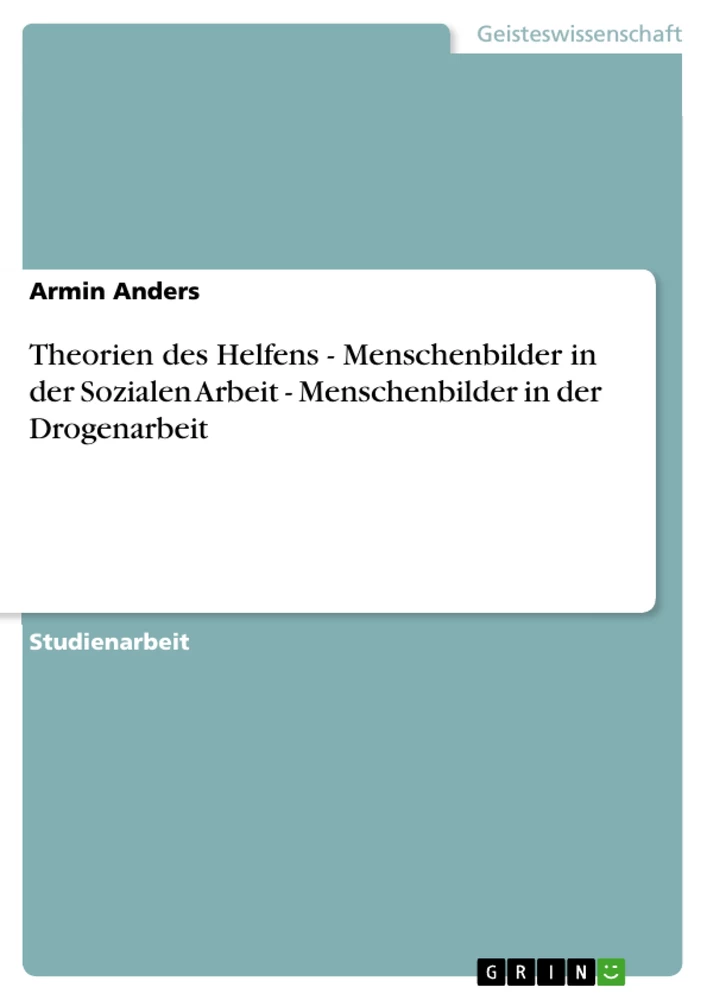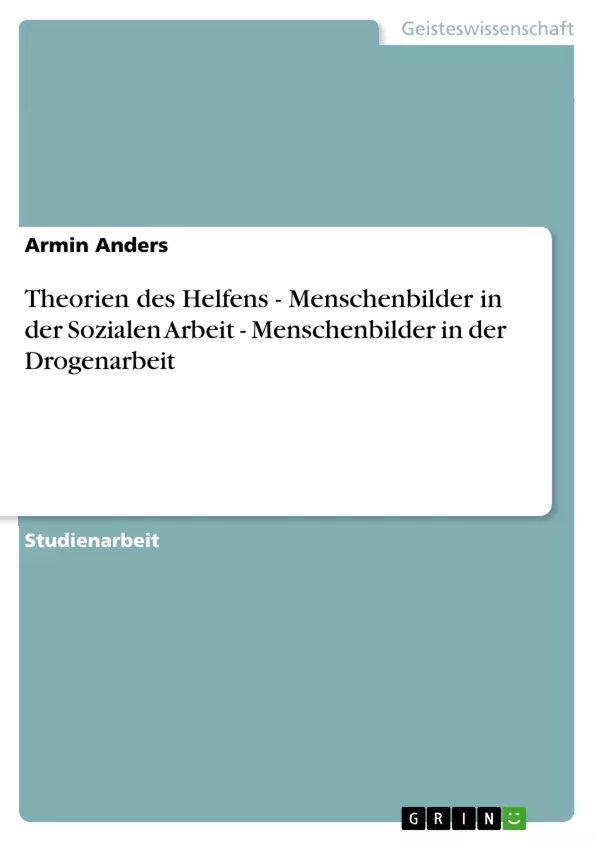Einleitung
Die Menschenbilder, die in der sozialen Arbeit, so wie in der Gesellschaft vorherrschen, sind recht unterschiedlich und meist eher negativ besetzt. Vielen Menschen in der Gesellschaft fehlt oft das Fachwissen, welches nötig ist, um eine Verbindung zwischen den Lebenslagen, der Suchterkrankung sowie deren Ursachen und dem häufigen delinquenten Verhalten der Drogenabhängigen herzustellen. Das Ergebnis, dass oft durch die Medien Medien beeinflusst wird, ist meist ein negatives Menschenbild. In der sozialen Arbeit ist dieses negative Menschenbild, wenn auch nicht so extrem und unreflektiert doch in einem gewissen Maß vorhanden.
Der als Grundlage dienende Vortrag von Hilarion Petzhold zum Thema „Menschenbilder als bestimmendes Moment von Grundhaltungen und Konzepten in der Drogenhilfe“ bei dem 14. Drogenkongress des Fachverbandes Drogen und Rauschmittel e.V. 1991 in Braunschweig dient ebenso wie dem Referat als Grundlage der folgenden schriftlichen Ausarbeitung. Zu Anfang der Ausarbeitung werden zentrale Punkte über vorhandene Menschenbilder und Konzepte in der Drogenarbeit des o.g. Textes herausgearbeitet und zusammengefasst. Im weiteren Teil wird versucht eigene Erfahrungen, die in den Praktischen Studiensemestern gesammelt wurden, mit besagtem Themenkomplex in Bezug zu setzen und zu erörtern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Menschenbilder und Zeitgeist
- Therapeutische Menschenbilder
- Die Quelle von Menschenbildern
- Über die wünschenswerte Pluralität von Menschenbildern
- Karrierebegleitung, eine anthropologisch fundierte klinische Perspektive
- Praxisbezug und Diskussion
- Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Problematik von Menschenbildern in der Drogenarbeit und analysiert die unterschiedlichen Ansätze, die in der Praxis Anwendung finden. Ziel ist es, die Entwicklung von Menschenbildern im Laufe der Zeit zu beleuchten, die Bedeutung von Zeitgeist und gesellschaftlichen Normen zu untersuchen und die Auswirkungen auf therapeutische Konzepte zu diskutieren.
- Entwicklung von Menschenbildern in der Drogenarbeit
- Einfluss von Zeitgeist und gesellschaftlichen Normen auf Menschenbilder
- Unterscheidung zwischen „hochschwelligen“ und „niedrigschwelligen“ Ansätzen
- Kritik an den jeweiligen Ansätzen und deren Auswirkungen
- Relevanz von Menschenbildern in der Gestaltung von therapeutischen Konzepten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der unterschiedlichen und oft negativen Menschenbilder in der Drogenarbeit dar. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Verbindung zwischen Lebenslagen, Suchterkrankungen und delinquenten Verhaltensweisen und zeigt die Problematik der medialen Prägung von Menschenbildern auf.
- Menschenbilder und Zeitgeist: Dieses Kapitel analysiert die beiden zentralen Ansätze in der Drogenarbeit, den „hochschwelligen“ und den „niedrigschwelligen“ Ansatz. Es beleuchtet die Entwicklung dieser Ansätze im Kontext des gesellschaftlichen Wandels und der Veränderung des Drogenkonsums.
- Therapeutische Menschenbilder: Hier wird der Zusammenhang zwischen therapeutischen Menschenbildern und dem Zeitgeist erörtert. Der Text beleuchtet die Bedeutung von Menschenbildern für die Definition von Handlungszielen in therapeutischen Konzepten und diskutiert die potenziellen Risiken von Ziel-Mittel-Divergenzen.
Schlüsselwörter
Menschenbilder, Drogenarbeit, Zeitgeist, „hochschwelliger“ Ansatz, „niedrigschwelliger“ Ansatz, therapeutische Konzepte, Normalität, Wertevorstellungen, Drogenpolitik, Ziel-Mittel-Divergenz.
Häufig gestellte Fragen
Welche Menschenbilder herrschen in der Drogenhilfe vor?
Es gibt oft negative Bilder, die Drogenabhängige primär durch Sucht und Delinquenz definieren, statt soziale Ursachen zu berücksichtigen.
Was ist der Unterschied zwischen hochschwelligen und niedrigschwelligen Ansätzen?
Hochschwellige Ansätze fordern oft Abstinenz als Voraussetzung, während niedrigschwellige Angebote (wie Kontaktläden) Hilfe ohne Vorbedingungen leisten.
Wie beeinflussen Medien das Bild von Drogenabhängigen?
Medien neigen zu einer einseitigen Darstellung von Elend und Kriminalität, was Vorurteile in der Gesellschaft verstärkt.
Welche Rolle spielt der Zeitgeist für therapeutische Konzepte?
Therapeutische Ziele spiegeln oft gesellschaftliche Normen wider, was dazu führen kann, dass Klienten an starre Idealbilder angepasst werden sollen.
Was ist eine "Ziel-Mittel-Divergenz" in der sozialen Arbeit?
Es beschreibt den Widerspruch, wenn die angewandten Methoden nicht geeignet sind, die gesetzten pädagogischen Ziele tatsächlich zu erreichen.
- Citar trabajo
- Armin Anders (Autor), 2005, Theorien des Helfens - Menschenbilder in der Sozialen Arbeit - Menschenbilder in der Drogenarbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51673