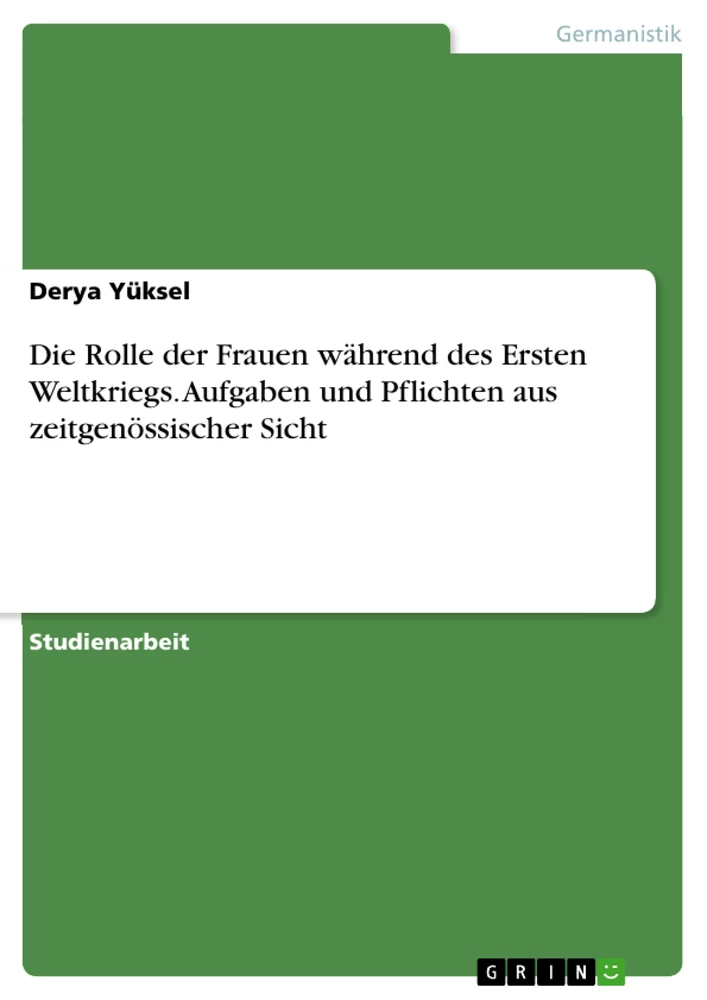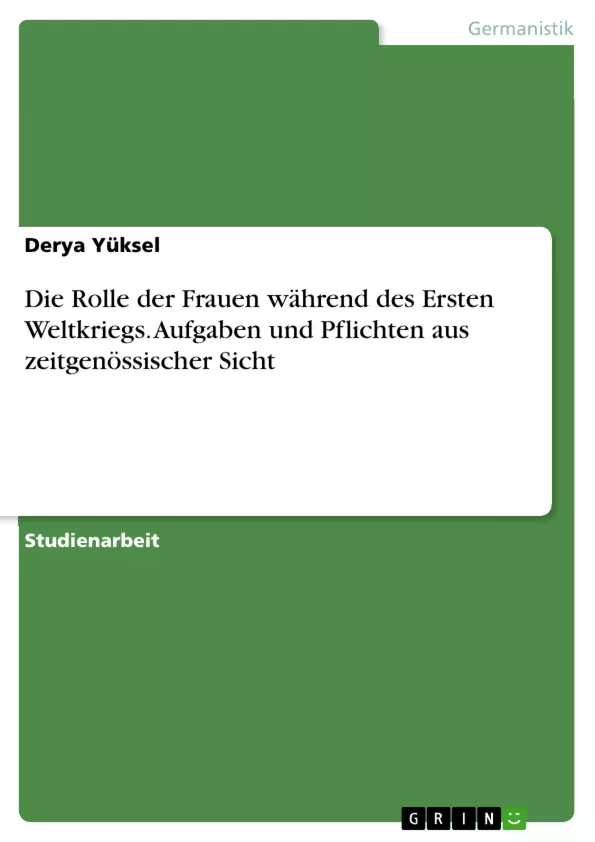In dieser Hausarbeit wird im Wesentlichen nach der fiktiven weiblichen Rolle in der Gesellschaft während des Ersten Weltkrieges gefragt und insbesondere nach den damit einhergehenden Pflichten und Aufgaben der Frauen. Das als Zentralpflicht geltende Opfern der Frauen soll anhand von Harbous und Seidels literarischen Werken gegenübergestellt werden. Darauf aufbauend soll ein Vergleich zwischen drei differenten Werken hinsichtlich des Krieges und des zeitgenössischen Bildes der Frau im zwanzigsten Jahrhundert stattfinden.
Der Erste Weltkrieg (1914–1918) war der erste industriell geführte Massenkrieg und der größte, den die Menschheitsgeschichte je erlebt hatte. In keinem Krieg zuvor kämpften Nationen mit solch imposanten Armeen gegeneinander und noch nie wurde die Gesellschaft so immediat in den Verlauf des Krieges eingeschlossen.
Laut dem Literaturkritiker Julius Bab gingen schon während der ersten Woche des Ersten Weltkrieges mehr als 50.000 Gedichte pro Tag in den Redaktionen von Zeitungen und Zeitschriften ein. Der Erste Weltkrieg zählt durch Feldpostbriefe, Tagebücher, Frontkampfgeschichten, Romane, Kriegslyrik, Heeresberichte et cetera zu den kulturgeschichtlich am stärksten manifestierten Geschehnissen des zwanzigsten Jahrhunderts. Viele Frauen, die an Kriegsgeschehen beteiligt waren, nutzten diese Formen, um ihre Kriegseindrücke zu reflektieren, die vor allem patriotisch und nationalistisch ausgerichtet waren.
Sowohl die britische Schriftstellerin Jessie Pope als auch die deutschen Autorinnen Thea von Harbou und Ina Seidel veröffentlichten nicht nur zeitgenössische patriotische Literatur zu Propagandazwecken über den Ersten Weltkrieg, sondern richteten den Fokus in ihren Werken auf den Krieg, die Positionen der "vergessenen" Frauen und deren Pflichten und Opferungen gegenüber dem Vaterland.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Krieg in Thea von Harbous Novelle Der Krieg und die Frauen.
- Die Rolle der Frau in Der Krieg und die Frauen.
- Die Mutterrolle in U114.
- Der Opfertopos in U114.
- Der Opfertopos in Die Klage der Mädchen
- Jessie Popes Kriegsverständnis
- Die Rolle der Frau in War Girls.
- Gegenüberstellungen
- Kriegsverständnis Harbous und Popes.
- Opfertopos in U 114 und Die Klage der Mädchen.
- Die Rolle der Frau bei Harbou und Pope.
- Schlussbetrachtung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Rolle der Frauen im Ersten Weltkrieg anhand ausgewählter literarischer Werke von Thea von Harbou, Jessie Pope und Ina Seidel. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung des Kriegsverständnisses, der Opferrolle und der gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen in dieser Zeit.
- Kriegsverständnis im Ersten Weltkrieg
- Darstellung der Opferrolle von Frauen
- Zeitgenössisches Frauenbild und dessen Veränderungen
- Nationale und patriotische Ideale in der Literatur
- Vergleichende Analyse der Werke von Harbou, Pope und Seidel
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Ersten Weltkriegs und die Bedeutung von Literatur in dieser Zeit ein. Sie stellt Thea von Harbou, Jessie Pope und Ina Seidel als zentrale Figuren der Untersuchung vor.
- Der Krieg in Thea von Harbous Novelle Der Krieg und die Frauen: Dieses Kapitel analysiert die Novellensammlung Der Krieg und die Frauen von Thea von Harbou und untersucht die von ihr dargestellten Kriegsbilder. Es wird auf Harbous Sichtweise auf den Krieg als eine „[S]chicksalsgewaltige“ und unaufhaltsame Kraft eingegangen.
- Die Rolle der Frau in Der Krieg und die Frauen: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung der Frauenrolle in Harbous Novellen. Die Rolle von Frauen im Krieg und die Erwartungen an sie werden beleuchtet.
- Die Mutterrolle in U114: Dieses Kapitel untersucht die Darstellung der Mutterrolle in der Novelle U114, einem Teil der Sammlung Der Krieg und die Frauen.
- Der Opfertopos in U114: Dieses Kapitel widmet sich dem Opfertopos in Harbous Novelle U114 und der Darstellung des Leidens von Frauen im Krieg.
- Der Opfertopos in Die Klage der Mädchen: Dieses Kapitel analysiert den Opfertopos in Ina Seidels Gedicht Die Klage der Mädchen und vergleicht ihn mit den Darstellungen in U114.
- Jessie Popes Kriegsverständnis: Dieses Kapitel beleuchtet Jessie Popes patriotische Kriegslyrik und untersucht deren Zielsetzung.
- Die Rolle der Frau in War Girls: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung der Frauenrolle in Jessie Popes Gedicht War Girls.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf Schlüsselwörter wie Krieg, Frauen, Opfer, Patriotismus, Nationalismus, Propaganda, Literatur und die Werke von Thea von Harbou, Jessie Pope und Ina Seidel.
- Arbeit zitieren
- Derya Yüksel (Autor:in), 2018, Die Rolle der Frauen während des Ersten Weltkriegs. Aufgaben und Pflichten aus zeitgenössischer Sicht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/516744