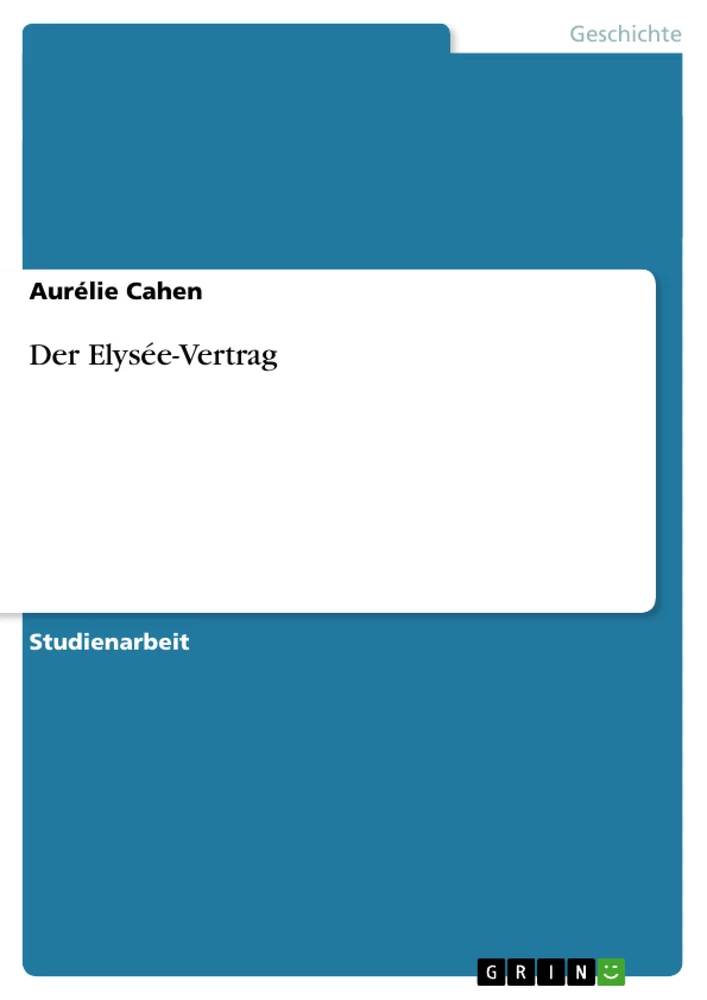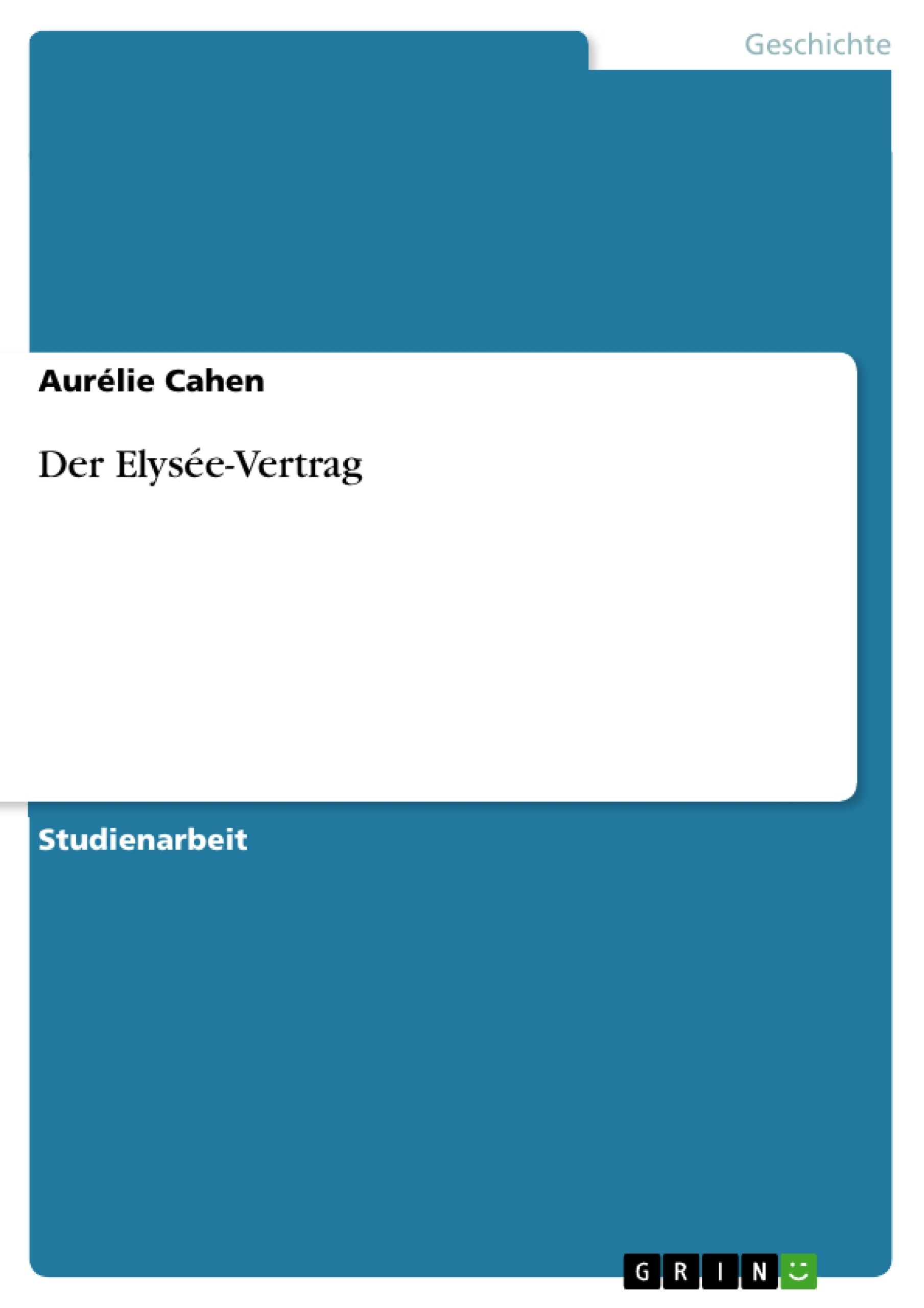I. Einleitung
Die Geschichte der deutsch - französischen Beziehungen ist geprägt von Gegensätzen.
Die drei blutigen Kriege, in denen sich Frankreich und Deutschland in 70. Jahre bekämpften, führten zu einer außerordentlich negativen Beeinflussung des Bildes des jeweiligen Nachbarn und zur Entstehung der mehr als fragwürdige Legende der "Erbfeindschaft". Dennoch hat sich dieses Bild nach dem Zweiten Weltkrieg sehr schnell gewandelt. Frankreich und Deutschland entwickelten eine bevorzugte Partnerschaft und bereits zwanzig Jahre nach Ende des schrecklichen Krieges waren die beiden Völker unzertrennliche Verbündete geworden. Die früher für kaum möglich gehaltenen Aussöhnung vollzog sich innerhalb einer einzigen Generation. Die Geschichte bietet wenige Beispiele für einen derart raschen Wandel in der Beziehungen zweier Nationen. Die deutsch-französische Entente erscheint jedoch heute genauso selbstverständlich wie vor noch nicht allzu langer Zeit die deutsch-französische Feindschaft.
Der am 22. Januar 1963 im Paris unterzeichnete Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit, oft auch als "Elysée - Vertrag" oder "Freundschaftsvertrag" bezeichnet, wird allgemein als Symbol der Versöhnung beider Völker gefeiert. Er wird als das Werk zwei Männer, das General Charles de Gaulles und des Bundeskanzlers Konrad Adenauer, als selbstverständlicher Höhepunkt einer Freundschaft, die sich seit ihren erste Begegnung in Colombey-les-deux-Eglises immer verdichtet hatte, verstanden. Doch das Wohlwollen, mit dem der Vertrag heutzutage beurteilen wird, täuscht. Denn beim genaueren Hinsehen zeigt sich, daß jenes was von Willy Brandt zur Zeit seiner Kanzlerschaft gern als "entente élémentaire" gekennzeichnet worden ist, zur Zeit seine Unterzeichnung als anderes als eine Selbstverständlichkeit war. Es wird auch deutlich, daß es nicht der Sinn und Zweck des Vertrages war, einen Schlußstrich unter die Aussöhnung der beider Nationen zu setzten.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- II. AUSDRUCK DES WILLENS ZUR VERSÖHNUNG
- 1. ENTWICKLUNG VOR 1958
- 2. DIE BEGEGNUNG ZWEIER PERSÖNLICHKEITEN
- III. AUSDRUCK VERSCHIEDENE POLITISCHE INTERESSEN
- 1. VERSCHIEDENE AUBENPOLITISCHE ZIELE
- 2. VERSCHIEDENE VORSTELLUNGEN EUROPAS
- 3. DIE WELTPOLITISCHEN VERÄNDERUNGEN 1958-1962
- IV. DER TEXT
- 1. DIE ENTSTEHUNG
- 2. KRITIKEN
- 3. INHALT
- V. ERFOLGEN UND GRENZEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Elysée-Vertrag von 1963, ein Meilenstein in der deutsch-französischen Geschichte. Der Fokus liegt auf der Entstehung und dem Inhalt des Vertrags, der Bedeutung für die Versöhnung der beiden Nationen und seinen Einfluss auf den europäischen Integrationsprozess.
- Die Bedeutung des Elysée-Vertrags für die deutsch-französische Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg
- Die politischen und wirtschaftlichen Interessen, die zur Unterzeichnung des Vertrags führten
- Die Auswirkungen des Vertrags auf die europäische Integration und die Rolle der deutsch-französischen Achse
- Die Rezeption des Elysée-Vertrags in Deutschland und Frankreich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Elysée-Vertrag als Symbol der deutsch-französischen Versöhnung vor und gibt einen Überblick über die Entwicklung der Beziehungen beider Länder im 20. Jahrhundert. Das erste Kapitel beleuchtet die Entwicklung der deutsch-französischen Beziehungen in der Zeit vor 1958, wobei die französische Bestrebung, Deutschland zu schwächen, und die Entwicklung hin zu einer Verständigung im Kontext des Ost-West-Konflikts im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Elysée-Vertrag, deutsch-französische Beziehungen, Versöhnung, Integrationsprozess, europäische Politik, Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Willy Brandt, Geschichte Europas seit 1945, Entente élémentaire, deutsch-französische Achse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Elysée-Vertrag?
Der Elysée-Vertrag, auch Freundschaftsvertrag genannt, wurde am 22. Januar 1963 unterzeichnet und besiegelte die Zusammenarbeit und Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich.
Wer waren die Unterzeichner des Vertrags?
Der Vertrag wurde von Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Präsidenten Charles de Gaulle unterzeichnet.
Was bedeutete der Begriff „Erbfeindschaft“?
Es war eine Legende, die auf drei blutigen Kriegen innerhalb von 70 Jahren basierte und ein negatives Bild des jeweiligen Nachbarn zementierte. Der Vertrag half, diesen Mythos endgültig zu überwinden.
Welche politischen Ziele verfolgte der Vertrag?
Neben der Versöhnung ging es um die Abstimmung in der Außen-, Sicherheits- und Jugendpolitik sowie um die Festigung einer deutsch-französischen Achse innerhalb Europas.
War der Vertrag bei seiner Unterzeichnung unumstritten?
Nein, er war Ausdruck verschiedener politischer Interessen und Vorstellungen von Europa. Kritiker befürchteten etwa eine zu starke Abkehr von den USA oder eine Schwächung der NATO.
- Quote paper
- Aurélie Cahen (Author), 1997, Der Elysée-Vertrag, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5168