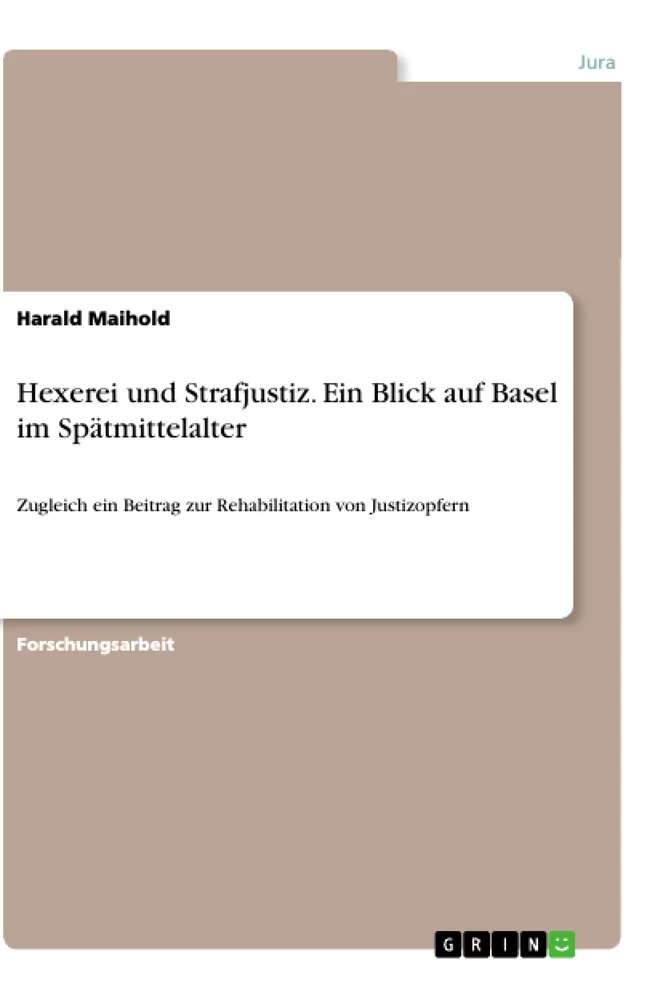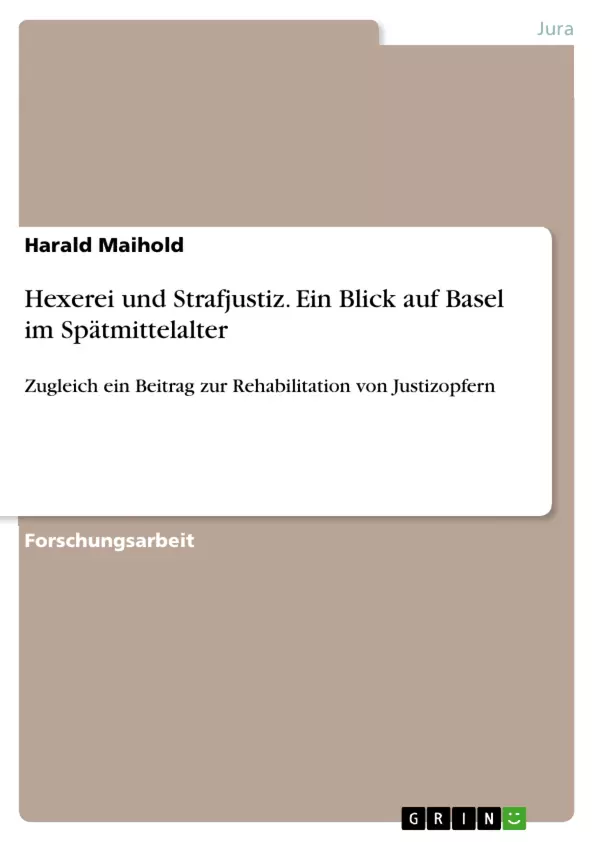Hexenprozesse sind ein aktuelles Thema. Nicht nur werden in vielen Ländern, etwa in den armen Regionen Indiens, Berichten von Menschenrechtsorganisationen zufolge auch in unseren Tagen Frauen wegen „Hexerei“ getötet. Auch in Mitteleuropa sehen sich die historische, politische und juristische Zunft immer wieder herausgefordert, zu dem Jahrhunderte zurückliegenden Geschehen Stellung zu beziehen. In der historischen Kriminalitätsforschung wird die Hexenverfolgung heute besonders intensiv untersucht.
Der 2013 entstandene Vortrag nimmt eine Basler Diskussion zum Anlass, die Zauberei- und Hexenprozesse in Basel im Hinblick auf den zugrunde gelegten Tatbestand und das angewendete Prozessrecht zu bewerten und die Rolle, die die Region Basel bei der Verbreitung der gelehrten Hexenlehre in der Frühphase der Entwicklung gespielt hat, aufzuzeigen. Dabei zeigt sich auch, welche Probleme eine juristische Aufarbeitung der Hexenprozesse mit dem Ziel der Rehabilitation der "Opfer" mit sich bringt.
Die juristische Debatte über Wahrheitsfindung vor Gericht erinnert an die Fehlentwicklungen in den Hexenverfolgungen, deren Wiederholung sie bei Schwerstverbrechen wie dem Terrorismus befürchtet. Und seit der Glarner Landtag im August 2008 die "letzte Schweizer Hexe" Anna Göldin rehabilitiert hat, ziehen andere Kantone und Stadtparlamente nach und prüfen, ob man die Hexenprozesse neu aufrollen muss.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- Zur Aktualität der Hexenprozesse
- Die „Gräfin“ von Riehen
- Hexerei – ein Phänomen des „Mittelalters“?
- II. Basler Strafjustiz im Spätmittelalter
- „auff daß die Liebe Justitien gebeürlichen administrirt werde“
- Das Strafverfahren
- III. Hexenprozesse als Massenphänomen?
- Zahlen und Zyklen
- Quellenlage für Basel
- Hexenprozesse in Basel - Überblick
- Das Hexenschema
- IV. Der Tatbestand der Hexerei
- „Vom Teufel erfundene böse Zauberei“
- Häretische Magie
- Basler Zaubereiprozesse
- Die Elemente des Hexereibegriffs
- Häretiker- und Hexensekten: Die Praxis im 15. Jahrhundert
- Die gelehrte Hexenlehre
- Der Hexenhammer
- Das Konzil von Basel
- Frühe Kritik: Johannes Weyer
- V. Prozessuale Bedingungen
- Zuständigkeit und Kontrolle
- Inquisitionsprozess
- Folter
- Die Lehre vom crimen exceptum und die Hexenproben
- Vergleich: Deutschland, England, Spanien
- VI. Zur Erklärung der Hexenprozesse
- VII. Rehabilitation von Hexen als Justizopfer?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Hexenprozesse in Basel im Spätmittelalter und strebt eine Rehabilitation der Opfer an. Sie analysiert die Basler Strafjustiz und den Tatbestand der Hexerei im Kontext der damaligen Zeit. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Erklärung der Hexenprozesse und den prozessualen Bedingungen.
- Basler Strafjustiz im Spätmittelalter
- Der Tatbestand der Hexerei und seine Entwicklung
- Prozessuale Bedingungen und die Rolle der Folter
- Analyse der Hexenprozesse als Massenphänomen
- Rehabilitation von Justizopfern
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einführung: Dieses einleitende Kapitel beleuchtet die Aktualität der Hexenprozesse und stellt den Fall der „Gräfin“ von Riehen vor, um den historischen Kontext zu etablieren. Es wirft die Frage auf, inwieweit Hexerei ein Phänomen des „Mittelalters“ ist und welche Bedeutung diese Prozesse auch heute noch besitzen.
II. Basler Strafjustiz im Spätmittelalter: Hier wird die Basler Strafjustiz des Spätmittelalters detailliert beschrieben, inklusive des damaligen Strafverfahrens. Der Fokus liegt auf den institutionellen Rahmenbedingungen, die die Hexenprozesse ermöglichten, und den Mechanismen der Rechtsprechung. Der Abschnitt analysiert die Strukturen und Prozesse der Justiz, um das Verständnis der damaligen Rechtspraxis zu fördern.
III. Hexenprozesse als Massenphänomen?: Dieses Kapitel untersucht die Hexenprozesse in Basel als mögliches Massenphänomen. Es analysiert Zahlen und Zyklen der Prozesse, evaluiert die Quellenlage und bietet einen Überblick über die Prozesse selbst. Das Kapitel beleuchtet das „Hexenschema“, also die typischen Merkmale und Elemente, die den Prozessen zugrunde lagen.
IV. Der Tatbestand der Hexerei: Dieser Abschnitt definiert den Tatbestand der Hexerei im Kontext des späten Mittelalters. Er beleuchtet verschiedene Aspekte wie „böse Zauberei“, häretische Magie und die Praxis in Basel. Das Kapitel analysiert die Elemente des Hexereibegriffs und untersucht die Rolle von Häretiker- und Hexensekten im 15. Jahrhundert. Die Einflüsse der „gelehrten Hexenlehre“, des „Hexenhammers“ und des Konzils von Basel werden ebenso untersucht, wie auch die frühe Kritik an der Hexenverfolgung durch Johannes Weyer. Die Kapitel fokussiert auf die juristischen und gesellschaftlichen Konstruktionen des Hexerei-Begriffs.
V. Prozessuale Bedingungen: Hier werden die prozessualen Bedingungen der Hexenprozesse untersucht, inklusive Zuständigkeit, Kontrolle, dem Inquisitionsprozess, der Anwendung von Folter und der Lehre vom crimen exceptum. Der Vergleich mit Prozessen in Deutschland, England und Spanien liefert zusätzliche Perspektiven auf die Basler Praxis und Kontextualisierung. Das Kapitel analysiert wie die prozessualen Abläufe die Ergebnisse der Prozesse beeinflusst haben.
VI. Zur Erklärung der Hexenprozesse: Dieser Teil befasst sich mit den Ursachen und Erklärungen für die Hexenprozesse. Er analysiert die soziokulturellen, politischen und religiösen Faktoren, die zu den Prozessen führten und ihre Intensität beeinflussten. Der Abschnitt versucht die komplexen Ursachen der Hexenverfolgung zu ergründen.
VII. Rehabilitation von Hexen als Justizopfer?: In diesem Kapitel wird die Möglichkeit einer Rehabilitation der Opfer der Hexenprozesse diskutiert. Es werden ethische, juristische und historische Aspekte beleuchtet, die eine solche Rehabilitation begründen könnten. Das Kapitel versucht eine kritische Auseinandersetzung mit der historischen und moralischen Verantwortung gegenüber den Opfern.
Schlüsselwörter
Hexenprozesse, Basel, Spätmittelalter, Strafjustiz, Hexerei, Folter, Inquisition, Justizopfer, Rehabilitation, Häresie, Magie, „Hexenhammer“, Johannes Weyer, crimen exceptum.
Häufig gestellte Fragen zu: Hexenprozesse in Basel im Spätmittelalter
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht Hexenprozesse in Basel während des Spätmittelalters, analysiert die Basler Strafjustiz und den Tatbestand der Hexerei, beleuchtet die prozessualen Bedingungen und strebt eine Rehabilitation der Opfer an.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Basler Strafjustiz im Spätmittelalter, den Tatbestand der Hexerei und dessen Entwicklung, die prozessualen Bedingungen inklusive der Rolle der Folter, die Analyse der Hexenprozesse als Massenphänomen und die Rehabilitation von Justizopfern.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Kapitel I (Einführung) behandelt die Aktualität des Themas und den Fall der „Gräfin“ von Riehen. Kapitel II beschreibt die Basler Strafjustiz und das Strafverfahren. Kapitel III untersucht die Hexenprozesse als Massenphänomen. Kapitel IV definiert den Tatbestand der Hexerei und analysiert dessen Elemente. Kapitel V behandelt die prozessualen Bedingungen, inklusive Folter und Vergleich mit anderen Ländern. Kapitel VI befasst sich mit den Erklärungen für die Hexenprozesse. Kapitel VII diskutiert die Rehabilitation der Opfer.
Wie wird der Tatbestand der Hexerei definiert?
Der Tatbestand der Hexerei wird im Kontext des späten Mittelalters definiert und umfasst Aspekte wie „böse Zauberei“, häretische Magie und die Basler Praxis. Die Arbeit analysiert die Elemente des Begriffs, untersucht Häretiker- und Hexensekten, die „gelehrte Hexenlehre“, den „Hexenhammer“, das Konzil von Basel und die Kritik von Johannes Weyer.
Welche Rolle spielte die Folter in den Basler Hexenprozessen?
Die Arbeit untersucht die Anwendung von Folter im Rahmen der Hexenprozesse und beleuchtet die prozessualen Bedingungen, die diese ermöglichten. Ein Vergleich mit Prozessen in Deutschland, England und Spanien liefert zusätzliche Perspektiven.
Wie werden die Hexenprozesse erklärt?
Die Arbeit analysiert soziokulturelle, politische und religiöse Faktoren, die zu den Hexenprozessen führten und deren Intensität beeinflussten, um die komplexen Ursachen der Hexenverfolgung zu ergründen.
Welche Bedeutung hat die Rehabilitation der Opfer?
Das letzte Kapitel diskutiert die Möglichkeit und die ethischen, juristischen und historischen Aspekte einer Rehabilitation der Opfer der Hexenprozesse, unter Berücksichtigung der historischen und moralischen Verantwortung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hexenprozesse, Basel, Spätmittelalter, Strafjustiz, Hexerei, Folter, Inquisition, Justizopfer, Rehabilitation, Häresie, Magie, „Hexenhammer“, Johannes Weyer, crimen exceptum.
- Quote paper
- Dr. iur. Harald Maihold (Author), 2020, Hexerei und Strafjustiz. Ein Blick auf Basel im Spätmittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/516877