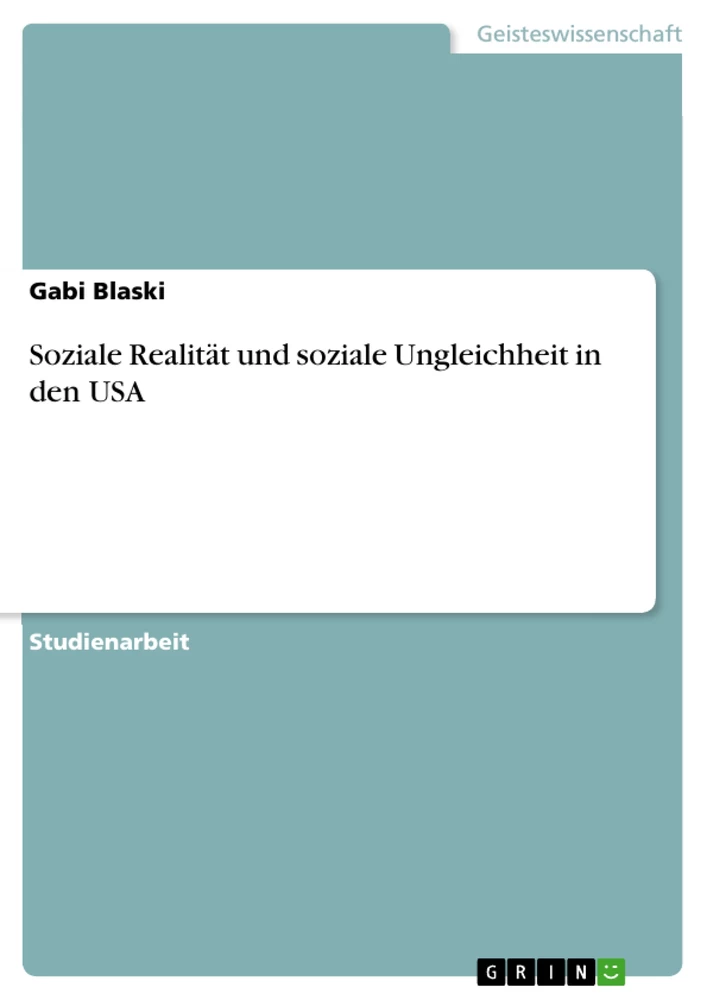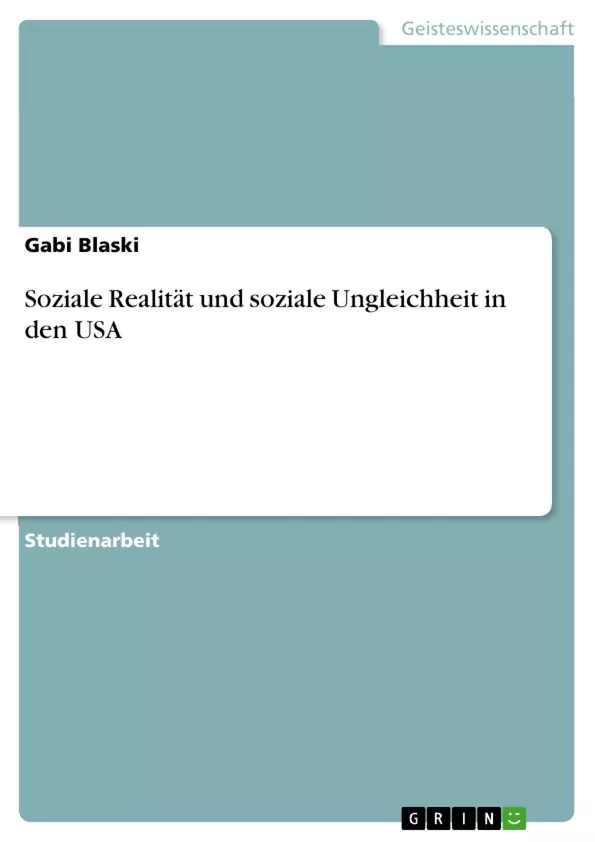Seit Jahrhunderten zieht es Menschen aus aller Welt in die Vereinigten Staaten von Amerika in der Hoffnung ihren Glauben frei ausleben, ein neues Leben aufbauen zu können und den "american dream“ zu leben. Der Glaube an ein besseres Leben im Wohlstand, die Möglichkeit seine Ziele zu erreichen und möglicherweise vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden, treibt die Auswanderer noch heute an. Allerdings kann dieser Traum auch zu einem Albtraum werden, denn das Leben in den USA hat seine Schattenseiten. Eine dieser Schattenseiten ist das neue Phänomen der „working poor“, auf das ich in dieser Arbeit näher eingehen möchte. Beginnen möchte ich allerdings allgemein mit dem Begriff der sozialen Ungleichheit, was soziale Ungleichheit bedeutet und welche unterschiedlichen Theorien es gibt. Im zweiten Teil dieser Arbeit werde ich dann die soziale Realität in den USA und insbesondere das Phänomen der „working poor“ näher erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- I. Der „american dream“ und seine Schattenseite
- II. Soziale Realität und soziale Ungleichheit in den USA
- 1. Was ist soziale Ungleichheit
- 1.1 Definition
- 1.1.1 soziale Ungleichheit „im weiteren Sinne“
- 1.1.2 soziale Ungleichheit „im engeren Sinne“
- 1.2 neue Dimensionen sozialer Ungleichheit
- 1.1 Definition
- 2. Soziale Realität in den USA
- 2.1 Armut in den USA
- 2.2 von Armut betroffene Gruppen
- 2.2.1 alleinerziehende Frauen
- 2.2.2 Unterschiede zwischen Stadt und Land
- 3. Das Phänomen der „working poor“
- 3.1 Die Lohnentwicklung in den USA
- 3.2 Die „working poor“
- 3.2.1 Jobs mit geringem Einkommen
- 3.2.2 schlechte Bildung und niedrige Löhne
- 3.2.3 staatliche Hilfen
- 1. Was ist soziale Ungleichheit
- III. Der US-amerikanische Teufelskreis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die soziale Realität und soziale Ungleichheit in den USA, mit einem besonderen Fokus auf das Phänomen der „working poor“. Die Arbeit beginnt mit einer Klärung des Begriffs der sozialen Ungleichheit, untersucht dann die Armut in den USA und die betroffenen Gruppen, um schließlich das Phänomen der „working poor“ im Detail zu beleuchten.
- Definition und Dimensionen sozialer Ungleichheit
- Armut in den Vereinigten Staaten
- Die „working poor“ als soziales Problem
- Sozioökonomische Faktoren in den USA
- Der „American Dream“ und seine Diskrepanz zur Realität
Zusammenfassung der Kapitel
I. Der „american dream“ und seine Schattenseite: Der einleitende Abschnitt beschreibt den anhaltenden Traum von Wohlstand und Erfolg in den USA, der viele Migranten anzieht. Gleichzeitig wird jedoch auf die Schattenseiten des „American Dream“ hingewiesen, wobei das Phänomen der „working poor“ als zentrales Thema der Arbeit hervorgehoben wird. Die Einleitung legt den Grundstein für die nachfolgende detaillierte Auseinandersetzung mit sozialer Ungleichheit in den USA.
II. Soziale Realität und soziale Ungleichheit in den USA: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Analyse der sozialen Ungleichheit in den USA. Es beginnt mit einer differenzierten Definition von sozialer Ungleichheit nach Reinhard Kreckel, die zwischen einem weiteren und engeren Sinn unterscheidet und verschiedene Dimensionen (relational, distributiv, hierarchisch, selektive Assoziation) einbezieht. Anschließend wird die soziale Realität in den USA durch die Darstellung der Armut und der betroffenen Gruppen (alleinerziehende Frauen, städtische vs. ländliche Bevölkerung) konkretisiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Erklärung des Phänomens der „working poor“, ihre Ursachen (geringe Löhne, mangelnde Bildung, unzureichende staatliche Unterstützung) werden beleuchtet. Das Kapitel verknüpft theoretische Überlegungen mit empirischen Beobachtungen und stellt den Zusammenhang zwischen verschiedenen Aspekten sozialer Ungleichheit dar.
III. Der US-amerikanische Teufelskreis: (Anmerkung: Da der Text hier endet, kann dieses Kapitel nicht zusammengefasst werden. Es wird angenommen, dass dieses Kapitel die in Kapitel II dargestellten Zusammenhänge und Probleme weiterführt und möglicherweise einen Teufelskreis aus Armut, mangelnder Bildung und niedrigen Löhnen beschreibt.)
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, soziale Gerechtigkeit, Armut, „working poor“, USA, „American Dream“, Reinhard Kreckel, soziale Realität, Lohnentwicklung, Bildung, staatliche Hilfen, soziale Mobilität, soziale Differenzierung.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Soziale Ungleichheit in den USA
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text analysiert die soziale Realität und soziale Ungleichheit in den USA, mit besonderem Fokus auf das Phänomen der „working poor“ (arbeitende Arme). Er untersucht den „American Dream“ und seine Diskrepanz zur Realität, beleuchtet Armut und betroffene Gruppen, und analysiert die Ursachen und Folgen niedriger Löhne und mangelnder Bildung.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themen: Definition und Dimensionen sozialer Ungleichheit (im weiteren und engeren Sinne nach Reinhard Kreckel), Armut in den USA, die „working poor“ als soziales Problem, sozioökonomische Faktoren, der „American Dream“ und seine Diskrepanz zur Realität, Lohnentwicklung, Bildung, staatliche Hilfen, und der mögliche Teufelskreis aus Armut, mangelnder Bildung und niedrigen Löhnen.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in drei Kapitel gegliedert: Kapitel I behandelt den „American Dream“ und seine Schattenseiten, einleitend zum Thema „working poor“. Kapitel II liefert eine umfassende Analyse sozialer Ungleichheit in den USA, einschließlich einer Definition von sozialer Ungleichheit, der Darstellung von Armut und betroffenen Gruppen, und einer detaillierten Betrachtung der „working poor“. Kapitel III (unvollständig im vorliegenden Auszug) wird voraussichtlich einen Teufelskreis aus Armut, mangelnder Bildung und niedrigen Löhnen beschreiben.
Welche Definition von sozialer Ungleichheit wird verwendet?
Der Text verwendet eine differenzierte Definition von sozialer Ungleichheit nach Reinhard Kreckel, die zwischen einem weiteren und engeren Sinn unterscheidet und verschiedene Dimensionen (relational, distributiv, hierarchisch, selektive Assoziation) einbezieht.
Welche Gruppen sind von Armut in den USA besonders betroffen?
Der Text nennt alleinerziehende Frauen und Unterschiede zwischen Stadt und Land als besonders von Armut betroffene Gruppen.
Was sind die Ursachen für das Phänomen der „working poor“?
Die Ursachen für das Phänomen der „working poor“ werden im Text auf geringe Löhne, mangelnde Bildung und unzureichende staatliche Unterstützung zurückgeführt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Soziale Ungleichheit, soziale Gerechtigkeit, Armut, „working poor“, USA, „American Dream“, Reinhard Kreckel, soziale Realität, Lohnentwicklung, Bildung, staatliche Hilfen, soziale Mobilität, soziale Differenzierung.
Für wen ist dieser Text bestimmt?
Der Text ist für akademische Zwecke bestimmt, insbesondere zur Analyse von Themen in der Soziologie und Sozialwissenschaften.
- Quote paper
- Gabi Blaski (Author), 2005, Soziale Realität und soziale Ungleichheit in den USA, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51807