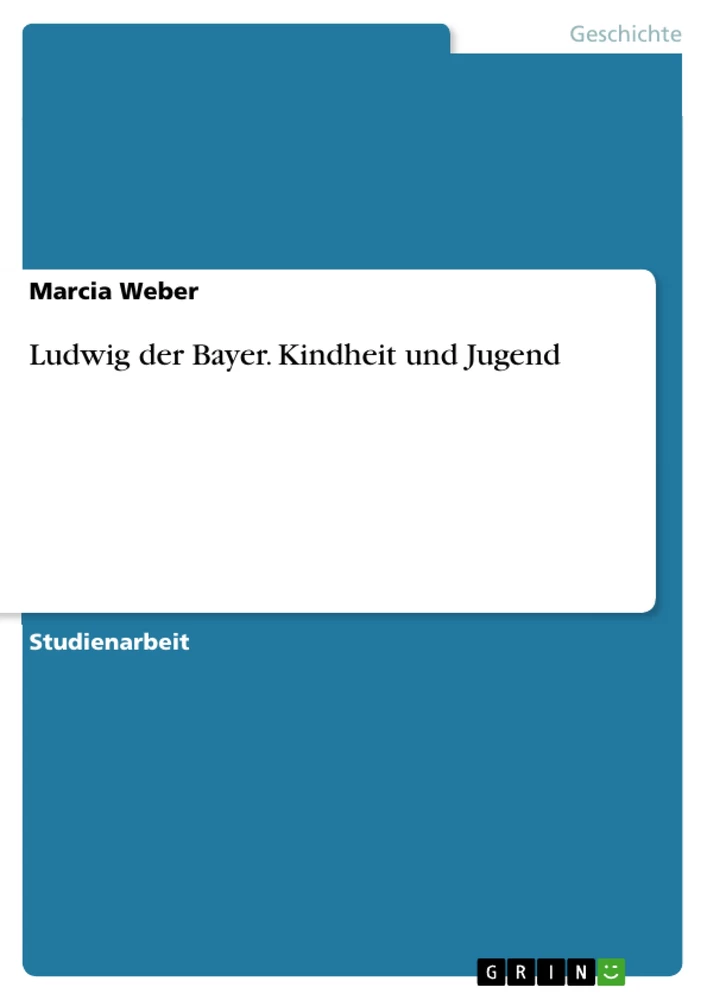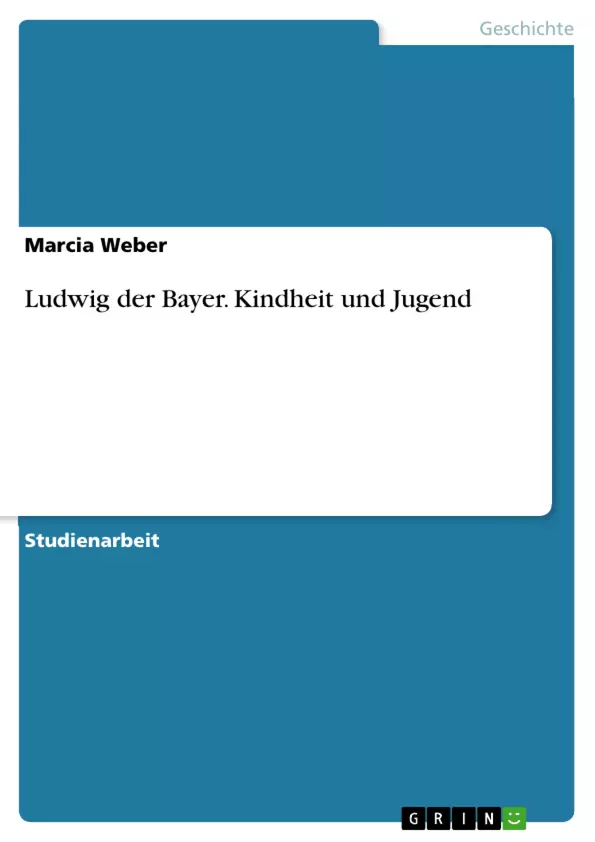Ludwig IV., genannt Ludwig der Bayer, war ab 1314 römisch-deutscher König und später Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Für die bayerische Geschichte gilt er als "Identifikationsfigur", da er der erste Wittelsbacher auf dem Kaiserthron war. Während über seine Zeit als König und Kaiser etliche Quellen vorliegen, bleiben Auskünfte über sein Geburtsjahr wie auch seine Kindheits- und Jugendgeschichte weitestgehend im Verborgenen. Da sich in Ludwigs jungen Jahren jedoch bereits das Verhältnis zu seinem älteren Bruder Rudolf, sowie zu seinem Neffen Friedrich dem Schönen auszeichnete, ist seine Jugendgeschichte durchaus relevant für das Verständnis seiner Person.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Themeneinführung
- Quellenlage
- Forschungsstand
- Vorgehensweise
- I. Hauptteil
- I.1. Herkunft
- I.2. Mögliche Geburtsjahre Ludwigs
- I.3. Kindheit
- I.4. Jugend in Wien: Ritterliche Erziehung
- II. Abschließende Beurteilung
- III. Literaturverzeichnis
- III.1. Quellenverzeichnis
- III.2. Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Kindheit und Jugend Ludwigs des Bayerns. Die Fokus liegt auf der Rekonstruktion seines Lebenswegs in den frühen Jahren, insbesondere im Hinblick auf seine Erziehung und seine Beziehungen zu seinen Brüdern. Die Quellenlage ist begrenzt, weshalb die Arbeit auf Vermutungen und Interpretationen zurückgreifen muss, die auf der Grundlage des Forschungsstandes und der bekannten Quellenlage getroffen werden können.
- Geburtsjahr und familiäre Herkunft Ludwigs des Bayerns
- Die spärlichen Quellen zur Kindheit und Jugend Ludwigs
- Die Rolle der mittelalterlichen ritterlichen Erziehung
- Das Verhältnis Ludwigs zu seinen Brüdern
- Die Bedeutung der Jugendjahre Ludwigs für sein späteres Leben und Wirken
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein. Sie beleuchtet die Bedeutung Ludwigs des Bayerns für die bayerische Geschichte und stellt die Herausforderungen dar, die sich aus der spärlichen Quellenlage ergeben. Es werden die Forschungsarbeiten zur Kindheit und Jugend Ludwigs vorgestellt, die als Grundlage für die Analyse dienen.
Der Hauptteil der Arbeit behandelt zunächst die familiäre Herkunft Ludwigs des Bayerns. Es folgt eine Diskussion der möglichen Geburtsjahre, wobei die Argumentation von Waldemar Schlögels als Grundlage für die weiterführende Analyse dient. Im nächsten Schritt werden die wenigen Quellen zur Kindheit Ludwigs analysiert. Der Fokus liegt dabei auf der mittelalterlichen Rittererziehung, die Ludwig als Sohn eines Herzogs erfahren haben muss. Die Arbeit analysiert verschiedene Bereiche der Rittererziehung, wie die geistige und körperliche Ausbildung sowie die charakterliche Erziehung.
Schlüsselwörter
Ludwig der Bayer, Kindheit, Jugend, Rittererziehung, Mittelalter, Habsburger, Wittelsbacher, Quellenlage, Forschungsstand.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Ludwig der Bayer?
Ludwig IV. war ab 1314 römisch-deutscher König und später Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Er war der erste Wittelsbacher auf dem Kaiserthron.
Warum ist die Quellenlage zu seiner Kindheit so schwierig?
Während über seine Zeit als Kaiser viele Dokumente vorliegen, wurden Details über seine frühen Jahre im Mittelalter kaum schriftlich festgehalten, was Historiker auf Vermutungen angewiesen macht.
Wie sah die ritterliche Erziehung im Mittelalter aus?
Sie umfasste eine geistige Ausbildung, intensive körperliche Ertüchtigung für den Kampf sowie eine charakterliche Erziehung nach den ritterlichen Tugenden.
Welches Verhältnis hatte Ludwig zu seinem Bruder Rudolf?
Bereits in jungen Jahren zeichneten sich Spannungen im Verhältnis zu seinem älteren Bruder Rudolf ab, die für das Verständnis seiner späteren politischen Laufbahn relevant sind.
Wann wurde Ludwig der Bayer geboren?
Das genaue Geburtsjahr bleibt im Verborgenen; die Arbeit diskutiert verschiedene Hypothesen, unter anderem auf Basis der Forschungen von Waldemar Schlögl.
- Quote paper
- Marcia Weber (Author), 2018, Ludwig der Bayer. Kindheit und Jugend, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/518348