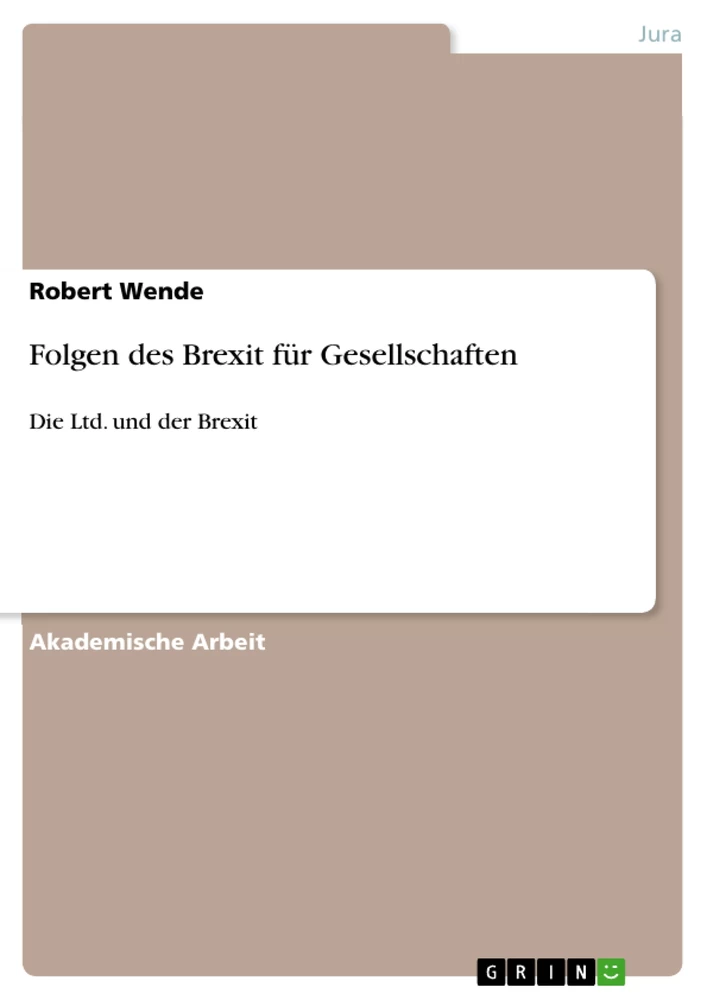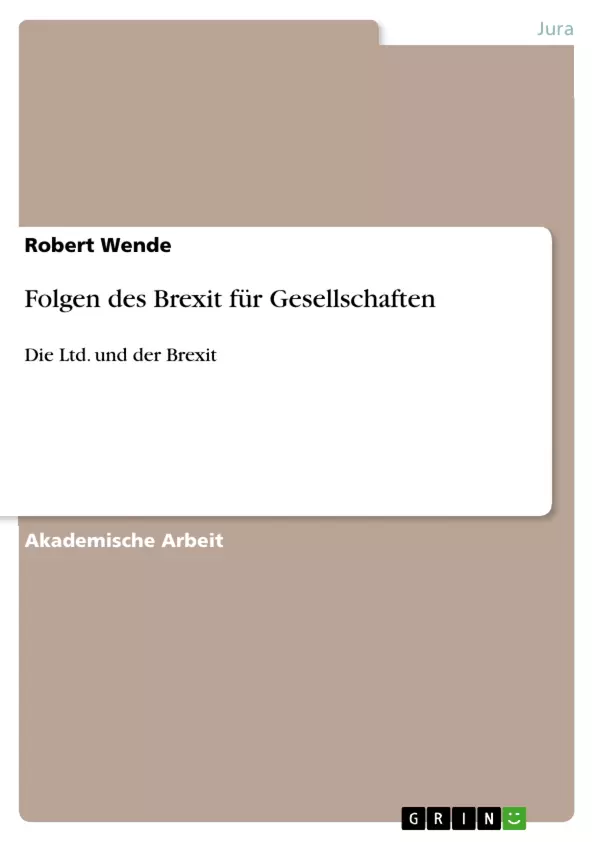Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, die rechtlichen Grundlagen und die denkbaren Varianten des Brexit und ihre Konsequenzen für nach britischem Recht organisierte Unternehmen in anderen Mitgliedstaaten der EU zu untersuchen. Diese hängen insbesondere davon ab, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die bisherigen Grundfreiheiten der EU im Verhältnis zwischen dieser und Großbritannien weiter gelten, wofür das Ergebnis der Austrittsverhandlungen maßgeblich ist. Vereinbart werden könnte etwa in Anlehnung an die mit der Schweiz getroffenen Vereinbarungen bilaterale Verträge zwischen Großbritannien und der EU.
In einem zweiten Schritt zielt die vorliegende Arbeit daher auf die Darstellung der Grundfreiheiten der EU und im gegebenen Zusammenhang insbesondere der Niederlassungsfreiheit und der Kapitalverkehrsfreiheit. Die daraus abzuleitenden Konsequenzen für nach britischem Recht gegründete Unternehmen wurden vor allem durch die Rechtsprechung des EuGH und auch des BGH definiert, die daher ebenfalls einen Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bilden.
Unter dem von der britischen Premierministerin gerne herangezogenen Schlagwort "Brexit means Brexit" zeichnet sich eine "harte" Version des britischen Ausstiegs aus der EU ab , die dazu führen könnte, dass die im Verhältnis der Mitgliedstaaten geltenden Grundfreiheiten nicht mehr anwendbar sind. Dies würde auch das Niederlassungsrecht von Unternehmen gem. Art. 49, 54 AEUV betreffen und dazu führen, dass in Deutschland tätige Gesellschaften sich nicht mehr einer britischen Gesellschaftsform bedienen könnten.
In Deutschland beträfe dies Unternehmen wie beispielsweise die Drogeriemarktkette Müller, die derzeit als britische PLC organisiert ist, aber auch zahlreiche oft kleinere Unternehmen, die als Limited nach britischem Recht gegründet wurden. Vorteil dieser Unternehmensform ist insbesondere die damit verbundene Haftungbeschränkung bei sehr geringen Gründungskosten, die im Falle eines "harten" Brexit womöglich entfallen würde. Die Ausgestaltung des Brexit hat somit unmittelbare Konsequenzen auch für in Deutschland tätige bzw. deutsche Unternehmen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Einführung in die Thematik
- 1.2 Ausgangslage und Ziel der Arbeit
- 2. Der "Brexit"
- 2.1 Rechtliche Grundlagen des Austritts aus der EU
- 2.1.1 Die Entwicklung der Austrittsoption
- 2.1.2 Voraussetzungen des Brexit nach britischem Recht
- 2.1.3 Formelle Durchführung des Austritts
- 2.1.4 Der Austrittsprozess
- 2.1.5 Die Rechtsfolgen des Austritts
- 2.2 Die Beziehungen Großbritanniens zur EU nach dem Brexit
- 2.2.1 Europarechtliche Vorgaben
- 2.2.2 Denkbare Entwicklungen der Beziehungen
- 3. Das Verhältnis der EU zu Drittstaaten
- 3.1 Das Binnenmarktziel der EU
- 3.2 Überblick über die Grundfreiheiten der EU
- 3.2.1 Die Niederlassungsfreiheit
- 3.2.2 Die Kapitalverkehrsfreiheit
- 3.3 Denkbare Alternative: Großbritannien im EWR
- 3.3.1 Entwicklung und Zweck des EWR
- 3.3.2 Die Grundfreiheiten im Verhältnis EWR/EU
- 3.4 Denkbare Alternative: Bilaterale Abkommen
- 4. Britische Limited nach dem "Brexit"
- 4.1 Anerkennung ausländischer Gesellschaften in Deutschland
- 4.1.1 Die Problematik der Auslandsgesellschaften
- 4.1.2 Die Rechtstellung britischer Ltd. in Deutschland
- 4.2 Folgen des Verlusts der Niederlassungsfreiheit für die Ltd.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die rechtlichen Grundlagen und möglichen Varianten des Brexit sowie deren Auswirkungen auf Unternehmen, die nach britischem Recht organisiert sind und in anderen EU-Mitgliedstaaten tätig sind. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, ob und inwieweit die bestehenden Grundfreiheiten der EU im Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU weiterhin gelten werden.
- Rechtliche Grundlagen des Brexit
- Auswirkungen des Brexit auf die Grundfreiheiten der EU
- Die Rechtstellung britischer Ltd. in Deutschland
- Mögliche Alternativen zum Brexit, wie z.B. bilaterale Abkommen oder der EWR
- Konsequenzen für Unternehmen, die nach britischem Recht gegründet wurden
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel führt in die Thematik des Brexit ein und beleuchtet die historische Entwicklung der britischen Beziehungen zur EU. Zudem wird die Ausgangslage und das Ziel der vorliegenden Arbeit erläutert.
- Kapitel 2: Der "Brexit"
Kapitel 2 analysiert die rechtlichen Grundlagen des britischen Austritts aus der EU, einschließlich der Entwicklung der Austrittsoption, der Voraussetzungen des Brexit nach britischem Recht und der formalen Durchführung des Austritts. Weiterhin wird die Beziehung zwischen Großbritannien und der EU nach dem Brexit beleuchtet, insbesondere die europarechtlichen Vorgaben und die möglichen Entwicklungen der Beziehungen.
- Kapitel 3: Das Verhältnis der EU zu Drittstaaten
Kapitel 3 befasst sich mit dem Verhältnis der EU zu Drittstaaten im Allgemeinen und beleuchtet das Binnenmarktziel der EU und die Grundfreiheiten, insbesondere die Niederlassungsfreiheit und die Kapitalverkehrsfreiheit. Außerdem werden zwei mögliche Alternativen zum Brexit vorgestellt: Großbritannien im EWR und bilaterale Abkommen.
- Kapitel 4: Britische Limited nach dem "Brexit"
Kapitel 4 untersucht die Anerkennung ausländischer Gesellschaften in Deutschland, insbesondere die Problematik der Auslandsgesellschaften und die Rechtstellung britischer Ltd. in Deutschland. Schließlich werden die Folgen des Verlusts der Niederlassungsfreiheit für die Ltd. im Falle eines harten Brexit beleuchtet.
Schlüsselwörter
Brexit, EU, Großbritannien, Grundfreiheiten, Niederlassungsfreiheit, Kapitalverkehrsfreiheit, Ltd., EWR, bilaterale Abkommen, Rechtstellung, Unternehmen, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was passiert mit britischen Limited-Gesellschaften in Deutschland nach dem Brexit?
Bei einem „harten Brexit“ verlieren diese Gesellschaften den Schutz der EU-Niederlassungsfreiheit. Dies könnte dazu führen, dass sie in Deutschland nicht mehr als haftungsbeschränkte Gesellschaften anerkannt werden.
Welche Rolle spielt die Niederlassungsfreiheit für Unternehmen?
Sie erlaubt es Unternehmen, die in einem EU-Land gegründet wurden, in jedem anderen Mitgliedstaat unter ihrer ursprünglichen Rechtsform tätig zu sein.
Was bedeutet ein „harter Brexit“ für die Haftungsbeschränkung?
Ohne die Anerkennung durch die EU-Grundfreiheiten könnten Gesellschafter einer britischen Limited im schlimmsten Fall persönlich für Firmenschulden haftbar gemacht werden.
Gibt es Alternativen zur kompletten Abkehr von der EU?
Ja, diskutiert werden Modelle wie der Verbleib im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder bilaterale Abkommen nach dem Vorbild der Schweiz.
Betrifft der Brexit nur große Konzerne wie die Müller PLC?
Nein, gerade viele kleinere Unternehmen haben sich der britischen Rechtsform „Limited“ bedient, um Gründungskosten zu sparen, und sind nun unmittelbar von den Rechtsfolgen betroffen.
- Arbeit zitieren
- Diplom Rechtspfleger Robert Wende (Autor:in), 2018, Folgen des Brexit für Gesellschaften, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/518502