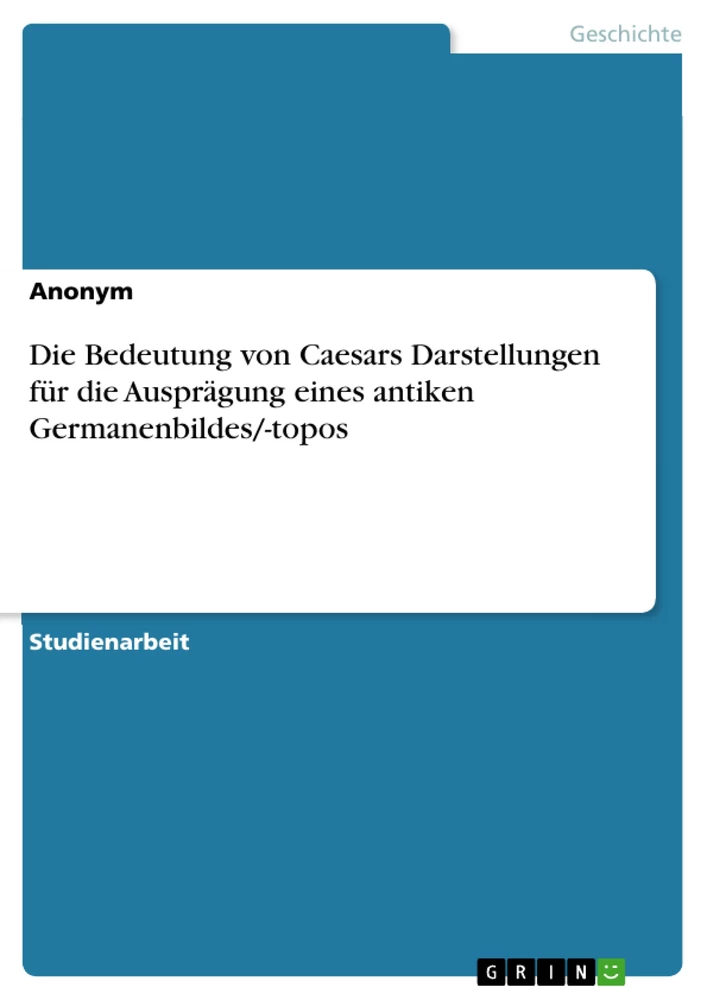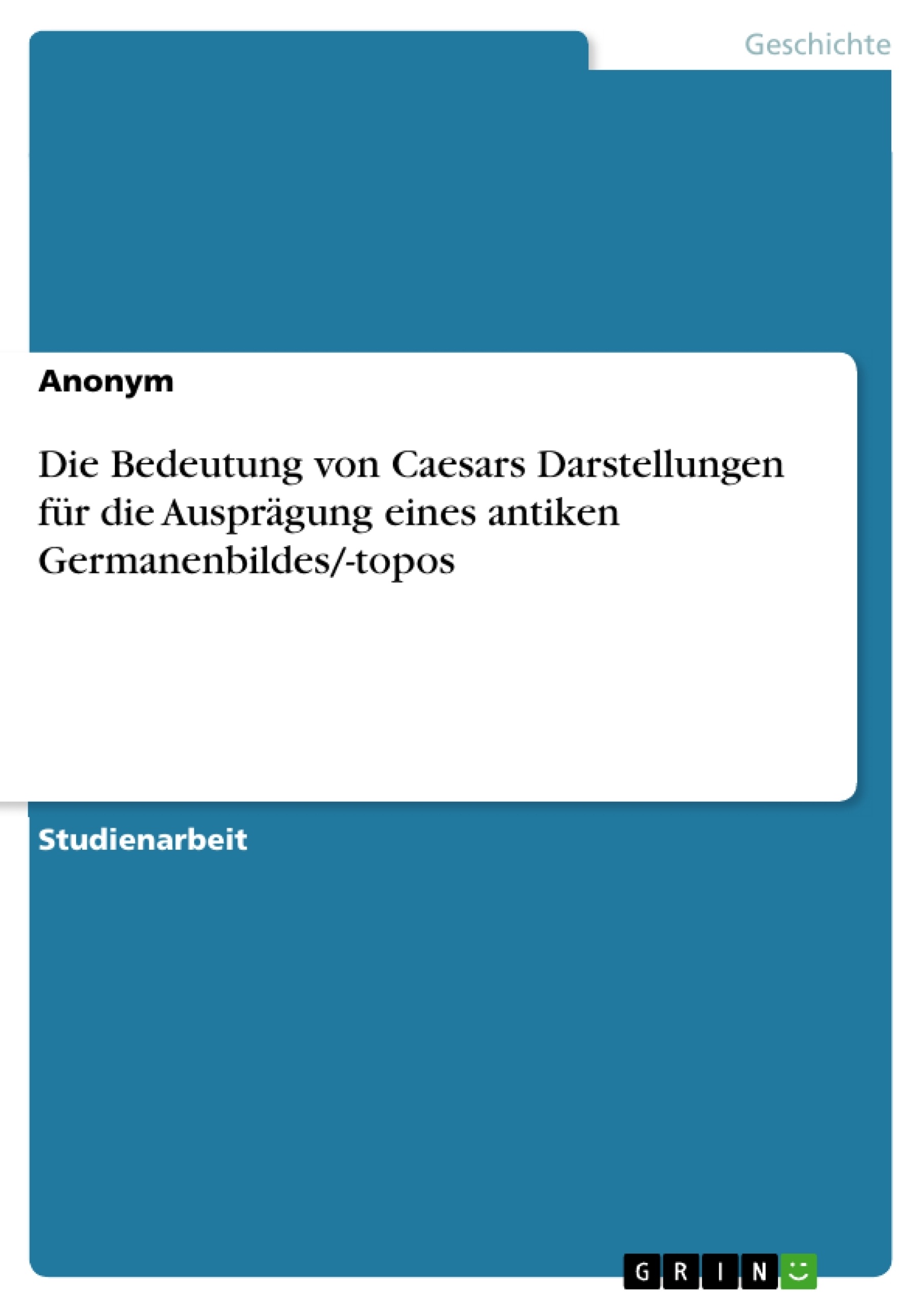Es liegt ein Irrtum vor, dass die antiken, römischen und griechischen Autoren unter der Bezeichnung "Germanen" das gleiche wahrgenommen haben, wie der moderne Forscher heute. Für den neuzeitlichen Historiker repräsentieren die Germanen "ein durch die germanische Spracheinheit und […] auch durch gleiche Rasseneigenart zusammengehaltenes Volkstum." Die antike Auffassung der Germanen scheint sich grundsätzlich von der heutigen wissenschaftlichen Vorstellung zu unterscheiden. Dies erklärt sich in jenem Kontext, dass die alten Römer sich selbst im Zentrum der Welt sahen und die Barbaren bzw. Germanen sie als Völker an der Peripherie war nahmen. Es herrschte also ein stark ausgeprägter Ethnozentrismus in der Antike.
Bei der Einführung des Germanenbegriffs in seinem Bellum Gallicum erweckt Caesar den Anschein einer Selbstverständlichkeit in dieser Bezeichnung, da dem Leser keinerlei tiefgreifende Erklärungen über dessen Bedeutung vorgelegt werden. Somit muss der Germanenbegriff der römischen Welt generell bekannt gewesen sein. Folgt man den Beschreibungen Caesars, so hat es zu seiner Zeit fünf Stämme gegeben, welche die Bezeichnung "Germanen" führten. Allerdings bleibt der Begriff "Germane" nicht als Eigenbezeichnung zu verstehen, sondern als exogen gegebene Fremdbezeichnung. Er beschreibt somit nicht eine Ethnizität oder einheitliche Volksgruppe, sondern umfasst vielmehr eine Vielfalt von verschiedenen Stämmen mit endogen ausgeprägten Namen. Dass die hier zu untersuchende Quelle von topoi übersät ist, beruht auf einer weitverbreiteten Forschungsmeinung. Trotz dieser Klischees erweist sich die Frage, ob durch die Analyse antiker Germanenbilder die künstliche Schaffung eines römischen Germanenbildes möglich wird, als interessant.
Gibt es überhaupt schlüssige Angaben zu den Germanen, sodass ein römisches Germanenbild zu rekonstruieren wäre? Im Hinblick auf diese Problemstellungen hat Iulius Caesar durchaus prägende Bilder des alten Germanentums hinterlassen. Zudem gilt seine Überlieferung über die Germanen in der lateinischen Geschichtsschreibung als eine der bedeutendsten und beispielhaftesten. Außergewöhnlich erscheint jedoch, dass Caesar sich im Gegenzug zu anderen antiken Autoren von der Klima-und Zonentheorie abwendete und sich an dieser Stelle einer West-Ost-Orientierung zuwandte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. Abgrenzung der Germanenbezeichnung
- 3. Antike Barbarenauffassungen
- 3.1 Die herkömmliche Fremdbezeichnung
- 3.2 Der Barbarenbegriff der Römer
- 4. De Bello Gallico als Quelle einer Germanenauffassung
- 4.1 Beschreibung der Quelle
- 4.2 Der Germanenbegriff bei Caesar
- 5. Zum Germanenbild des Autors
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Caesars Darstellungen für die Ausprägung eines antiken Germanenbildes. Sie beleuchtet, inwieweit Caesars Beschreibungen die spätere Wahrnehmung der Germanen beeinflusst haben und wie sich sein Germanenbegriff von der modernen wissenschaftlichen Vorstellung unterscheidet. Der Fokus liegt auf der Analyse von Caesars Werk "De Bello Gallico" als Quelle für das römische Verständnis der Germanen.
- Der Germanenbegriff bei Caesar im Kontext der antiken Barbarenauffassung.
- Die Rolle von Caesars "De Bello Gallico" als prägende Quelle für das römische Germanenbild.
- Die Grenzen und methodischen Herausforderungen bei der Rekonstruktion eines antiken Germanenbildes anhand der antiken Quellen.
- Die Frage nach der Ethnizität und der exogenen vs. endogenen Benennung der Germanen.
- Der Einfluss des politischen und historischen Kontextes auf Caesars Darstellung der Germanen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss von Caesars Darstellungen auf das antike Germanenbild. Sie betont die Diskrepanz zwischen der antiken und der modernen Auffassung der Germanen und erklärt den Kontext des römischen Ethnozentrismus. Caesar wird als militärischer Gegner, Verbündeter, Ethnograph und Historiker der Germanen vorgestellt, wobei der Fokus auf der Analyse seiner prägenden Beschreibungen und deren Nachwirkung liegt. Der Wahrheitsgehalt der Quelle spielt eine untergeordnete Rolle. Die Arbeit gliedert sich in eine Abgrenzung des Germanenbegriffs, eine Gegenüberstellung antiker Barbarenbilder, eine Quellenanalyse und eine Zusammenfassung der Ergebnisse. Offene Forschungsfragen bezüglich Ethnogenese, Stammesbildung und germanischer Volksgeschichte werden angesprochen, sowie die Bedeutung der Arbeiten von Lund, Krierer und Günnewig für den Forschungsstand.
2. Abgrenzung der Germanenbezeichnung: Dieses Kapitel beleuchtet die Problematik des Germanenbegriffs. Die moderne Forschung diskutiert die kontroverse Herkunft und Bedeutung der Bezeichnung, die möglicherweise erstmals bei Poseidonios von Apamea auftaucht. Die Frage, ob der Begriff eine römische Erfindung oder eine Selbstbezeichnung darstellt, wird erörtert. Der Begriff "Proto-Germane" und die Schwierigkeit einer eindeutigen Definition werden behandelt, sowie der Vorschlag einiger Forscher, den Begriff zu vermeiden. Die cäsarische Festlegung der Rhein-Donau-Grenze als ideelle Grenze zwischen Barbarentum und Zivilisation wird diskutiert. Die Abhandlung schließt mit der Feststellung, dass Caesars Vorstellung von den Germanen von der Realität abweicht, da sie durch seine Voraussetzungen und Ziele beeinflusst wurde.
Schlüsselwörter
Germanen, Caesar, De Bello Gallico, antikes Germanenbild, Barbarenauffassung, Ethnozentrismus, Ethnogenese, Ethnonym, Fremdbezeichnung, Quellenanalyse, römische Wahrnehmung, historischer Kontext, politisches Interesse.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des antiken Germanenbildes bei Caesar
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht, wie Caesars Darstellungen in seinem Werk "De Bello Gallico" das antike Germanenbild geprägt haben. Sie analysiert die Unterschiede zwischen der römischen Wahrnehmung der Germanen und der modernen wissenschaftlichen Sichtweise.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquelle ist Caesars "De Bello Gallico". Die Arbeit setzt sich kritisch mit dieser Quelle auseinander und betrachtet sie im Kontext des römischen Ethnozentrismus und der antiken Barbarenauffassung. Zusätzlich werden die Arbeiten von Lund, Krierer und Günnewig zum Forschungsstand berücksichtigt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Abgrenzung des Germanenbegriffs, die antiken Barbarenbilder, die Quellenanalyse von Caesars "De Bello Gallico", die Rolle des politischen und historischen Kontextes in Caesars Darstellung, die Frage nach der Ethnogenese und der exogenen vs. endogenen Benennung der Germanen sowie die methodischen Herausforderungen bei der Rekonstruktion eines antiken Germanenbildes.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Abgrenzung des Germanenbegriffs, ein Kapitel zu antiken Barbarenbildern, ein Kapitel zur Quellenanalyse von Caesars "De Bello Gallico", ein Kapitel zum Germanenbild des Autors und ein Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Kontext dar. Die Kapitel fassen die jeweiligen Themen zusammen und diskutieren relevante Aspekte.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zeigt auf, wie Caesars Darstellungen die spätere Wahrnehmung der Germanen beeinflusst haben und wie sich sein Germanenbegriff von der modernen wissenschaftlichen Vorstellung unterscheidet. Sie hebt die Grenzen und Herausforderungen bei der Rekonstruktion eines antiken Germanenbildes anhand antiker Quellen hervor und diskutiert die Problematik des Germanenbegriffs selbst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Germanen, Caesar, De Bello Gallico, antikes Germanenbild, Barbarenauffassung, Ethnozentrismus, Ethnogenese, Ethnonym, Fremdbezeichnung, Quellenanalyse, römische Wahrnehmung, historischer Kontext, politisches Interesse.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Einfluss von Caesars Darstellungen auf die Ausprägung des antiken Germanenbildes zu untersuchen und die Diskrepanz zwischen der antiken und der modernen Auffassung der Germanen aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Analyse von Caesars Werk "De Bello Gallico" als Quelle für das römische Verständnis der Germanen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Die Bedeutung von Caesars Darstellungen für die Ausprägung eines antiken Germanenbildes/-topos, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/518508