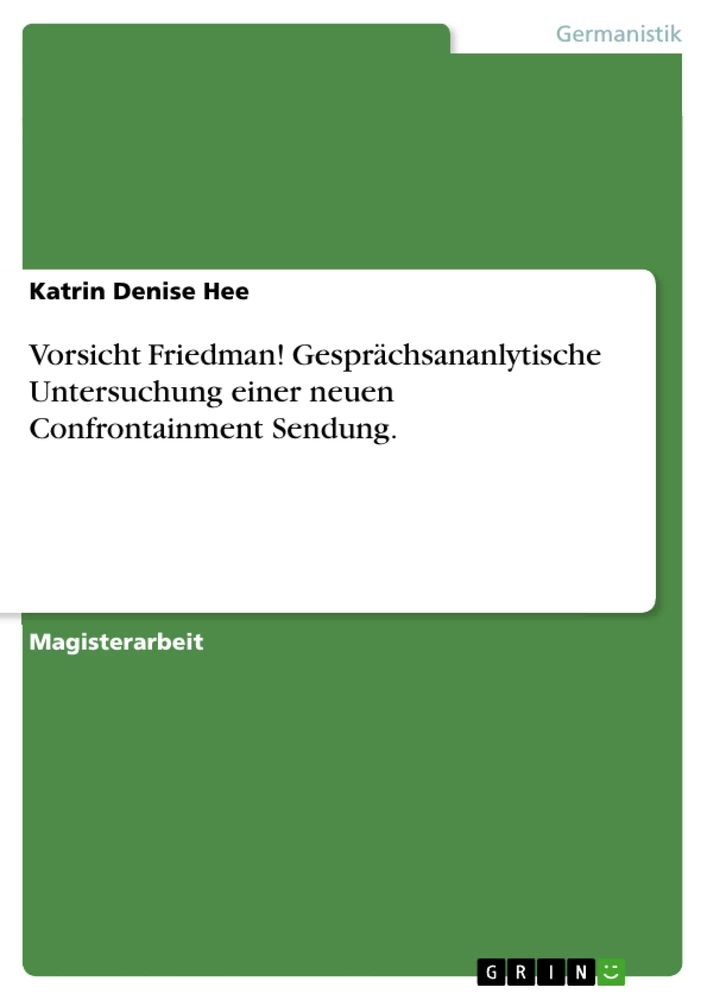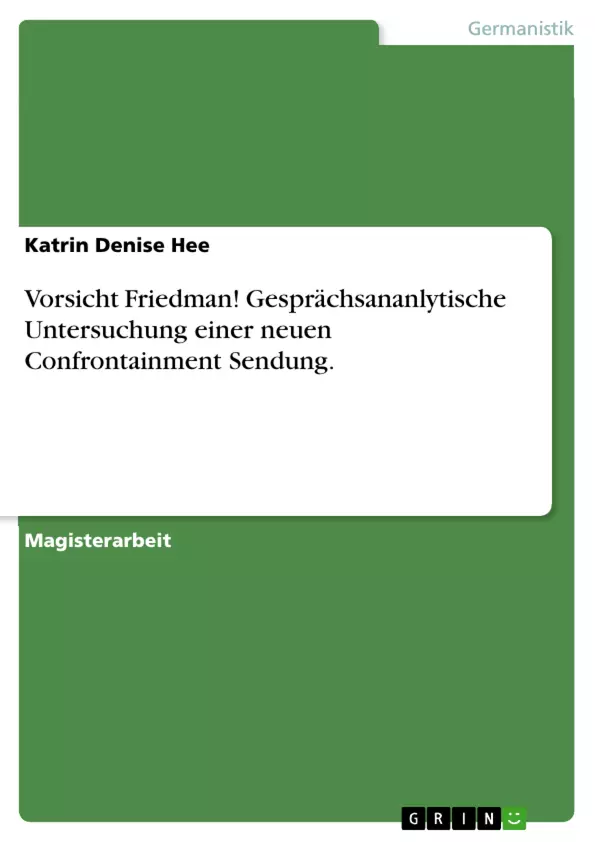Bereits bei Aristoteles findet sich die Empfehlung, nicht über Worte zu streiten. Allerdings gibt es eine Ausnahme, die den Streit um Worte rechtfertigt, und das ist der politische Streit um Worte. So waren sich auch schon die Politiker der Antike der Macht der Sprache bewusst und schrieben der Rhetorik eine große Bedeutung zu.
Wie viel Missbrauch mit Sprache getrieben werden kann, zeigen uns die Ereignisse der jüngeren deutschen Geschichte.
Viele Autoren, darunter Victor Klemperer, haben sich dieses Phänomens angenommen und die Sprache im Dritten Reich und damit auch die politische Sprache untersucht.
In der heutigen Zeit scheint, gerade durch das Wachsen der Medien und die Verbreitung der politischen Äußerungen, die Sprache ein nicht zu vernachlässigendes Mittel im Kampf um die politische Macht zu werden.
Eine große Rolle spielen dabei wie angedeutet die Medien und der Journalismus. Immer mehr politische Sendungen erreichen den Wähler, immer wieder werden Politiker in Zeitungen zitiert und ihre Meinungen der Öffentlichkeit unterbreitet.
So gesehen bieten diese Medien einerseits den Politikern zwar Raum, ihre Ideen publik zu machen, andererseits laufen sie aber auch Gefahr, in einer politischen Sendung beispielsweise von einem Journalist derartig ins Kreuzfeuer genommen zu werden, dass die Wähler ein eher negatives Bild bekommen.
Chancen und Risiken liegen hier also dicht beieinander, zumal wir seit den siebziger Jahren davon abgekommen sind, die Politiker mit Samthandschuhen anzufassen und statt dessen zu einer kritischen und durchaus nicht vor gewissen Grenzen haltenden Interviewtechnik übergegangen sind.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Ziel der Arbeit
- II. Recherche und Vorgehensweise
- B. Hauptteil
- I. Die Sendung
- 1. Zur Geschichte der Sendung
- 2. Konzept
- 3. Themen- und Besucherwahl
- 4. Publikum
- 5. Anspruch und Adressat
- 6. Räumliches Arrangement und Visualisierung
- 7. Dauer
- 8. Warming up
- II. Das Korpus
- III. Ablaufschema
- 1. Beginn
- 2. Die Diskussion
- 2.1 Beginn der Diskussion
- 2.2 Die Diskussion um ein Thema
- 2.3 Themenwechsel
- 3. Ende
- IV. Diskussionsorganisation und -verlauf
- 1. Gesprächsrollen
- 1.1. die Rolle Friedmans
- 1.2 die Rolle der Teilnehmer
- 1.3. Adressierung und Anrede
- 2. Gesprächsverteilung
- 2.1 Sprecherwechsel
- 2.2 Gliederungssignale und Rückmeldungen
- 1. Gesprächsrollen
- V. Konflikt
- 1. Definition
- 2. Meinungs- und Beziehungskonflikte
- 3. Der face-Begriff
- 4. Selbst- und Fremddarstellung.
- 5. Interaktionismus
- 5.1. Angriffe
- 5.2. Reaktionen
- VI. Confrontainment
- 1. Allgemeines zum Begriff
- 2. Confrontainment als Charakteristikum der Sendung
- 3. „Geladene Fragen“
- 4. Analyse einer Confrontainment-Situation
- VII. Thematische Inkonsistenzen
- 1. Nonresponsive Antworten
- 2. Metakommunikation
- 3. Reparaturen
- VIII. Beobachtungen zum nonverbalen Verhalten
- I. Die Sendung
- C. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die politische Diskussionssendung „Vorsicht Friedman!“ des Hessischen Rundfunks unter dem Aspekt des Confrontainments. Anhand zweier Sendungen mit den Themen „Schwarze Zukunft für grüne Regierungsträume?“ und „Rot-grün legt los - lauer Aufguss oder Neubeginn?“ wird die Sprache der Gäste und des Moderators Michel Friedman analysiert.
- Das Konzept und die Struktur der Sendung „Vorsicht Friedman!“
- Die sprachliche Analyse der Sendung, einschließlich der Gesprächsorganisation und des Verlaufs
- Die Rolle von Konflikt und Confrontainment in der Sendung
- Thematische Inkonsistenzen in der Diskussion
- Beobachtungen zum nonverbalen Verhalten in der Sendung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert das Ziel der Arbeit und die Methode der Recherche. Der Hauptteil widmet sich zunächst der Sendung selbst, inklusive ihrer Geschichte, ihres Konzepts und ihrer Zielgruppe. Anschließend wird das Korpus der Analyse, die beiden ausgewählten Sendungen, vorgestellt. Es folgt eine detaillierte Beschreibung des Ablaufschemas und der Organisation der Diskussion, einschließlich der Gesprächsrollen und -verteilung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Konflikten in der Sendung und der Rolle von Confrontainment. Abschließend werden thematische Inkonsistenzen in der Gesprächsführung beleuchtet und Beobachtungen zum nonverbalen Verhalten der Teilnehmer zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Politische Diskussionssendung, Confrontainment, Gesprächsanalyse, Michel Friedman, „Vorsicht Friedman!“, Konflikt, Sprache, nonverbale Kommunikation, Thematische Inkonsistenzen.
- Quote paper
- MA Katrin Denise Hee (Author), 2003, Vorsicht Friedman! Gesprächsananlytische Untersuchung einer neuen Confrontainment Sendung., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51917