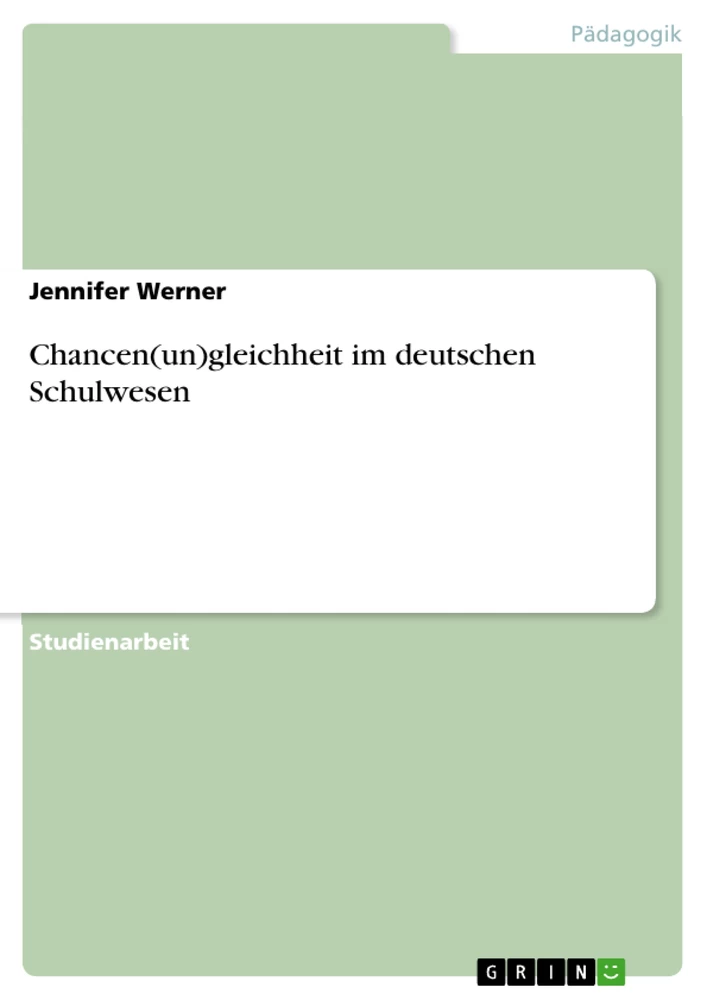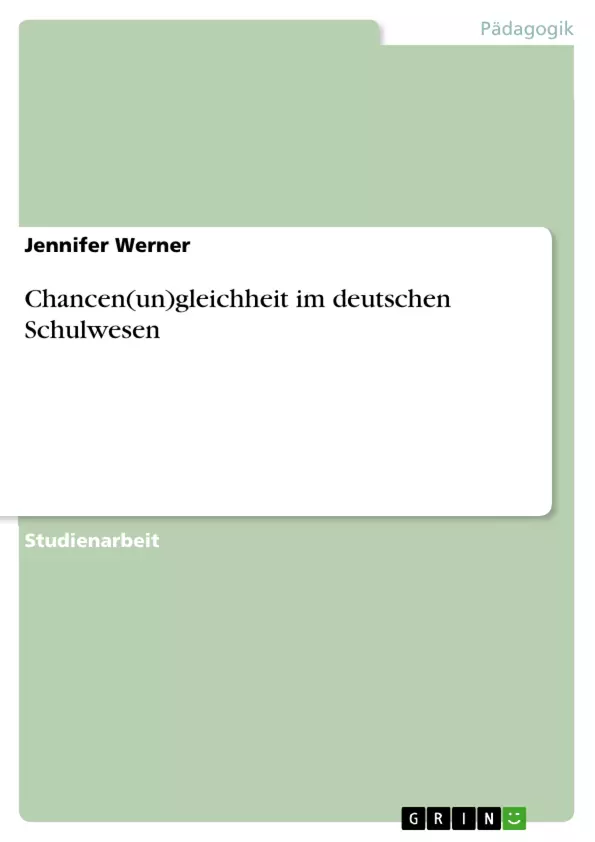Thema dieser Hausarbeit ist die Entwicklung des deutschen Schulsystems bis 1960. Es soll gezeigt werden, wie sich das System Schule im gesellschaftlichen Kontext verändert und welche Faktoren für diese Veränderung mitbestimmend sind. Dabei gehen wir von der Annahme von u.a. Diederich und Tenorth aus1, dass das System Schule keineswegs nur von Pädagogen und Bildungstheoretikern geformt wird, sondern immer auch Thema der Politik ist und sich damit auch ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen anpasst. Verändern sich die herrschenden Bedingungen hat dies auch Auswirkungen auf die Forderungen, die die Gesellschaft oder der Staat an die Schule stellt. Im Zusammenhang zum Seminarthema sollen aus den Veränderungen der verschiedenen Epochen der deutschen Geschichte die jeweiligen Auswirkungen auf die Chancen einzelner Bevölkerungsgruppen, die Schule zu besuchen und einen Abschluss zu machen, erarbeitet werden. Die gesellschaftlichen und ökonomischen Umstände sollen erst kurz skizziert werden, um dann die sich daraus ergebenden Forderungen abzuleiten. Dazu haben wir die deutsche Geschichte vom 19. Jahrhundert bis 1960 in vier Epochen unterteilt: Die Kaiserzeit, die Weimarer Republik, der Nationalsozialismus und die Nachkriegszeit. Weiterhin haben wir vier Kriterien aufgestellt, anhand denen diese Epochen untersucht werden sollen: Die ökonomische bzw. gesellschaftliche Situation, die sich daraus ergebenden Forderungen an die Schule, die Auswirkungen auf die Chancenverteilung innerhalb der Gesellschaft und schließlich die Lehrerbildung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schule zur Kaiserzeit
- Gesellschaftliche Umstände und deren Auswirkungen auf das Schulsystem
- Pädagogische Forderungen
- Chancenverteilung
- Lehrerbildung
- Schule in der Weimarer Republik
- Gesellschaftliche Umstände und deren Auswirkungen auf das Schulsystem
- Pädagogische Forderungen
- Chancenverteilung
- Lehrerbildung
- Die Nationalsozialistische Schulpolitik
- Gesellschaftliche Umstände und deren Auswirkungen auf das Schulsystem
- Pädagogische Forderungen
- Chancenverteilung
- Lehrerbildung
- Deutsche Schulentwicklung von 1945 bis 1960
- Gesellschaftliche Umstände und deren Auswirkungen auf das Schulsystem
- Pädagogische Forderungen
- Chancenverteilung
- Lehrerbildung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung des deutschen Schulsystems bis 1960. Das Ziel der Arbeit ist es, zu zeigen, wie das Schulsystem im gesellschaftlichen Kontext Veränderungen erfuhr und welche Faktoren diese Entwicklung beeinflussten. Dabei geht die Arbeit von der Annahme aus, dass das Schulsystem nicht nur von Pädagogen und Bildungstheoretikern gestaltet wird, sondern auch ein Thema der Politik ist und sich ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen anpasst. Im Kontext des Seminarthemas werden die Auswirkungen der Veränderungen in den verschiedenen Epochen der deutschen Geschichte auf die Chancen einzelner Bevölkerungsgruppen, die Schule zu besuchen und einen Abschluss zu machen, erarbeitet. Die gesellschaftlichen und ökonomischen Umstände werden zunächst kurz skizziert, um dann die daraus resultierenden Forderungen abzuleiten. Die deutsche Geschichte vom 19. Jahrhundert bis 1960 wird in vier Epochen unterteilt: die Kaiserzeit, die Weimarer Republik, der Nationalsozialismus und die Nachkriegszeit. Zur Untersuchung dieser Epochen werden vier Kriterien herangezogen: die ökonomische bzw. gesellschaftliche Situation, die daraus resultierenden Anforderungen an die Schule, die Auswirkungen auf die Chancenverteilung innerhalb der Gesellschaft und schließlich die Lehrerbildung. Insgesamt soll diese Arbeit aufzeigen, wie das dreigliedrige Schulsystem, wie wir es heute kennen, sich herausgebildet und gefestigt hat.
- Die Entwicklung des deutschen Schulsystems im 19. Jahrhundert bis 1960
- Der Einfluss gesellschaftlicher und ökonomischer Faktoren auf das Schulsystem
- Die Chancenverteilung im Schulsystem und deren Abhängigkeit von sozialen Faktoren
- Die Bedeutung der Lehrerbildung in der Schulentwicklung
- Die Herausbildung des dreigliedrigen Schulsystems
Zusammenfassung der Kapitel
Schule zur Kaiserzeit
Dieses Kapitel beleuchtet die gesellschaftlichen Umstände und deren Auswirkungen auf das Schulsystem im Deutschen Kaiserreich. Es wird die Bedeutung der Industrialisierung und der Rolle der Schule als Instrument der Sozialkontrolle hervorgehoben. Im Fokus stehen auch die pädagogischen Forderungen der Zeit, die sich in einer strengen Disziplin und nationaler Gesinnung manifestierten. Die Chancenverteilung innerhalb der Gesellschaft wird anhand der Trennung zwischen niederen und höheren Ständen und der eingeschränkten Bildungschancen für Frauen und Angehörige der niederen Schichten analysiert. Abschließend wird die Lehrerbildung und die Ungleichheit zwischen Volksschullehrern und Gymnasiallehrern beleuchtet.
Schule in der Weimarer Republik
Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen der gesellschaftlichen Umstände auf das Schulsystem in der Weimarer Republik. Es werden die pädagogischen Forderungen der Zeit, die sich in der Betonung von Demokratie und Freiheit ausdrückten, diskutiert. Die Auswirkungen auf die Chancenverteilung werden beleuchtet, wobei die Bemühungen um eine Gleichstellung von Mädchen und Jungen im Bildungssystem im Vordergrund stehen. Schließlich wird die Lehrerbildung in der Weimarer Republik betrachtet.
Die Nationalsozialistische Schulpolitik
Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der nationalsozialistischen Ideologie auf das Schulsystem. Es werden die pädagogischen Forderungen der Nazis, die sich auf Unterordnung, Gehorsam und Rassismus konzentrierten, aufgezeigt. Der Einfluss des NS-Regimes auf die Chancenverteilung im Bildungssystem und die Unterdrückung und Diskriminierung von Juden und anderen Minderheiten werden behandelt. Auch die Rolle der Lehrerbildung im nationalsozialistischen Schulsystem wird beleuchtet.
Deutsche Schulentwicklung von 1945 bis 1960
Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des Schulsystems in der Nachkriegszeit. Es werden die gesellschaftlichen Umstände und deren Auswirkungen auf das Schulsystem betrachtet, wobei die Herausforderungen des Wiederaufbaus und die Bemühungen um eine demokratische Bildung im Vordergrund stehen. Die pädagogischen Forderungen der Zeit, die sich in der Förderung von Demokratie und Toleranz widerspiegelten, werden diskutiert. Schließlich werden die Auswirkungen der Veränderungen auf die Chancenverteilung und die Rolle der Lehrerbildung in der Nachkriegszeit beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit umfassen die Themen Chancenungleichheit, Bildungssystem, Schulentwicklung, gesellschaftliche Verhältnisse, pädagogische Forderungen, Chancenverteilung, Lehrerbildung, Kaiserzeit, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Nachkriegszeit, dreigliedriges Schulsystem.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich das deutsche Schulsystem bis 1960 entwickelt?
Das System entwickelte sich von der Kaiserzeit über die Weimarer Republik und den Nationalsozialismus bis zur Nachkriegszeit, wobei es sich stets politischen und ökonomischen Bedingungen anpasste.
Was war das Ziel der Schule in der Kaiserzeit?
In der Kaiserzeit diente die Schule vor allem der Sozialkontrolle, der Vermittlung nationaler Gesinnung und der Ausbildung disziplinierter Untertanen für die Industrie.
Wie veränderte sich die Schule in der Weimarer Republik?
Es gab Bestrebungen zu mehr Demokratie, Freiheit und einer besseren Chancenverteilung, wie etwa die Bemühungen um die Gleichstellung von Mädchen im Bildungssystem.
Welchen Einfluss hatte der Nationalsozialismus auf das Schulwesen?
Die Schule wurde ideologisiert; Erziehungsziele waren Unterordnung, Gehorsam und Rassismus. Minderheiten wie Juden wurden systematisch diskriminiert und vom Bildungssystem ausgeschlossen.
Wie entstand das dreigliedrige Schulsystem?
Die Arbeit zeigt auf, wie sich die Trennung in verschiedene Schulformen über die Epochen hinweg verfestigte, basierend auf sozialen Schichtungen und ökonomischen Anforderungen.
Welche Rolle spielte die Lehrerbildung in dieser Entwicklung?
Die Lehrerbildung war oft gespalten, etwa zwischen Volksschullehrern und Gymnasiallehrern, was die soziale Selektivität des gesamten Bildungssystems widerspiegelte.
- Quote paper
- Jennifer Werner (Author), 2004, Chancen(un)gleichheit im deutschen Schulwesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51981