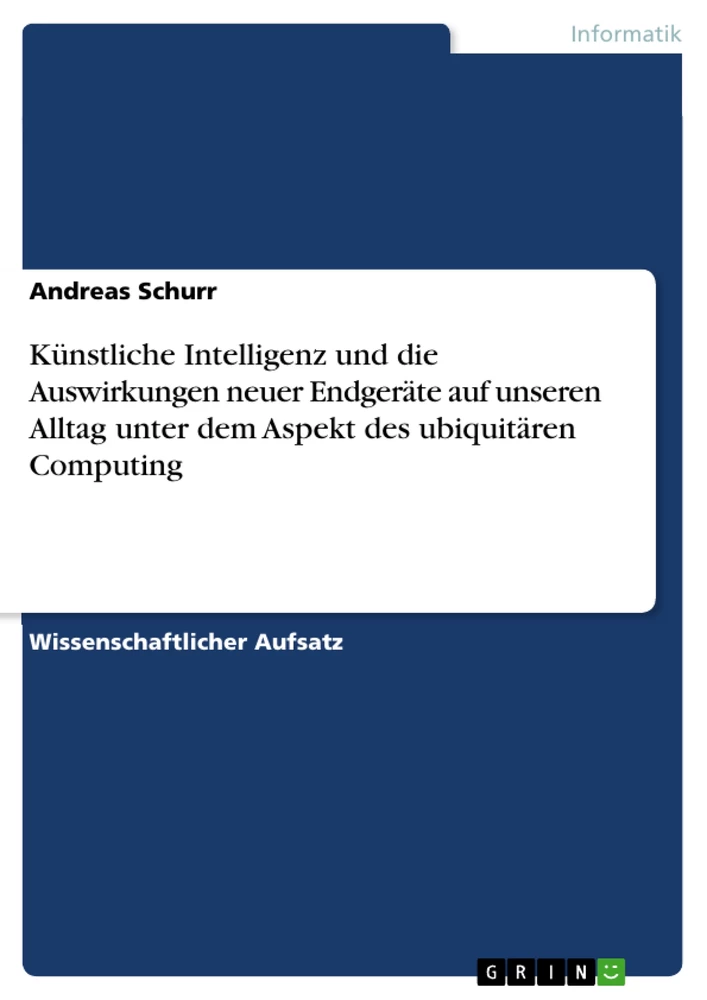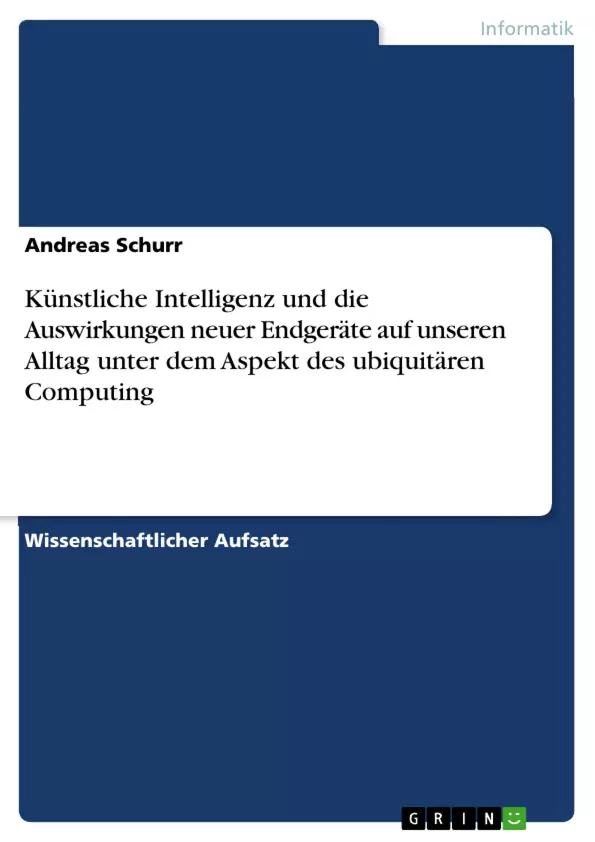Mit dem richtigen Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) kann das Leben vieler Menschen verbessert werden. Hierfür ist die Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und der Gesellschaft elementar, um offene Fragen diskutieren sowie Chancen und Risiken der Technologie ergründen zu können. Ebenso müssen bei der Forschung soziale, rechtliche sowie ethnische Aspekte berücksichtigt werden. Dies ermöglicht die Vorhersage von Trends sowie die Bestimmung, welche Technik angewandt werden kann und soll – aber auch wo Grenzen gesetzt werden müssen. Kernziel des Einsatzes von KI ist es Menschen zu unterstützen und nicht zu entfremden.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungs- und Tabellenverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Vorgehensweise
- Grundlagen
- Künstliche Intelligenz
- Ubiquitäres Computing
- Auswirkungen und Anwendungsbeispiele
- Aktuelle Anwendungen
- Smartwatch
- Virtueller Assistent
- Smart TV
- Zukünftige Anwendungen
- Smart Cloth
- Smart Home
- Weitere Anwendungen
- Auswirkungen
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der künstlichen Intelligenz (KI) und ihren Auswirkungen auf den Alltag unter dem Aspekt des ubiquitären Computing. Die Arbeit untersucht aktuelle und zukünftige Anwendungen von KI in Verbindung mit neuen Endgeräten und analysiert die damit verbundenen Auswirkungen. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wie KI die Interaktion mit unserer Umgebung verändert und welche Chancen und Herausforderungen sich daraus ergeben.
- Künstliche Intelligenz und ihre Entwicklung
- Ubiquitäres Computing und seine Basistechnologien
- Aktuelle und zukünftige Anwendungen von KI in Verbindung mit neuen Endgeräten
- Auswirkungen von KI auf den Alltag, insbesondere im Hinblick auf soziale, rechtliche und ethische Aspekte
- Potenziale und Risiken der KI-gestützten Technologie im Kontext des ubiquitären Computing
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit vor. Sie beleuchtet den wachsenden Einsatz von KI und die damit einhergehende Debatte über die Auswirkungen auf den Alltag. Im Anschluss werden die Grundlagen von KI und ubiquitärem Computing erläutert. Kapitel 3 beschäftigt sich mit aktuellen und zukünftigen Anwendungen von KI in Verbindung mit neuen Endgeräten, wie z. B. Smartwatches, virtuellen Assistenten und Smart Homes. Dabei werden die spezifischen Eigenschaften der Geräte sowie ihre potenziellen Auswirkungen auf den Alltag detailliert betrachtet. Abschließend werden die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst und die Forschungsfrage beantwortet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Bereiche Künstliche Intelligenz, Ubiquitäres Computing, neue Endgeräte, Smartwatches, virtuelle Assistenten, Smart Homes, Smart Cloth, Auswirkungen auf den Alltag, Chancen und Risiken, soziale, rechtliche und ethische Aspekte.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "ubiquitäres Computing" im Zusammenhang mit KI?
Es bezeichnet die Allgegenwart von Computertechnologie, die unauffällig in Alltagsgegenstände integriert ist und durch künstliche Intelligenz eine intelligente Interaktion mit der Umgebung ermöglicht.
Welche Alltagsgeräte nutzen heute bereits künstliche Intelligenz?
Typische Beispiele sind Smartwatches, virtuelle Assistenten (wie Alexa oder Siri) und Smart TVs, die durch KI personalisierte Funktionen bieten.
Welche zukünftigen Anwendungen von KI werden in der Arbeit genannt?
Die Arbeit thematisiert Entwicklungen wie "Smart Cloth" (intelligente Kleidung) und vollvernetzte "Smart Homes", die den Alltag weiter automatisieren und unterstützen sollen.
Welche ethischen und sozialen Aspekte müssen bei der KI-Forschung beachtet werden?
Es geht vor allem um den Schutz der Privatsphäre, rechtliche Verantwortlichkeiten und die Sicherstellung, dass Technik den Menschen unterstützt, statt ihn zu entfremden.
Was ist das Kernziel beim Einsatz von KI im Alltag?
Das Ziel ist es, das Leben der Menschen zu verbessern und durch intelligente Assistenzsysteme neue Möglichkeiten für Bildung und Arbeit zu schaffen.
- Quote paper
- Andreas Schurr (Author), 2020, Künstliche Intelligenz und die Auswirkungen neuer Endgeräte auf unseren Alltag unter dem Aspekt des ubiquitären Computing, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/520058