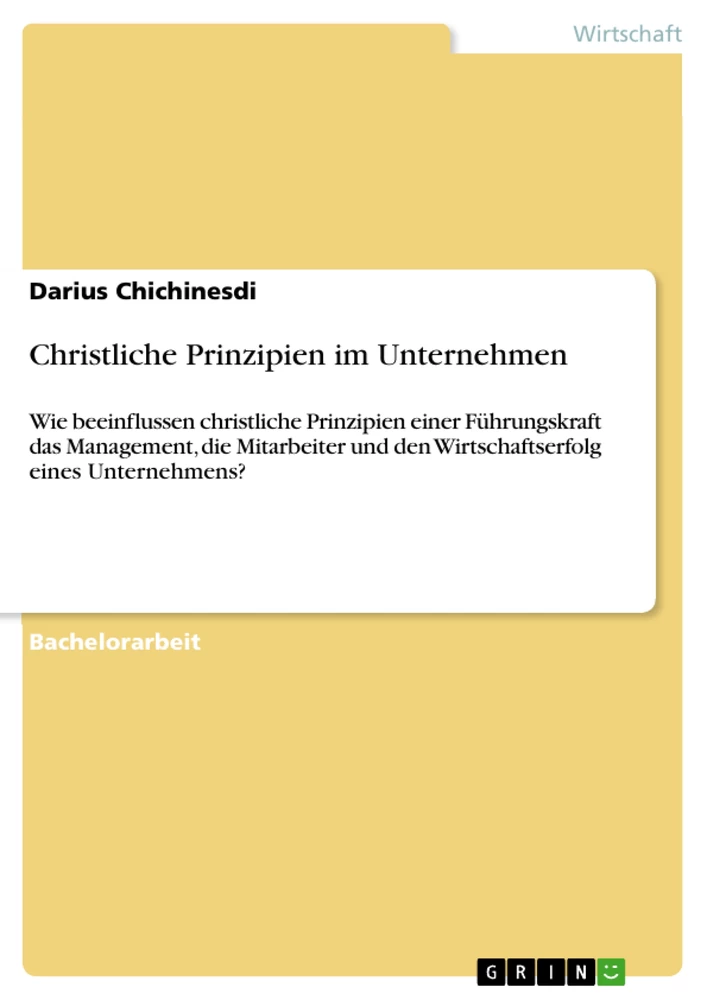Jedes Unternehmen wie auch jeder Unternehmer haben den Wunsch erfolgreich zu werden, über leistungsfähige Mitarbeiter zu verfügen und wenn möglich einen sinnvollen Nutzen für die Gesellschaft anzubieten. Die vorliegende Arbeit soll das Verhalten und die Auswirkungen der Führungspersonen auf das Unternehmen, Mitarbeiter als auch Mitbewerber analysieren, indem die Führungspersonen nach christlichen Prinzipien und Werten agieren, handeln und Entscheidungen treffen. Dabei soll herausgefunden werden, inwiefern christliche Prinzipien einer Führungskraft ein Unternehmen explizit beeinflussen und ob durch diese der Erfolg steigt oder fällt.
Der Grund dafür, diese zwei Themen, Unternehmertum und Christentum, zu verbinden, ist meine langjährige und intensive Erfahrung und Auseinandersetzung mit dem Christentum, genauso wie mein jetziges Vorhaben ein eigenes Start-up gründen zu wollen. Deswegen soll sich diese Arbeit als Durchbruch positiv auf die Leser auswirken, als auch auf jetzige oder zukünftige Führungspersonen, durch andere noch eher unbekannte Managementtheorien sowie Führungsverhaltenstheorien, wie z.B. der christlichen Unternehmensführung auch „Servant Leadership“ genannt.
Wenn man von Führungskraft spricht, dann spricht man von einem Verantwortungsträger. Sie ist der Organismus im Unternehmen, der versucht andere lebende Systeme zu beeinflussen (Verantwortungsebene – Hierarchie) und der einen wesentlichen Erfolgsfaktor für das Unternehmen darstellt. Führungskräfte sind Personen, die für die Festlegung von kurz- und langfristigen Zielen und deren Ergebnisse verantwortlich sind. Leadership bedeutet aber mehr als nur Mitarbeiterführung. Es bedeutet ein Vorbild zu sein, Vertrauen aufzubauen, Ziele und Perspektiven zu vermitteln, für zwischenmenschliche Beziehungen und aber auch für Erfolge sorgen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Fragestellung
- Einleitung
- Vorwort
- Begriffserklärung und -definition
- Unternehmen
- Unternehmenskultur
- Unternehmenserfolg
- Führungskraft/Leadership
- Christentum
- Spiritualität
- Sinnorientierung
- Theoretischer Hintergrund
- Erläuterung der Theorie
- Überblick von Wirtschaft und Religion
- Wirtschaftsethik
- Unternehmensethik
- Corporate Social Responsibility
- Unternehmensführung nach christlichen Prinzipien
- Spiritualität in der Unternehmensführung
- Erläuterung der Theorie
- Methodik
- Datenerhebung
- Vorteile der verwendeten Methode
- Sampling
- Interview
- Datenanalyse
- Kategoriebildung
- Resultate und Diskussion
- K1 - Bedeutung des „,Christlichen“
- K2 - Betrachtungsweise einer christlichen Unternehmensführung
- K3 – Christliche Prinzipien und Ansätze im Unternehmen
- K 3.1 Spiritualität im Unternehmen
- K4-Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- K5 - Erfolg durch christliches Wertesystem
- K 5.1 – Einfluss auf die Sinnorientierung im Unternehmen
- K6 - persönliches Empfinden
- Konklusion und Aussicht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, wie christliche Prinzipien einer Führungskraft das Management, die Mitarbeiter und den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens beeinflussen. Zudem wird untersucht, ob Spiritualität zu einem besseren Unternehmenserfolg beitragen kann und wie sich christliche Prinzipien auf die Sinnorientierung aller Beschäftigten im Unternehmen auswirken.
- Die Auswirkungen christlicher Führungsprinzipien auf das Management und die Mitarbeiter eines Unternehmens
- Der Einfluss von Spiritualität auf den Unternehmenserfolg
- Die Rolle christlicher Prinzipien in der Gestaltung der Unternehmenskultur
- Die Bedeutung von Sinnorientierung für die Mitarbeiter im Kontext christlicher Werte
- Die Verbindung von Wirtschaftsethik und christlichen Prinzipien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und definiert wichtige Begriffe wie Unternehmen, Unternehmenskultur, Unternehmenserfolg, Führungskraft, Christentum, Spiritualität und Sinnorientierung. Das Kapitel „Theoretischer Hintergrund“ beleuchtet die Verbindung von Wirtschaft und Religion, sowie die Themen Wirtschaftsethik, Unternehmensethik, Corporate Social Responsibility, Unternehmensführung nach christlichen Prinzipien und Spiritualität in der Unternehmensführung. Die Methodik des Projekts wird im nächsten Kapitel beschrieben, wobei die Datenerhebung, die Vorteile der verwendeten Methode, das Sampling, das Interview und die Datenanalyse im Detail behandelt werden. Schließlich präsentiert das Kapitel „Resultate und Diskussion“ die Ergebnisse der Untersuchung anhand der Kategorien K1 bis K6, wobei die Bedeutung des „Christlichen“, die Betrachtungsweise einer christlichen Unternehmensführung, die Anwendung christlicher Prinzipien und Ansätze im Unternehmen, die Zufriedenheit der Mitarbeiter, der Erfolg durch christliches Wertesystem und das persönliche Empfinden der Interviewten beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen christliche Prinzipien, Führungskraft, Management, Mitarbeiter, Unternehmenserfolg, Spiritualität, Sinnorientierung, Wirtschaftsethik, Unternehmensethik, Corporate Social Responsibility und Unternehmenskultur.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „Servant Leadership“ im christlichen Kontext?
Servant Leadership (dienende Führung) ist ein Führungsmodell, bei dem die Führungskraft als Vorbild agiert, Vertrauen aufbaut und das Wohl der Mitarbeiter sowie den Sinn des Unternehmens in den Vordergrund stellt.
Wie beeinflussen christliche Prinzipien den Unternehmenserfolg?
Die Arbeit untersucht, ob werteorientiertes Handeln und Entscheidungen nach christlichen Maßstäben die Leistungsfähigkeit und den langfristigen Erfolg steigern oder mindern.
Welche Rolle spielt Spiritualität in der Unternehmensführung?
Spiritualität wird als Faktor für Sinnorientierung betrachtet, der die Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöhen und eine positive Unternehmenskultur fördern kann.
Was ist Corporate Social Responsibility (CSR) in diesem Zusammenhang?
CSR beschreibt die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, die bei christlicher Führung oft eng mit ethischen Werten und dem Dienst an der Gemeinschaft verknüpft ist.
Wie wurde die Datenerhebung für diese Arbeit durchgeführt?
Die Ergebnisse basieren auf einer methodischen Datenanalyse, die Interviews mit Führungspersonen einbezieht, um die praktische Umsetzung christlicher Werte zu prüfen.
- Quote paper
- Darius Chichinesdi (Author), 2020, Christliche Prinzipien im Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/520102