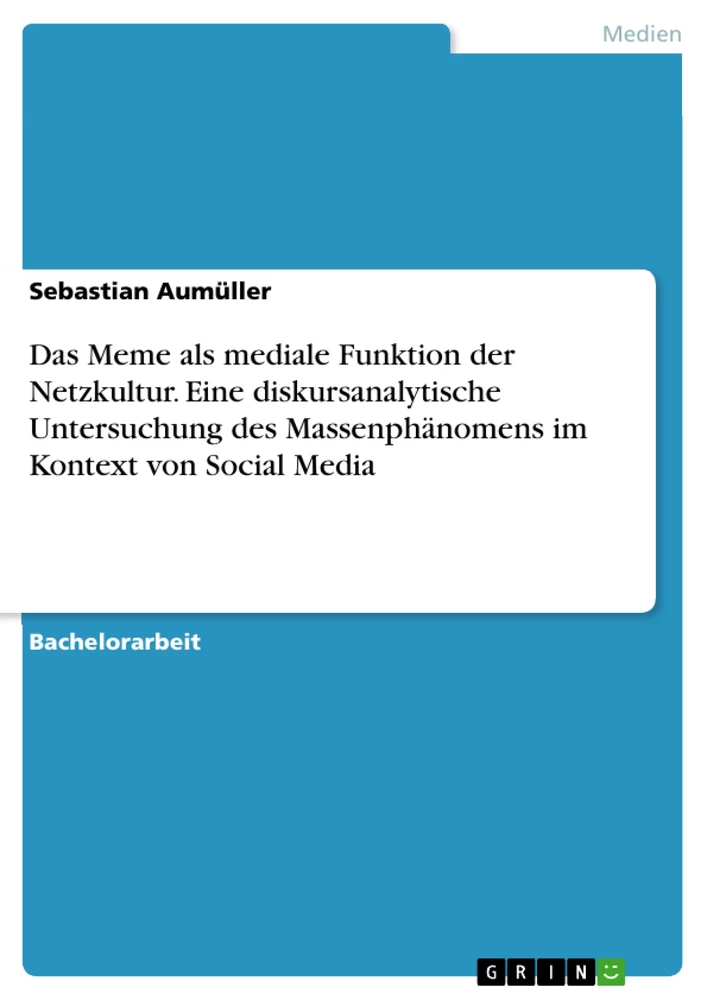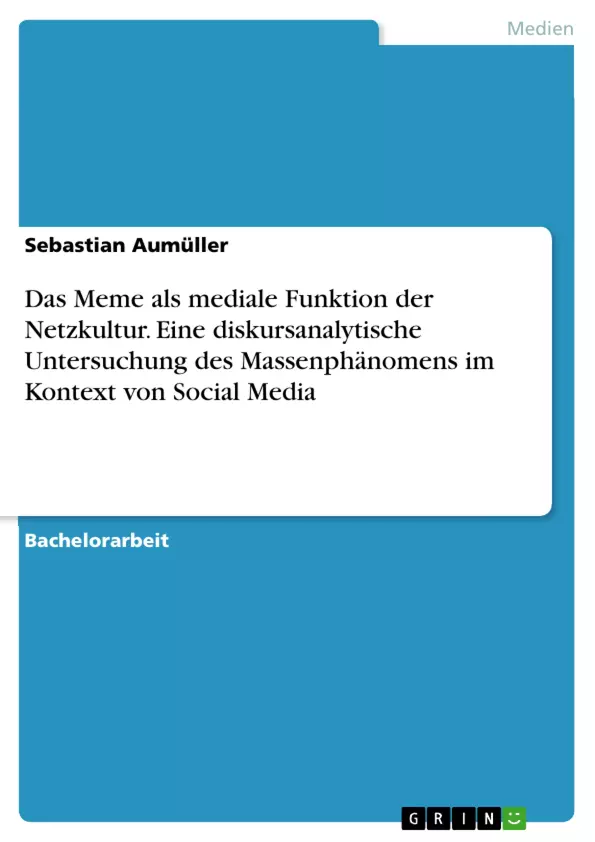Diese Bachelorarbeit versucht zu ergründen, wie sich Memes als neue globale Sprache der globalen Massenkultur etablieren konnten. Analytisch wird der Funktions- und Bedeutungswandel des Meme von seinen Ursprüngen unter Richard Dawkins als ursprünglich biologisch geprägter Begriff bis in die Gegenwart nachgezeichnet.
Dabei wird stets betrachtet, in welcher Form und Funktion sie in der Gesellschaft auftreten und wie sie sich zu einem wichtigen Kommunikationsmittel entwickeln konnten. Beispielsweise ist in sozialen Netzwerken, die von Millionen von Menschen weltweit genutzt werden und die in immer größer werdender Zahl auftreten, eine Konfrontation mit ihnen nahezu unvermeidbar und nicht nur dort, auch in anderen Medien abseits des Internets haben Memes bereits ihren Platz gefunden.
Wie kam es dazu, dass sie zu einem Kommunikationsapparat der Netzwerkgesellschaft werden konnten? Welche Bedeutung und Funktion nehmen sie in der Gesellschaft der Gegenwart ein? In welcher Form treten sie überhaupt in Erscheinung? Mit Hilfe von Texten von Richard Dawkins, Susan Blackmore, Manuel Castells, Limor Shifman und vielen weiteren Autoren, die sich im weitesten Sinne mit den Thematiken Netzwerkgesellschaft und Meme befasst haben, sollen diese und weitere Fragen aufgearbeitet und beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Mem – Über die Vielschichtigkeit eines Begriffes.
- 2. Die Geschichte der Meme
- 3. Die Analyse von Internet-Memen
- 4. Die Analyse von Memen als mediale Funktion der Netzkultur.
- 5. Fazit und Ausblick - Meme als rekontextualisierbarer Kommunikationsinhalt.
- 6. Literatur- und Internetquellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Meme und untersucht deren Funktion als mediale Elemente der Netzkultur. Mit Hilfe einer diskursanalytischen Methode wird der Mem-Begriff in seiner historischen Entwicklung und seiner gegenwärtigen Verwendung im Kontext sozialer Netzwerke analysiert.
- Die Entwicklung des Mem-Begriffes von den Theorien Richard Dawkins bis zur heutigen Verwendung
- Die Bedeutung von Mem-Ökosystemen für die Verbreitung von Memen
- Die Analyse der Wirkungsweise von Memen anhand ausgewählter Beispiele
- Die Unterscheidung zwischen mimetischer und viraler Verbreitung von Inhalten
- Die Frage, ob Meme das Potenzial haben, innerhalb der Netzkultur eine mediale Funktion einzunehmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Mem – Über die Vielschichtigkeit eines Begriffes. Dieses Kapitel führt den Leser in das Thema der Meme ein und beleuchtet die Vielschichtigkeit des Begriffs. Es werden die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten des Mem-Begriffes im Kontext der gegenwärtigen Netzkultur erläutert und die zentrale Fragestellung der Arbeit formuliert.
- Kapitel 2: Die Geschichte der Meme. Dieses Kapitel zeichnet die Entwicklung des Mem-Begriffes von seinen Ursprüngen in den Theorien Richard Dawkins bis hin zur heutigen Verwendung im Kontext der Netzkultur nach. Es werden die verschiedenen Definitionen und Interpretationen des Mem-Begriffes beleuchtet und ausgewählte Plattformen des World Wide Web vorgestellt, die einen wesentlichen Beitrag zur Verbreitung von Memen leisten.
- Kapitel 3: Die Analyse von Internet-Memen. Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Arten von Internet-Memen und geht auf die Charakteristika ein, die zu ihrer erfolgreichen Verbreitung beitragen. Es werden ausgewählte Meme analysiert, um deren Wirkungsweise und Einfluss auf die (Netz-)Kultur aufzuzeigen.
- Kapitel 4: Die Analyse von Memen als mediale Funktion der Netzkultur. Dieses Kapitel vertieft die Analyse von Memen im Kontext der Netzkultur und untersucht, inwiefern sie das Potenzial haben, sich innerhalb der Netzkultur zu einer medialen Funktion zu entwickeln. Es werden die Konzepte von Massenmedien und sozialen Medien in Bezug auf Meme diskutiert und die möglichen Folgen von Memen für die gegenwärtige Gesellschaft beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Meme, Netzkultur, Diskursanalyse, mediale Funktion, virale Verbreitung, mimetische Verbreitung, Massenmedium, soziale Medien. Diese Schlüsselwörter beschreiben die zentralen Bereiche, in denen die Arbeit angesiedelt ist und die Themen, die im Detail untersucht werden.
- Quote paper
- Sebastian Aumüller (Author), 2016, Das Meme als mediale Funktion der Netzkultur. Eine diskursanalytische Untersuchung des Massenphänomens im Kontext von Social Media, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/520118