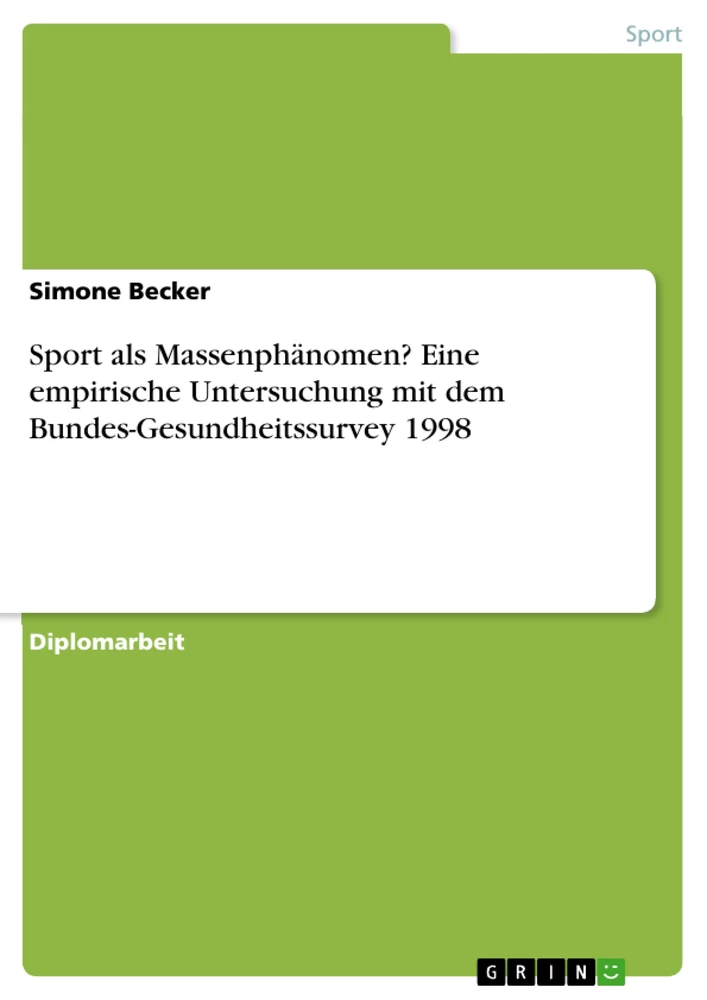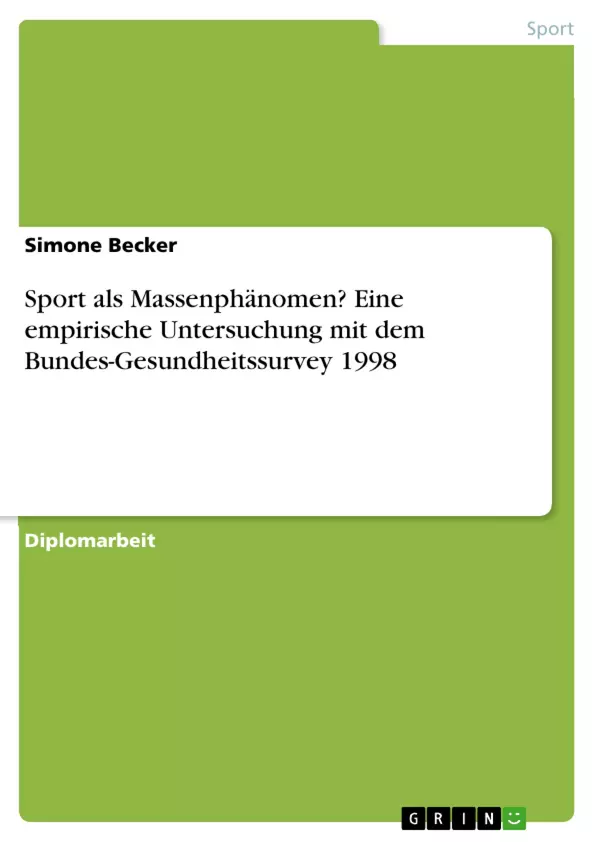Entwicklung nach dem Nationalsozialismus zwar auseinander, aber in beiden Staaten entwickelte sich der Sport gemäß Dieter Voigt zu einem „Massenphänomen“ mit großem gesellschaftlichem Einfluss. Voigt (1992) bezeichnet den Sport in modernen Gesellschaften aus zwei Gründen als „Massenphänomen“: Zum einen partizipieren heute immer mehr Personen aktiv am Sport und zum anderen werden in modernen Gesellschaften Menschen aller Soziallagen vom Sport angesprochen. Die Konstatierung des Massensports hat mehrere Autoren dazu veranlasst, von einer „Versportung der Gesellschaft“ zu sprechen. Gegenstand der Arbeit ist auf der Grundlage dieser Aussage die Untersuchung der sportlichen Betätigung der Gesamtbevölkerung in der BRD.
In der Arbeit geht es zum einen um die Frage, in welchem sozialstrukturellen Determinationszusammenhang der Sport steht und zum anderen soll aufgezeigt werden inwiefern Lebenssituation und Handlungsmuster in einem Zusammenhang zur Sportbetätigung stehen. Kann der Sport in Deutschland heute als Massenphänomen bezeichnet werden oder ist die sportliche Betätigung auch heute noch als sozialstrukturell determiniertes Phänomen zu sehen?
Um diese Frage angemessen zu beantworten, werden mögliche Einflussfaktoren sportlicher Betätigung untersucht. Der Bundes-Gesundheitssurvey 1998 stellt eine geeignete Datengrundlage dar, da die auf einer Zufallsstichprobe der deutschen Wohnbevölkerung beruhenden Daten Aussagen zur Sportbetätigung der Gesamtbevölkerung sowie eine Untersuchung verschiedenster Korrelate sportlicher Aktivität ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung und Ziel der Arbeit.
- Relevanz der Fragestellung...
- Konzeption der Arbeit...
- Theoretische Ansätze und Modelle zur Erklärung der Sportpartizipation......
- Modelle sozialer Ungleichheit: „Neue“ und „alte\" Ungleichheitsansätze
- ,,Alte\" Ungleichheiten: Konzept der sozialen Schichtung...
- ,,Neue\" Ungleichheiten: Lebensstilansatz.
- Kombination,,alter“ und „neuer“ Ungleichheiten: Allgemeines Modell zur Erklärung\ndes Freizeitverhaltens von Lamprecht & Stamm..
- Sozialisationstheoretische Ansätze.
- Schichtspezifische Sozialisation....
- Geschlechtsspezifische Sozialisation...
- Ökologische bzw. regionale Aspekte der Sozialisation
- Gesellschaftsspezifische Sozialisation.
- Trendansatz: Sport als Kultur...
- Sport aus systemtheoretischer Sicht nach Luhmann
- Sport und Sozialisation aus systemtheoretischer Sicht - Strukturen als\nDeterminanten von Sozialisationsprozessen.
- Soziale Ungleichheit im Sport aus systemtheoretischer Sicht...\n
- Ableitung und Begründung der Arbeitshypothesen
- Hypothesen zu Variablen der „alten“ und der „neuen“ Ungleichheiten.
- Hypothesen zu der Lebenssituation.....
- Hypothesen zu den Handlungsmustern
- Forschungsstand......
- Bisherige Untersuchungen zu Variablen der „alten“ und „neuen“ Ungleichheiten.
- Bisherige Untersuchungen zu Variablen der Lebenssituation
- Bisherige Untersuchungen zu Variablen der Handlungsmuster.
- Daten und Methoden
- Datenbasis.
- Stichprobe......
- Erhebungsablauf..\n
- Operationalisierungen.
- Abhängige Variable: Sportbetätigung.
- Unabhängige Variablen.
- Kontrollvariablen...\n
- Vorgehen bei der Analyse und Analyseverfahren.
- Darstellung der Ergebnisse
- Deskriptive univariate Analyse der Sportbetätigung
- Bivariate Analysen...\nHandlungsmuster.
- Multivariate Analysen....
- Diskussion der Ergebnisse
- Korrelate sportlicher Betätigung.
- Variablen der „alten“ und „neuen“ Ungleichheiten....
- Variablen der Lebenssituation
- Variablen der Handlungsmuster..\n
- Validität und Reliabiliät der Daten
- Generalisierbarkeit der Ergebnisse..\n
- Zusammenfassung und Implikationen für die Praxis..\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Verbreitung von Sport in der deutschen Bevölkerung im Jahr 1998 und analysiert, welche Faktoren die Sportpartizipation beeinflussen. Ziel ist es, die Rolle von sozialen Ungleichheiten, Lebenssituation und Handlungsmustern für die Sportbeteiligung zu erforschen.
- Soziale Ungleichheiten und ihre Auswirkungen auf die Sportbeteiligung
- Der Einfluss der Lebenssituation auf die Sportpartizipation
- Die Rolle von Handlungsmustern für die Sportbeteiligung
- Die Relevanz von sozialen Strukturen und individuellen Entscheidungen für die Sportpartizipation
- Die empirische Untersuchung der Sportpartizipation anhand des Bundes-Gesundheitssurvey 1998
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Sportpartizipation ein und beschreibt die Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit. Anschließend werden theoretische Ansätze und Modelle zur Erklärung der Sportpartizipation vorgestellt, darunter Modelle sozialer Ungleichheit, sozialisationstheoretische Ansätze und die systemtheoretische Sicht von Luhmann. Daraufhin werden die Arbeitshypothesen abgeleitet und begründet. Im Kapitel "Forschungsstand" werden bisherige Untersuchungen zu Variablen der „alten“ und „neuen“ Ungleichheiten, der Lebenssituation und den Handlungsmustern zusammengefasst.
Das Kapitel "Daten und Methoden" beschreibt die Datenbasis, die Operationalisierung der Variablen und das Vorgehen bei der Analyse. Im Kapitel "Darstellung der Ergebnisse" werden die Ergebnisse der deskriptiven, bivariaten und multivariaten Analysen präsentiert. Die Diskussion der Ergebnisse befasst sich mit den Korrelaten sportlicher Betätigung, der Validität und Reliabilität der Daten sowie der Generalisierbarkeit der Ergebnisse. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und Implikationen für die Praxis.
Schlüsselwörter
Sportpartizipation, soziale Ungleichheit, Lebenssituation, Handlungsmuster, Bundes-Gesundheitssurvey, empirische Untersuchung, Soziologie, Sozialisation, Systemtheorie
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Sport in modernen Gesellschaften als "Massenphänomen" bezeichnet?
Weil immer mehr Personen aktiv teilnehmen und Menschen aller Soziallagen angesprochen werden, was oft als "Versportung der Gesellschaft" bezeichnet wird.
Was ist der Bundes-Gesundheitssurvey 1998?
Es handelt sich um eine repräsentative Zufallsstichprobe der deutschen Wohnbevölkerung, die als Datengrundlage dient, um die Sportbetätigung und deren Korrelate zu untersuchen.
Welchen Einfluss hat die soziale Schichtung auf den Sport?
Trotz der Entwicklung zum Massensport zeigen Untersuchungen oft, dass die sportliche Betätigung weiterhin sozialstrukturell determiniert ist, also von Faktoren wie Bildung und Einkommen abhängt.
Was ist der Lebensstilansatz bei der Sportpartizipation?
Dieser Ansatz betrachtet Sport nicht nur über die soziale Schicht, sondern als Teil individueller Handlungsmuster und Lebensstile ("neue" Ungleichheiten).
Wie beeinflusst die Sozialisation das Sportverhalten?
Sozialisationstheorien untersuchen, wie geschlechts-, schicht- oder regionalspezifische Prägungen in der Kindheit und Jugend die spätere Sportbeteiligung festlegen.
- Quote paper
- Simone Becker (Author), 2004, Sport als Massenphänomen? Eine empirische Untersuchung mit dem Bundes-Gesundheitssurvey 1998, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52012