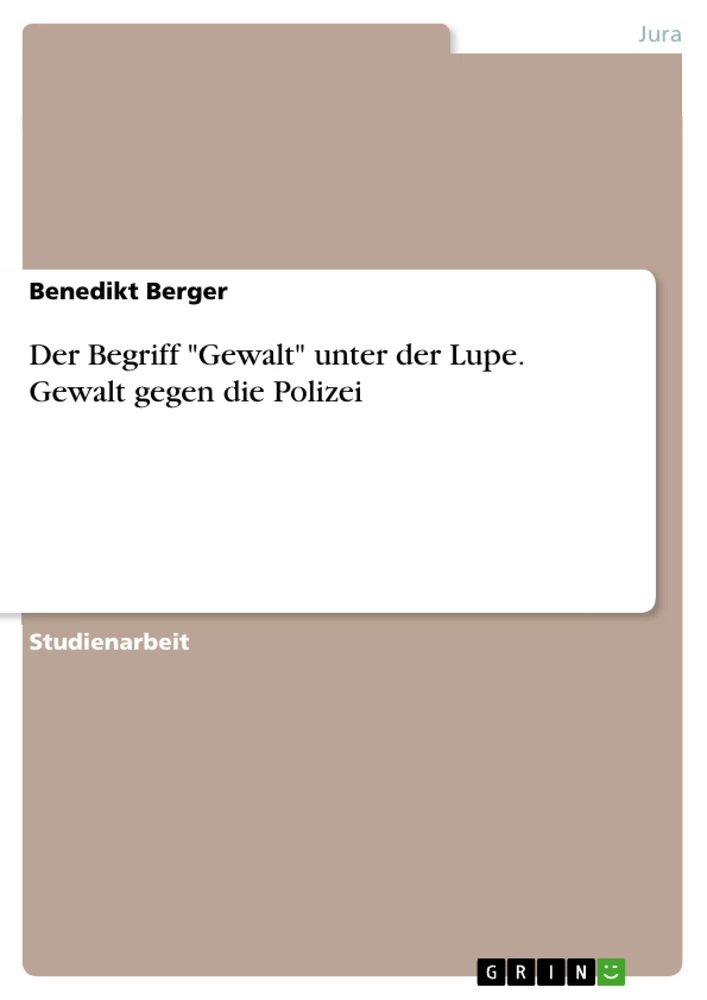Das Thema „Gewalt“ gehört sicher zu den hochkontroversen Themen der Postmoderne, denn sie ist unterhaltsam und abstoßend zugleich.“
In der Seminararbeit geht der Verfasser auf das Thema „Polizeigewalt“ in der Gesellschaft ein. Dabei wird das staatliche Gewaltmonopol Polizei aus verschiedenen Blickwinkeln dargestellt und verschiedene Erfahrungen erläutert. Zum einen wird der Verfasser den Begriff der „Gewalt“ im Zusammenhang mit Polizeibeamten erläutern, sodass der Leser im Anschluss genau weiß, inwieweit eine Polizeiliche Maßnahme zur Gewalt zählt. Außerdem wird auf die „Serie Polizeigewalt“ aus der Onlinezeitung „Zeit Online“ eingegangen. In dem einige Leserbriefe in die Seminararbeit aufgenommen werden, wird die Sichtweise einiger Bürger dargelegt. Es wird dadurch ersichtlich, wie unterschiedlich Gewalt wahrgenommen wird und ab wann es sich um Polizeigewalt handelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff „Gewalt“
- Was genau ist Gewalt?
- Gewalt im Zusammenhang mit dem Gewaltmonopol Staat
- Polizeilicher Umgang mit dem Thema Gewalt
- Steigt die Gewalt in Deutschland?
- Steigt die Anzahl der Gewalttaten im Allgemeinen?
- Steigt die Gewalt gegen die Polizei?
- Erkenntnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit dem kontroversen Thema Gewalt, insbesondere im Zusammenhang mit dem Gewaltmonopol des Staates und der Polizei. Die Arbeit analysiert den Gewaltbegriff, beleuchtet den polizeilichen Umgang mit Gewalt und stellt die Frage, ob die Gewalt in Deutschland im Allgemeinen und gegen die Polizei im Speziellen steigt.
- Begriffsbestimmung von Gewalt
- Gewalt im Kontext des Gewaltmonopols des Staates
- Polizeilicher Umgang mit Gewalt und die Frage der Legitimität
- Statistische Entwicklungen zu Gewalt in Deutschland
- Persönliche Erkenntnisse zum Thema Gewalt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Text beginnt mit der Feststellung, dass Gewalt ein kontroverses Thema ist, das sowohl Faszination als auch Abstoßung hervorruft. Die Einleitung skizziert die Themenschwerpunkte des Textes und stellt den Zusammenhang von Gewalt und Polizei in den Mittelpunkt.
Der Begriff „Gewalt“
Dieses Kapitel widmet sich der Definition von Gewalt. Es werden verschiedene Definitionen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen vorgestellt und die Bedeutung von Gewalt im Kontext des Gewaltmonopols des Staates, insbesondere der Polizei, erläutert.
Polizeilicher Umgang mit dem Thema Gewalt
In diesem Kapitel wird der Umgang der Polizei mit Gewalt und der rechtliche Rahmen für den Einsatz von Gewalt durch den Staat beleuchtet. Es wird untersucht, wie die Polizei mit Gewaltumständen umgeht und welche gesetzlichen Vorgaben dabei zu beachten sind.
Steigt die Gewalt in Deutschland?
Dieses Kapitel untersucht die Frage, ob die Gewalt in Deutschland im Allgemeinen und gegen die Polizei im Speziellen steigt. Es werden statistische Daten und Entwicklungen in den letzten Jahren analysiert.
Schlüsselwörter
Gewalt, Gewaltmonopol, Staat, Polizei, Recht, Legitimität, Aggressivität, Statistik, Entwicklung, Deutschland
Häufig gestellte Fragen
Was wird in dieser Arbeit unter „Polizeigewalt“ verstanden?
Die Arbeit untersucht, ab wann eine polizeiliche Maßnahme als Gewalt gilt und wie die Grenze zwischen rechtmäßiger Gewaltanwendung und Gewaltmissbrauch gezogen wird.
Was bedeutet das staatliche Gewaltmonopol?
Es bedeutet, dass grundsätzlich nur der Staat (vertreten durch die Polizei) das Recht hat, physische Gewalt zur Durchsetzung der Rechtsordnung anzuwenden.
Steigt die Gewalt gegen Polizisten in Deutschland?
Die Seminararbeit analysiert statistische Daten, um zu klären, ob die Anzahl der Gewalttaten gegen Beamte in den letzten Jahren zugenommen hat.
Wie nehmen Bürger Polizeigewalt wahr?
Anhand von Leserbriefen aus „Zeit Online“ zeigt der Verfasser die unterschiedlichen Perspektiven und Empfindungen der Bevölkerung zum Thema auf.
Ist Gewalt in der Postmoderne ein unterhaltsames Thema?
Das Abstract stellt fest, dass Gewalt ein hochkontroverses Thema ist, das oft gleichzeitig als abstoßend und (medial) unterhaltsam wahrgenommen wird.
- Arbeit zitieren
- Benedikt Berger (Autor:in), 2015, Der Begriff "Gewalt" unter der Lupe. Gewalt gegen die Polizei, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/520330