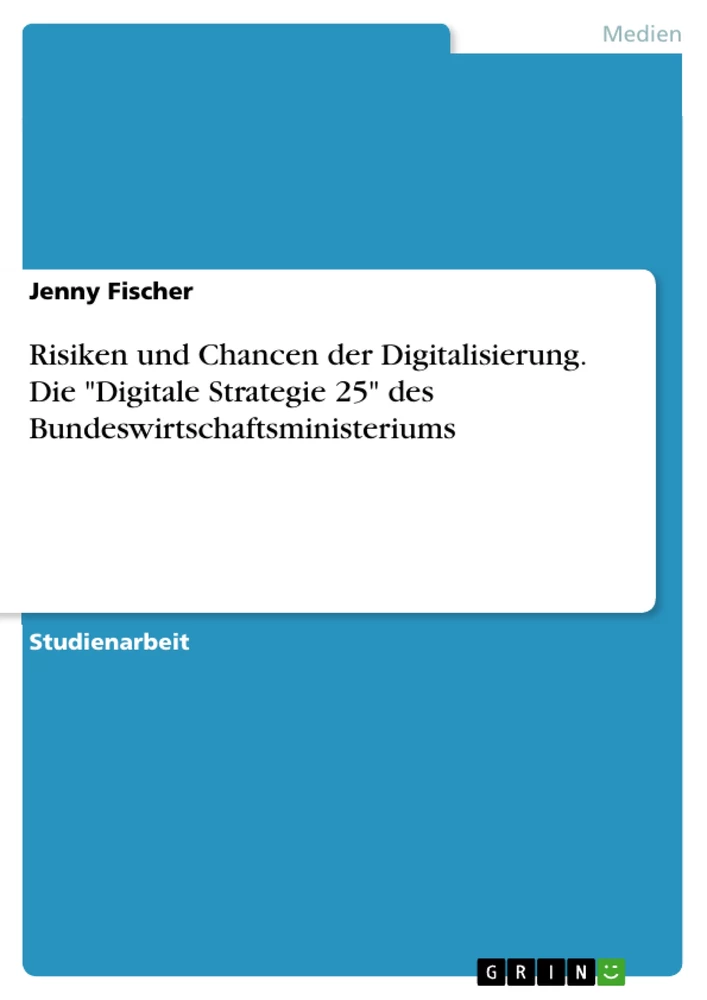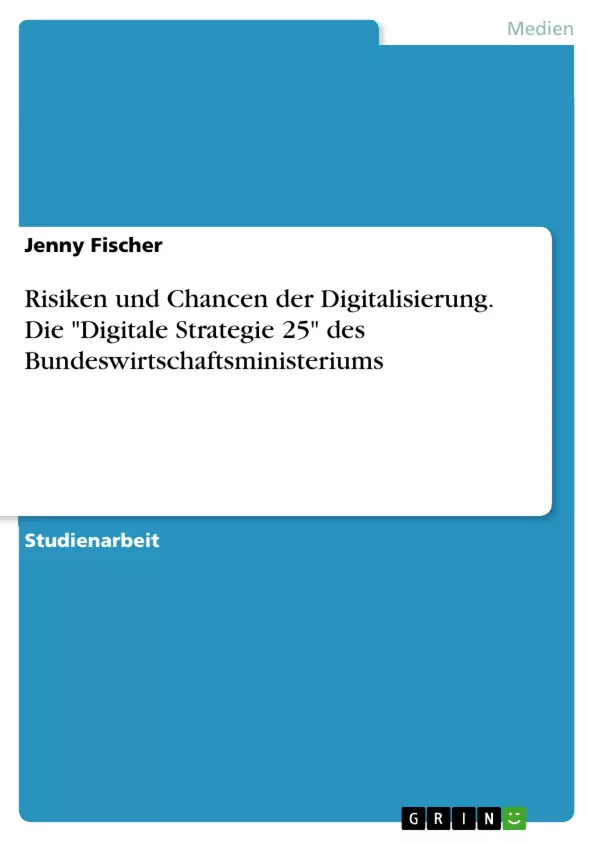Die Arbeit beschreibt, mit welchen Maßnahmen das Bundeswirtschaftsministerium die Digitalisierung vorantreibt, um Deutschland im digitalen Wettbewerb konkurrenzfähiger zu machen.
Das Bundeskabinett hat mit der "Digitalen Strategie 2025" einen Leitfaden ausgearbeitet, der eine Orientierung bei der Entwicklung der deutschen Digitalpolitik bis spätestens 2025 gibt. Zunächst werden thematische Schwerpunkte und deren Relevanz innerhalb der Strategie analysiert. Im Anschluss werden zentrale Punkte des mit der "Digitalen Strategie" zusammenhängenden Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende erörtert. Anhand von zwei Beispielen lässt sich zeigen, wie deutsche Unternehmen im digitalen Wettbewerb aufholen und international erfolgreich werden können. Darauf folgt eine Diskussion zu potenziellen Risiken und Chancen der Digitalisierung. Hierbei wird auch die am 25. Mai in Kraft getretene europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) berücksichtigt.
Facebook-Datenskandal, medizinische Ersatzteile aus dem 3D-Drucker, vollautomatisierte Autos: Die digitale Zukunft hat längst begonnen und überfordert mit ihrem Tempo viele Menschen. Daher stellt sich die Frage, wie einerseits mit den Entwicklungen, die die Digitalisierung bringt, Schritt gehalten werden kann. Andererseits muss hinterfragt werden, wie sich die geforderte Verantwortung für diese Entwicklungen übernehmen lässt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. „Digitale Strategie 2025\": thematische Schwerpunkte und deren Relevanz
- 2.1. Gigabit-Glasfasernetz
- 2.2. Unterstützung von Start-Ups, Unternehmenskooperationen
- 2.3. Ordnungsrahmen für Investitionen und Innovationen
- 2.4. Intelligente Vernetzung
- 2.5. Datensicherheit und Datensouveränität
- 2.6. Neue Geschäftsmodelle
- 2.7. Modernisierung des Produktionsstandorts Deutschland
- 2.8. Digitale Technologien: Förderung von F&E und Innovation
- 2.9. Digitale Bildung in allen Lebensphasen
- 2.10. Gründung einer Digitalagentur
- 3. Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende
- 3.1. Einführung intelligenter Messsysteme
- 3.2. Datenschutz- und Datensicherheit bei Smart Meter
- 4. Digitaler Wettbewerb: Vorschläge für internationalen Erfolg deutscher Unternehmen
- 4.1. Beispiele
- 4.1.1. BASF
- 4.1.2. Adidas
- 4.2. Fazit
- 4.1. Beispiele
- 5. Diskussion: Risiken vs. Chancen durch die Digitalisierung
- 5.1. Risiken
- 5.1.1. Datenschutz, -souveränität und Kriminalität
- 5.1.2. Exkurs: EU-DSGVO
- 5.1.3. Risiken für Handel und Beschäftigung
- 5.2. Chancen
- 5.2.1. (Weiter-)Bildung
- 5.2.2. Industrie 4.0 und KMUS
- 5.2.3. Start-Ups und Technologieunternehmen
- 5.2.4. Online-Marktplatz
- 5.2.5. International
- 5.3. Abwägung
- 5.1. Risiken
- 6. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die „Digitale Strategie 2025“ des Bundeswirtschaftsministeriums und beleuchtet deren Inhalte und Potenziale. Sie befasst sich mit den Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung für Deutschland.
- Analyse der Schwerpunkte der „Digitalen Strategie 2025“
- Bewertung der Relevanz der Strategie für die deutsche Wirtschaft
- Diskussion der Risiken und Chancen der Digitalisierung
- Bewertung des Einflusses der Digitalisierung auf die Gesellschaft
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Unternehmen und Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Digitalisierung ein und erläutert die Relevanz der „Digitalen Strategie 2025“. Kapitel 2 analysiert die thematischen Schwerpunkte der Strategie, wie Gigabit-Glasfasernetz, Unterstützung von Start-Ups und Unternehmenskooperationen sowie Datensicherheit und Datensouveränität. Kapitel 3 befasst sich mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, insbesondere der Einführung intelligenter Messsysteme und des Datenschutzes. Kapitel 4 beleuchtet den digitalen Wettbewerb und stellt Beispiele für den internationalen Erfolg deutscher Unternehmen vor. Kapitel 5 diskutiert die Risiken und Chancen der Digitalisierung, einschließlich Datenschutzbedenken, Industrie 4.0 und Start-Ups.
Schlüsselwörter
Digitalisierung, Digitale Strategie 2025, Bundeswirtschaftsministerium, Gigabit-Glasfasernetz, Start-Ups, Unternehmenskooperationen, Datensicherheit, Datensouveränität, Energiewende, Smart Meter, Digitaler Wettbewerb, Industrie 4.0, Risiken, Chancen.
- Arbeit zitieren
- Jenny Fischer (Autor:in), 2018, Risiken und Chancen der Digitalisierung. Die "Digitale Strategie 25" des Bundeswirtschaftsministeriums, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/520466