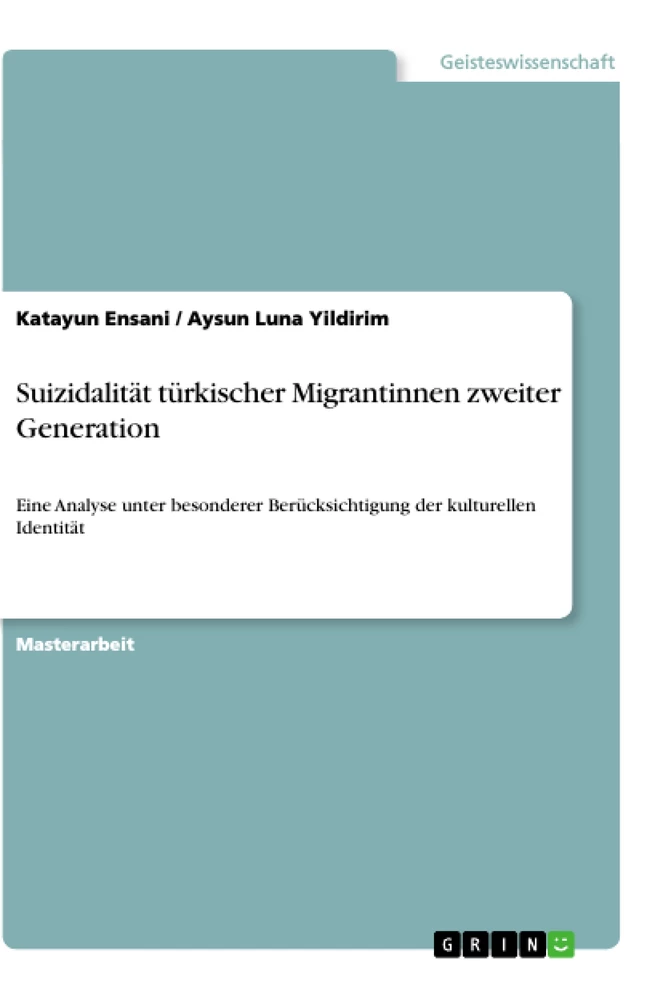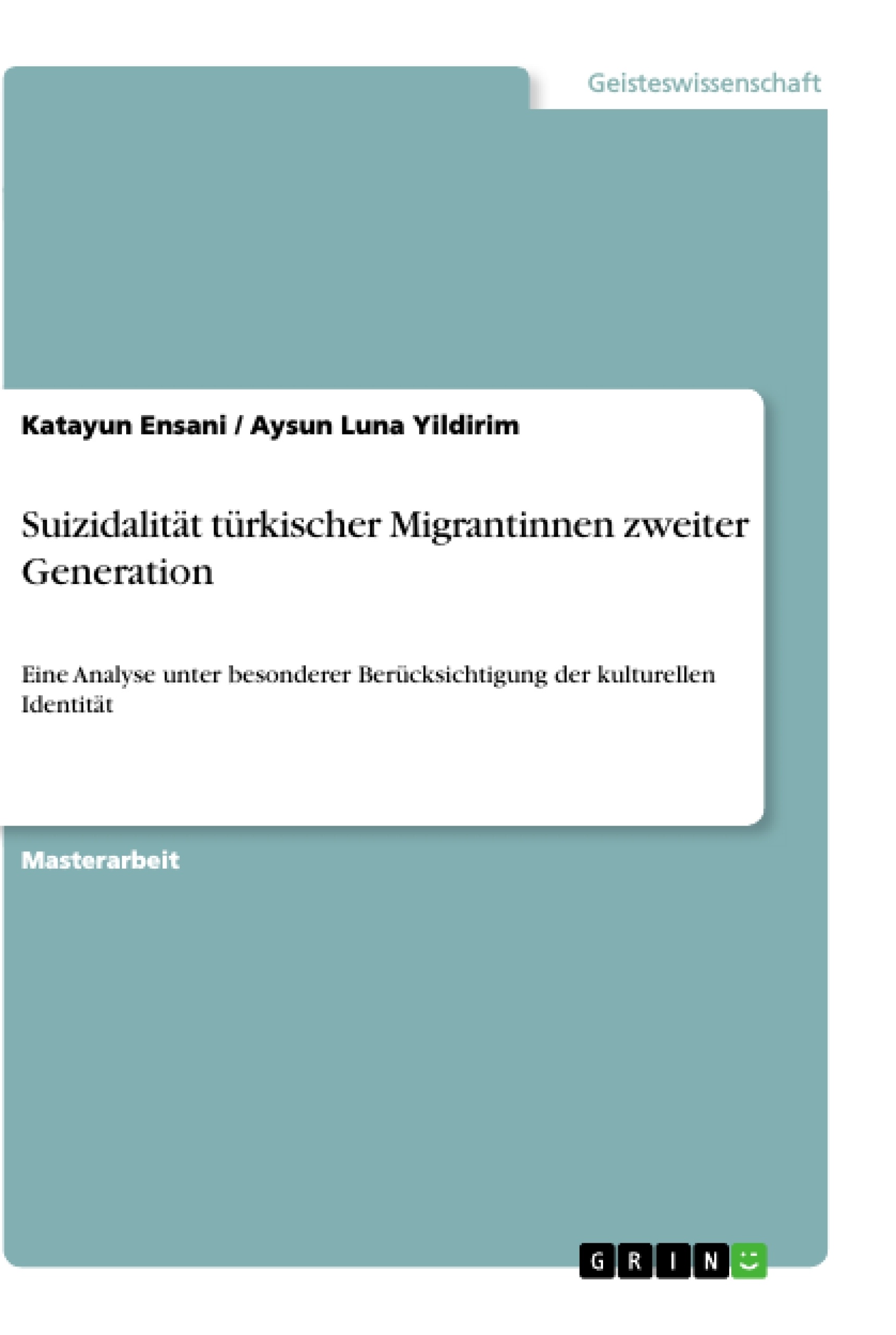Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Suizidalität türkischer Migrantinnen zweiter Generation, ihrem Aufwachsen in zwei kulturellen Kontexten und den damit einhergehenden Konflikten in der Identitätsbildung. Theorien und Modelle zur Suizidalität werden vorgestellt, dabei wird ein Bezug auf die weibliche Suizidalität hergestellt. Des Weiteren werden kulturspezifische Faktoren und abweichende Lebenskontexte der Migrantinnen zweiter Generation ausführlich beschrieben, da diese die Grundlage der Identitätskonstruktion und -bildung darstellen.
Anschließend werden Identitätstheorien, die sich hauptsächlich auf die Themenbereiche der Kultur und Migration anwenden lassen, vorgestellt. Zur genaueren Untersuchung wurden qualitative Interviews mit türkischen Migrantinnen zweiter Generation, die von suizidalen Krisen betroffen waren, geführt. Die Interviews wurden tiefenhermeneutisch ausgewertet und die Ergebnisse deuten darauf hin, dass bei dieser Zielgruppe der Misserfolg der Integration beider Kulturen einen zusätzlichen Risikofaktor für Suizidalität darstellen kann.
Das Thema Migration nimmt seit der 2015 als „Flüchtlingskrise“ bezeichneten Welle an Menschen, die in Folge von zum Teil sehr prekären Lebensbedingungen aus meist muslimisch geprägten Ländern nach Deutschland kamen, immer mehr an Bedeutung zu. Allein im Jahr 2016 betrug die Anzahl der Asylanträge 745.545 (BAMF, 2016). Der Anteil der in Deutschland lebenden Ausländern steigt somit stetig. Doch große Migrationswellen gab es in Deutschland schon vor 2015. Im Rahmen des Anwerbeabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei im Jahr 1961 kamen viele Türken nach Deutschland, um das Land nach dem Krieg bei dem Wiederaufbau zu unterstützen. Durch dieses Anwerbeabkommen kamen allein zwischen den Jahren 1961 und 1974 2,5 Millionen Menschen aus der Türkei nach Deutschland. Durch die Familienzusammenführung 1974 hatten die sogenannten „Gastarbeiter“ die Möglichkeit ihre Familien nach Deutschland zu holen und sich hier langfristig ein Leben aufzubauen (ebd.).
Die unterschiedlichen Akkulturationsstrategien der Migrierten und der Mitglieder der Aufnahmegesellschaft beeinflussten die Qualität der Integration. Heute sind gelungene (bspw. Akzeptanz einer deutsch-türkischen Ehe) und noch optimierbare (bspw. gleiche Bildungs- und Berufschancen) Komponenten der Integration zu beobachten (Vieth, 2018). Vor allem im Bereich der psychischen Versorgung herrscht jedoch noch großer Bedarf.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung...
- Einleitung
- Suizidalität
- Definitionen suizidalen Verhaltens
- Epidemiologie, Risikofaktoren und protektive Faktoren
- Modelle zur Suizidalität
- Die Todestriebtheorie nach Freud
- Das Melancholiemodell nach Freud und Abraham
- Die Objektbeziehungstheorie nach Kind
- Das Krisenmodell
- Das Präsuizidale Syndrom nach Ringel
- Der Suizidwürfel
- Das interpersonale Suizidmodell
- Weibliche Suizidalität
- Abweichende Lebenskontexte bei Migrierten
- Kultur
- Die Theorie der Kulturdimensionen nach Hofstede
- Bikulturalität
- Migration
- Türkische Migrierte erster Generation
- Türkische Migrierte zweiter Generation
- Religion
- Der Islam im historischen Kontext
- Das integralistische Verständnis des Islams
- Die Rolle der Frau
- Religion in der Migration
- Erziehungsstil & Familiendynamik
- Schule
- Diskriminierung
- Migrationsspezifische Risikofaktoren psychischer Erkrankungen
- Identität
- Identitätsbildung und -konstruktion
- Kulturelle Identität
- Identität & Migration
- Empirischer Teil
- Methode
- Rekrutierung & Stichprobe
- Material
- Versuchsaufbau und -durchführung
- Auswertung & Ergebnisse
- Frau G. – „Klassenfahrt, da war ich so frei."
- Frau K.,,Ich war so verloren"
- Kulturelle Identität und ihre Auswirkungen auf die psychische Gesundheit
- Suizidalität bei Migrantinnen zweiter Generation
- Die Rolle von Kultur, Religion und Migration in der Entwicklung suizidaler Tendenzen
- Spezifische Risikofaktoren und protektive Faktoren für türkische Migrantinnen zweiter Generation
- Mögliche Ansätze zur Prävention und Intervention
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Suizidalität türkischer Migrantinnen zweiter Generation und analysiert, inwieweit die kulturelle Identität einen Einfluss auf die Genese suizidaler Tendenzen hat. Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die besonderen Herausforderungen und Belastungen dieser Gruppe zu gewinnen und mögliche Risikofaktoren sowie protektive Faktoren zu identifizieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine umfassende Einleitung und führt in die Thematik der Suizidalität ein. Im zweiten Kapitel werden verschiedene Definitionen des suizidalen Verhaltens, epidemiologische Daten, Risikofaktoren und protektive Faktoren sowie Modelle zur Erklärung von Suizidalität vorgestellt. Das dritte Kapitel widmet sich den abweichenden Lebenskontexten von Migranten und beleuchtet die Bedeutung von Kultur, Migration, Religion, Erziehungsstil, Familiendynamik, Schule, Diskriminierung und migrationsspezifischen Risikofaktoren für die psychische Gesundheit. Kapitel vier beschäftigt sich mit dem Konzept der Identität, insbesondere der kulturellen Identität und ihrer Relevanz im Kontext der Migration. Der empirische Teil in Kapitel fünf präsentiert die Methode, die Rekrutierung der Stichprobe, die Materialauswahl, den Versuchsaufbau und die Auswertung der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Suizidalität, türkische Migrantinnen, zweite Generation, kulturelle Identität, Migration, Religion, Islam, Familiendynamik, Risikofaktoren, protektive Faktoren, psychische Gesundheit, Identität, Empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die kulturelle Identität bei der Suizidalität türkischer Migrantinnen?
Die Arbeit zeigt, dass der Misserfolg bei der Integration beider kultureller Kontexte ein zusätzlicher Risikofaktor für Suizidalität sein kann, da er die Identitätsbildung erschwert.
Was sind migrationsspezifische Risikofaktoren für psychische Erkrankungen?
Dazu gehören Diskriminierung, abweichende Lebenskontexte in der zweiten Generation, Konflikte zwischen traditionellen Erziehungsstilen und westlichen Werten sowie religiöse Spannungsfelder.
Welche psychologischen Modelle zur Suizidalität werden in der Arbeit vorgestellt?
Es werden unter anderem die Todestriebtheorie nach Freud, das Präsuizidale Syndrom nach Ringel, das Krisenmodell und das interpersonale Suizidmodell behandelt.
Wie unterscheidet sich die Suizidalität bei Frauen?
Die Arbeit stellt einen spezifischen Bezug zur weiblichen Suizidalität her und beleuchtet dabei insbesondere die Rolle der Frau im Kontext von Migration und Religion.
Was ergab die qualitative Untersuchung der Interviews?
Die tiefenhermeneutische Auswertung deutet darauf hin, dass Gefühle von "Verlorensein" und die Freiheitseinschränkungen (z.B. bei Klassenfahrten) zentrale Krisenmomente darstellen.
- Quote paper
- Katayun Ensani (Author), Aysun Luna Yildirim (Author), 2019, Suizidalität türkischer Migrantinnen zweiter Generation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/520582