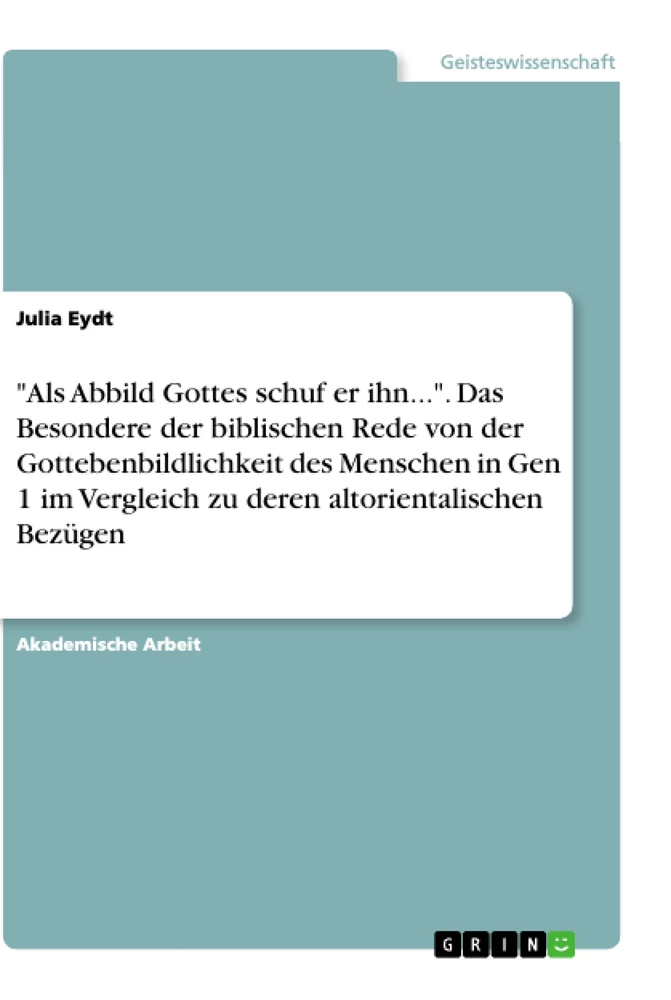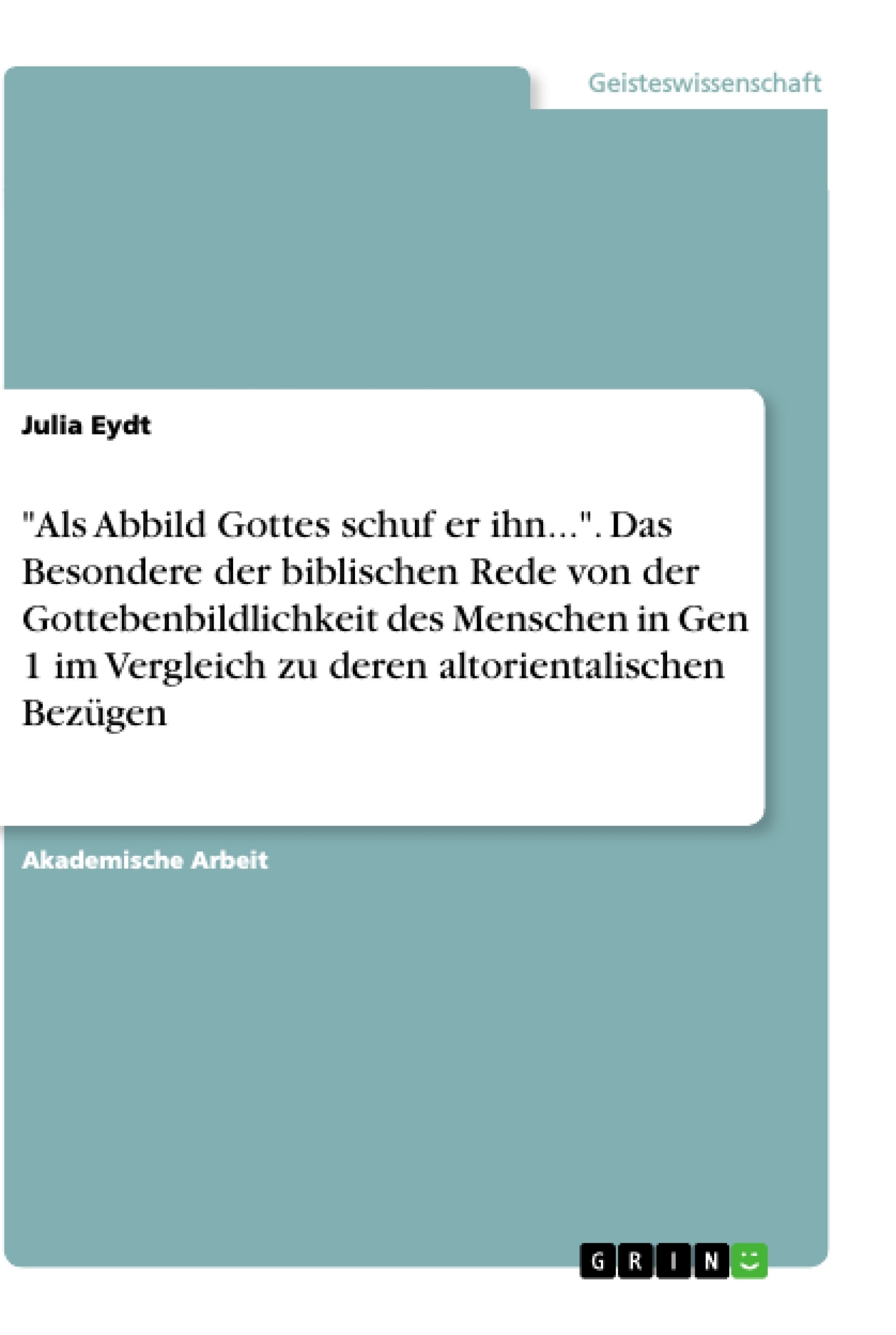Die Relevanz der Frage nach der Gottebenbildlichkeit des Menschen fand in der Vergangenheit insbesondere Berücksichtigung zur Begründung und Verteidigung der unveräußerlichen Würde des Menschen und zieht innerhalb der christlichen Anthropologie eine bis heute unangetastete Rechtfertigung der menschlichen Würde nach sich. Beachtet man den jüdisch-christlichen Kontext zuerst, leitet sich die Gottebenbildlichkeit im Wesentlichen von den theologischen Aussagen der Priesterschrift im hebräischen Testament ab sowie von einer weiteren alttestamentlichen Vergleichsstelle in Ps 8, die die Ähnlichkeit des Menschen mit seinem Schöpfer betont, doch in der Rezeptionsgeschichte meist hinter der Genesis zurücksteht. Dass die Vorstellung, wonach der Mensch Ebenbild Gottes, imago dei, ist, d.h. nach seinem Abbild geschaffen wurde, nicht erst mit Aufzeichnung der priesterlichen Schrift ihren Niederschlag fand, beweisen zahlreiche Überlieferungen aus dem altorientalischen Kontext. Die Umwelt des Alten Testaments verfügte über komplexe Mythologien, die von verschiedenen Theogonien, über die Schöpfung des Kosmos bishin zur Erklärung der menschlichen Schöpfung reichen, wie wir sie in eindrücklicher Darstellung vor allem in Mesopotamien vorfinden. Die Schöpfungsakte sind somit untrennbar mit dem Menschenbild verbunden, weshalb auch diese Überlieferungen, sowohl aus der mesopotamischen wie der ägyptischen Tradition essentiell für ein vertieftes Verstehen dieses Zusammenhanges sind. Sie bilden die Grundlage für ein vollumfängliches Verständnis vom Gott- Mensch-Zusammenhang der altorientalischen Umwelt und deren Motiven, die auch das Alte Testament inspiriert haben (könnten).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gottebenbildlichkeit im Alten Testament
- 2.1 Der Schöpfungsakt des Menschen in Gen 1
- 2.2 dominum terrae- Der Herrschaftsauftrag des Menschen in Gen 1,28-29
- 2.3 Gottebenbildlichkeit in den alttestamentlichen Vergleichsstellen von Gen 5,3; 9,6 und Ps 8
- 2.4 Sprachliche Besonderheiten
- 2.4.1 slm und dmwt
- 3. Vorstellungen der Gottebenbildlichkeit im Alten Ägypten
- 3.1 Die Menschenschöpfung
- 3.1.1 Hymnus an Ptah
- 3.1.2 Der Amon-Hymnus
- 3.2 Der König als Gottheit- die altägyptische Königsideologie
- 3.3 Herrschaft und Beauftragung
- 4. Das Menschenbild in Mesopotamien in Bezug zu Menschenschöpfung und Abbild Gottes-Konzeption
- 4.1 Der Mensch in den Schöpfungsmythen
- 4.1.1 Enuma eliš
- 4.1.2 Atramhasis-Epos
- 4.1.3 Der Lullu-und der Maliku-Mensch
- 4.2 Königsideologie und Gottesstatuenmetapher in Mesopotamien
- 4.2.1 Die Statue des Hadad Yisi in Tel Fekherije
- 5. Schlussreflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Bedeutung der Gottebenbildlichkeit des Menschen im Alten Testament im Vergleich zu altorientalischen Überlieferungen. Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den jeweiligen Vorstellungen von der Menschenschöpfung und dem Abbild Gottes aufzuzeigen und die Besonderheit der biblischen Sichtweise hervorzuheben.
- Die Schöpfungsgeschichte im Alten Testament und ihre Bedeutung für das Verständnis der menschlichen Würde.
- Der Herrschaftsauftrag des Menschen (dominum terrae) im Kontext der biblischen Schöpfungsgeschichte.
- Vergleichende Analyse der altorientalischen Vorstellungen von der Gottebenbildlichkeit in Ägypten und Mesopotamien.
- Untersuchung der Königsideologie und deren Einfluss auf die göttlich-menschliche Beziehung in Ägypten und Mesopotamien.
- Die Rolle der Gottesstatuenmetapher in der altorientalischen Religion und ihre Relevanz für das Verständnis der Gottebenbildlichkeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Gottebenbildlichkeit ein und beleuchtet deren Relevanz in der Geschichte der Anthropologie. Es werden die zentralen Quellen im Alten Testament sowie die Bedeutung altorientalischer Vergleichsstellen dargestellt.
Kapitel 2 befasst sich mit der Gottebenbildlichkeit im Alten Testament, insbesondere mit dem Schöpfungsakt in Gen 1 und dem Herrschaftsauftrag des Menschen. Weiterhin werden die alttestamentlichen Vergleichsstellen in Gen 5,3; 9,6 und Ps 8 untersucht und sprachliche Besonderheiten analysiert.
Kapitel 3 widmet sich den altorientalischen Vorstellungen der Gottebenbildlichkeit im Alten Ägypten. Hierbei werden sowohl die Schöpfungsmythen als auch die altägyptische Königsideologie und die Rolle des Königs als Gottheit untersucht.
Kapitel 4 befasst sich mit dem Menschenbild in Mesopotamien im Kontext der Schöpfungsmythen und der Abbild Gottes-Konzeption. Es werden verschiedene Mythen wie Enuma eliš und der Atramhasis-Epos analysiert sowie die mesopotamische Königsideologie und die Gottesstatuenmetapher beleuchtet.
Schlüsselwörter
Gottebenbildlichkeit, Schöpfungsgeschichte, Altes Testament, Menschenschöpfung, Herrschaftsauftrag, altorientalische Religion, Ägypten, Mesopotamien, Königsideologie, Gottesstatuenmetapher, Hymnus an Ptah, Amon-Hymnus, Enuma eliš, Atramhasis-Epos, dominum terrae.
- Quote paper
- Julia Eydt (Author), 2016, "Als Abbild Gottes schuf er ihn...". Das Besondere der biblischen Rede von der Gottebenbildlichkeit des Menschen in Gen 1 im Vergleich zu deren altorientalischen Bezügen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/520588