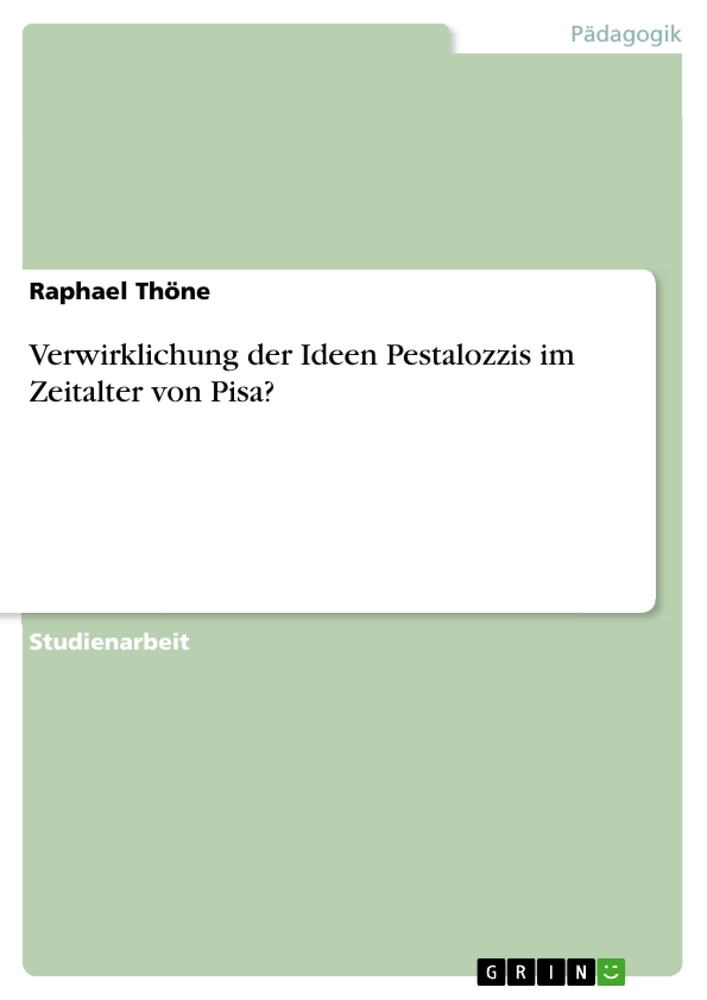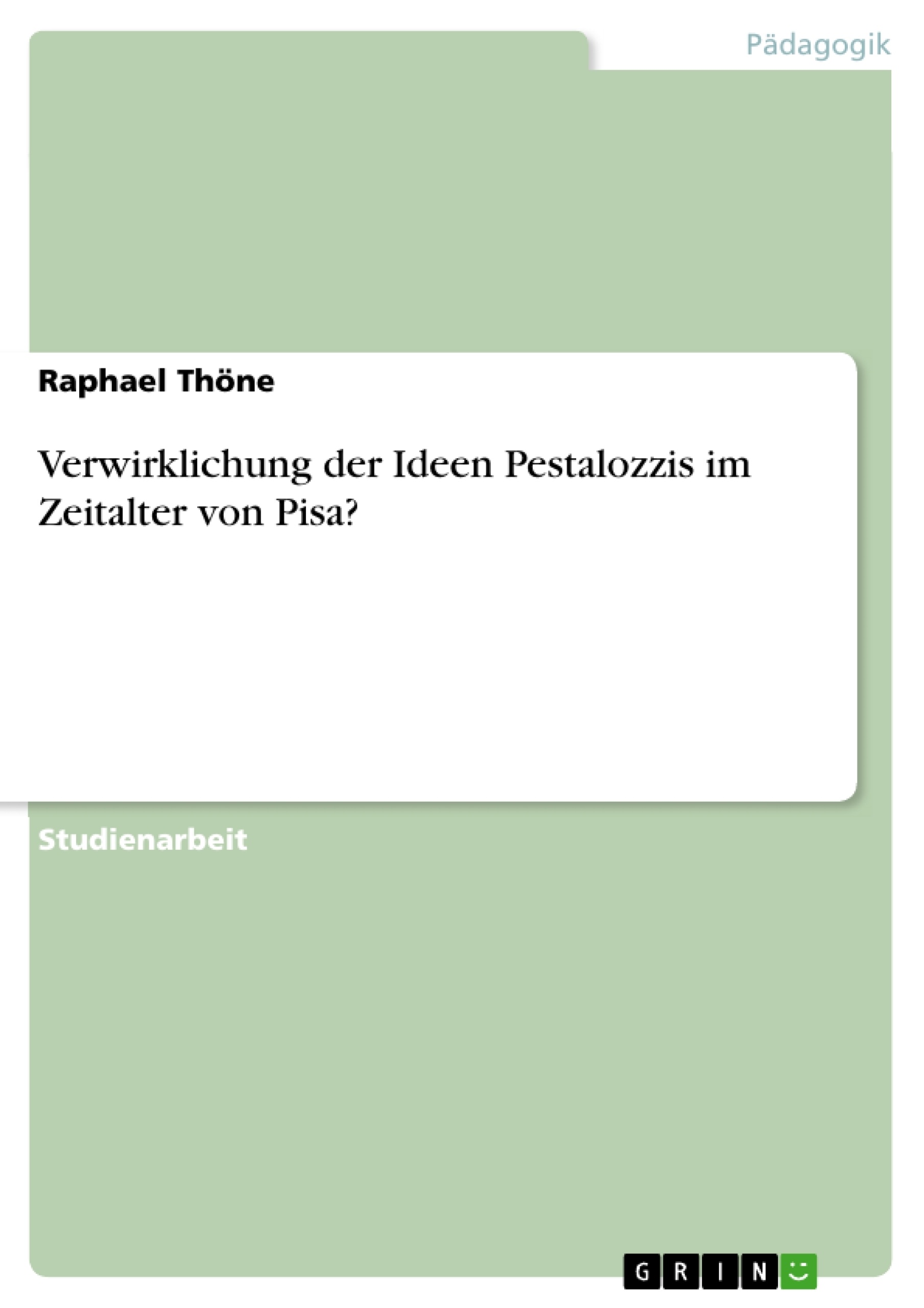Kaum eine Abkürzung wie die Buchstabenfolge PISA hat in den vergangenen fünf Jahren für mehr Aufregung in der bildungspolitischen Debatte, für mehr Diskussion in den Feuilletons in den deutschsprachigen Zeitungen und Angst und Ungewissheit bei der betroffenen Eltern-, Schüler- und Lehrerschaft gesorgt. PISA steht für „Programme for International Student Assessment“ und ist eine von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Auftrag gegebene und durchgeführte Studie, dessen „primäre Aufgabe..[es ist], den Regierungen der teilnehmenden Staaten auf periodischer Grundlage Prozess- und Ertragsindikatoren zur Verfügung zu stellen, die für politisch-administrative Entscheidungen zur Verbesserung der nationalen Bildungssysteme brauchbar sind“.
Wenn nun in der vorliegenden Arbeit die Frage nach der Verwirklichung der Ideen Pestalozzis im Zeitalter von Pisa gestellt wird – und dies bewusst in Anführungszeichen und mit einem Fragezeichen versehen -, so soll diese den Fokus auf einen Vergleich von Pestalozzischem Ideengut mit den drei Kernkompetenzen der PISA-Studie legen. Pestalozzis Kernthesen 1. von der „Anschauung“ und 2. dass „Leben lehrt“ werden anhand von Quellen zunächst erläutert und dann kritisch mit den heutigen Begrifflichkeiten von Lesekompetenz, mathematischer Grundbildung und naturwissenschaftlicher Grundbildung verglichen. Dass diese nicht synonym zu verwenden sind, verbietet allein der historische Kontext; vordergründigstes Ziel dieser Arbeit ist es daher, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu verdeutlichen.
Pestalozzi hat sich, wie Walter Guyer bereits 1975 akribisch herausgearbeitet hat, von einem deutlichen Kritiker am Schulwesen zum Schulmeister entwickelt und schon früh begriffen, dass die reine „Lernschule“, in welcher Wissen als „Stoff“ ohne direkten Bezug zum Leben, zur sogenannten „Anschauung“, vermittelt wird, große Probleme in sich birgt. Seine Aussagen und pädagogischen Konzepte zur Vermittlung von Elementarbildung – den Pestalozzischen Begriff verwende ich in dieser Hausarbeit in seiner Entsprechung zu den drei genannten Kernkompetenzen und nicht in seiner heutigen Anwendung als Begriff für die Erziehung im Vorschulbereich (Vorschule, Kindergarten) – mögen teilweise antiquiert anmuten, doch es ist Pestalozzis Verdienst, erstmals systematisch versucht zu haben, sich der Lehre von Elementarkenntnissen genähert zu haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Pestalozzi
- Kurzbiographie Johann Heinrich Pestalozzi
- Pestalozzis Idee der Erziehung: Von der „Wohnstube“ zur Erziehung
- Pestalozzi: Vom Kritiker der „Schule“ zum Schulmeister: Erste methodische Ansätze Pestalozzis in Stans
- Pestalozzis Bildungs-Kernthese: Lehren und Lernen durch „Anschauung“
- PISA Einführung: Untersuchungsgegenstand und Durchführung von PISA 2000/2003
- Durchführung und Ergebnisse von PISA 2000
- Untersuchung der Kernkompetenzen
- Externe Bedingungsfaktoren
- Durchführung und Ergebnisse PISA 2003
- Durchführung und Ergebnisse von PISA 2000
- Synthese: Pestalozzis,,didaktisches Erbe“ und PISA
- Pestalozzi
- Literaturverzeichnis
- Quellen
- Zeitungen, Zeitschriften
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit zielt darauf ab, Pestalozzis pädagogische Ideen im Kontext der PISA-Studie zu untersuchen. Der Fokus liegt dabei auf einem Vergleich der Pestalozzischen Kernthesen mit den drei Kernkompetenzen der PISA-Studie: Lesekompetenz, mathematische Grundbildung und naturwissenschaftliche Grundbildung. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Pestalozzis Ansätzen und den heutigen Anforderungen der Bildungslandschaft aufzuzeigen.
- Die Bedeutung von „Anschauung“ in Pestalozzis pädagogischem Ansatz
- Die Relevanz von „ganzheitlichem Lernen“ im Vergleich zu den PISA-Kriterien
- Die Kritik an der „output“-orientierten Ausrichtung des Curriculums im Lichte der PISA-Ergebnisse
- Die Bedeutung der Elementarbildung in Pestalozzis Konzept
- Die aktuelle Diskussion um die Frage, ob die Lehren aus den PISA-Ergebnissen die richtigen sind
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der PISA-Studie in der bildungspolitischen Debatte und stellt die Forschungsfrage nach der Verwirklichung von Pestalozzis Ideen im Zeitalter von PISA. Der Hauptteil befasst sich zunächst mit Pestalozzis Leben und Werk, wobei seine Kernidee der „Anschauung“ sowie die Kritik an der „Lernschule“ im Mittelpunkt stehen. Anschließend wird die PISA-Studie hinsichtlich ihrer Zielsetzung und ihrer methodischen Vorgehensweise vorgestellt. Im Fokus stehen die Ergebnisse der PISA 2000 und 2003 sowie die daraus resultierenden Debatten um die Qualität der deutschen Bildung. Abschließend erfolgt eine Synthese, die Pestalozzis „didaktisches Erbe“ mit den Anforderungen der heutigen Bildungslandschaft unter dem Blickwinkel der PISA-Studie zusammenbringt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind Pestalozzi, PISA, „Anschauung“, „ganzheitliches Lernen“, Lesekompetenz, mathematische Grundbildung, naturwissenschaftliche Grundbildung, Elementarbildung und Bildungslandschaft. Der Text beleuchtet die Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich aus der Begegnung von Pestalozzis pädagogischen Ideen mit den modernen Anforderungen der PISA-Studie ergeben.
Häufig gestellte Fragen
Was wird in der Arbeit zwischen Pestalozzi und PISA verglichen?
Die Arbeit vergleicht Pestalozzis pädagogische Ideen, insbesondere die „Anschauung“, mit den Kernkompetenzen der PISA-Studie (Lesen, Mathe, Naturwissenschaften).
Was bedeutet Pestalozzis Prinzip der „Anschauung“?
Es beschreibt das Lernen durch direkte Erfahrung und Bezug zum Leben, im Gegensatz zum reinen Auswendiglernen von „Stoff“.
Warum kritisierte Pestalozzi die reine „Lernschule“?
Er sah große Probleme darin, wenn Wissen ohne Bezug zur Realität und ohne ganzheitliche Bildung vermittelt wird.
Was ist die PISA-Studie genau?
PISA steht für „Programme for International Student Assessment“ und misst periodisch die Leistungen von Schülern weltweit für bildungspolitische Entscheidungen.
Sind Pestalozzis Ideen im Zeitalter von PISA noch aktuell?
Die Arbeit untersucht, ob die moderne Ausrichtung auf messbare „Outputs“ (PISA) im Widerspruch zu Pestalozzis ganzheitlichem Bildungsansatz steht.
Wie definiert Pestalozzi „Elementarbildung“?
In dieser Arbeit wird der Begriff als Entsprechung zu den Grundkompetenzen verwendet, die jeder Mensch zur Bewältigung des Lebens benötigt.
- Arbeit zitieren
- Dr. Raphael Thöne (Autor:in), 2005, Verwirklichung der Ideen Pestalozzis im Zeitalter von Pisa?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52063