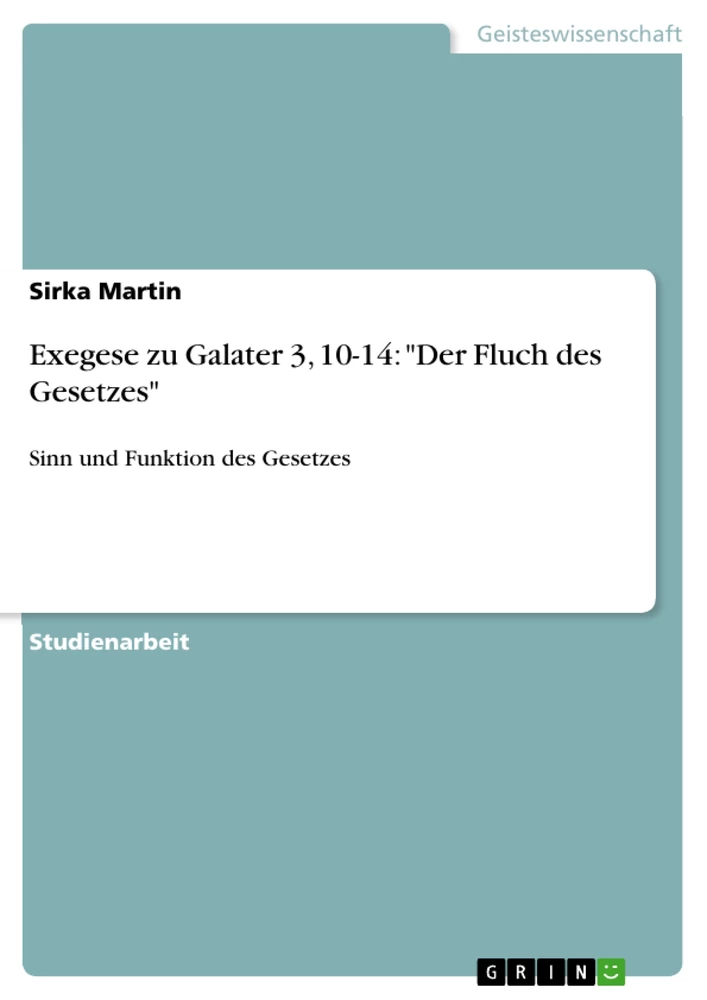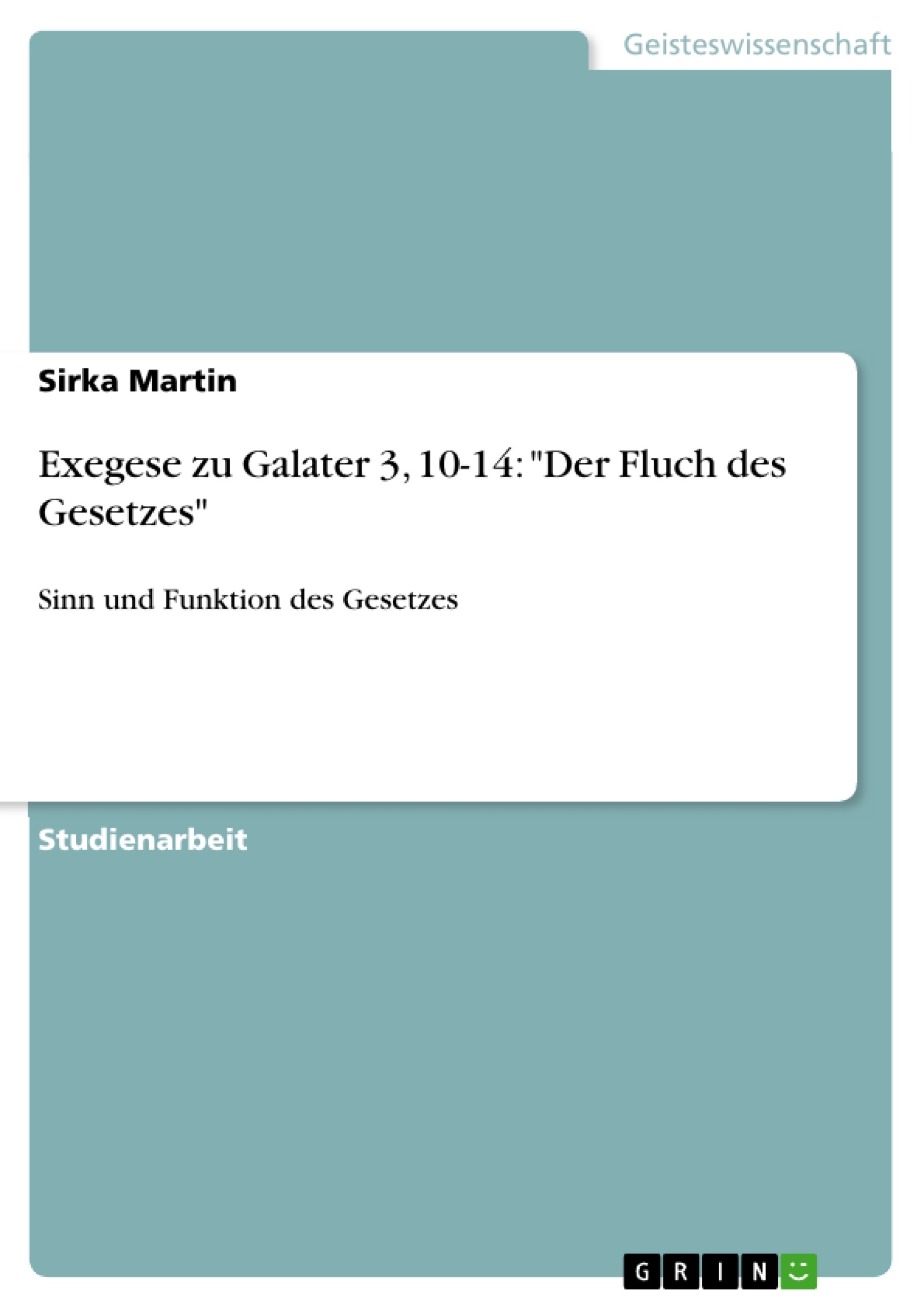Diese Arbeit behandelt die Exegese zu der Textstelle Galater 3, 10-14 unter dem Thema: "Der Fluch des Gesetzes". Die Textstelle warf schon damals Fragen auf, die heute noch bestehen: Wofür gab Gott den Menschen die Gebote, wenn doch allein der Glaube genügt, um vor ihm gerecht zu sein? Was war Paulus' Intention bei seinem Brief an die Galater? Und welche Rolle spielen die Werke des Gesetzes bei ihm rückblickend? Paulus provoziert in seinem Brief die Frage nach dem Sinn und nach der Funktion des Gesetzes. Warum führt Paulus die Gestalt Abraham und Mose heran? Ging er davon aus, dass seine Adressaten über die Taten dieser wussten? In der folgenden Exegese des Galaterbriefes erhofft sich der Autor, eine Antwort auf diese Fragen zu finden und neue Blickwinkel und Erkenntnisse zu erlangen.
Den ausgewählten Auszug aus dem Galaterbrief verstand der Autor als eine Art Neubelehrung. Paulus schwächt die Bedeutung der Befolgung der mosaischen Gesetze ab, bezeichnet sie sogar als Fluch und legt seinen Fokus auf die Glaubensgerechtigkeit. Dieses Evangelium, welches er verkündet, empfing er zuvor durch die "Offenbarung Jesu Christi". Alle diejenigen, die versuchen die Errettung durch das Halten der Gesetze zu erlangen, stehen unter dem Fluch. Diesen versteht der Autor als Strafe und Verbannung aus Gottes Welt. Von diesem Fluch hat Christus durch seine Qualen, die er erlitten hat am Kreuz, die Menschen befreit.
Inhaltsverzeichnis
- Vorüberlegungen und Textsicherung
- Persönlicher Zugang zum Text
- Wirkungsgeschichtliche Reflexion
- Abgrenzung der Perikope
- Vergleich mehrerer deutscher Übersetzungen
- Sprachlich - sachliche Analyse (synchron)
- Sozialgeschichtliche und historische Fragen, Realien
- Textlinguistische Fragestellungen
- Die Aussageabsicht des Autors (synchron)
- Formkritik
- Textpragmatische Analyse
- Kontextuelle Analyse/ das innovative Potential (diachron)
- Traditionsgeschichte
- Religionsgeschichtlicher Vergleich
- Synoptischer Vergleich im weiteren Sinn
- Der Text als Teil eines theologischen Gesamtkonzeptes
- Kompositionskritische Analyse
- Redaktionskritik
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Exegese zu Galater 3,10-14 mit dem Thema „Der Fluch des Gesetzes“ zielt darauf ab, die Aussagen des Textes zu analysieren und seine Bedeutung in den historischen und theologischen Kontext einzuordnen. Die Arbeit untersucht die Intention des Autors, die sprachliche und sachliche Ebene des Textes sowie die Wirkung des Textes im Laufe der Geschichte.
- Die Bedeutung des Gesetzes im christlichen Glauben
- Das Verhältnis von Glaube und Werken
- Die Rolle Jesu Christi als Erlöser
- Die Bedeutung des Galaterbriefes in der Geschichte der Theologie
- Die Interpretation des Galaterbriefes in verschiedenen theologischen Strömungen
Zusammenfassung der Kapitel
Vorüberlegungen und Textsicherung
Dieses Kapitel beschreibt den persönlichen Zugang des Autors zum Text und beleuchtet die Bedeutung des Textes für seine eigene Glaubenspraxis. Es wird die Geschichte der Rezeption des Textes dargestellt und die Relevanz der Exegese für das Verständnis des christlichen Glaubens hervorgehoben.
Sprachlich - sachliche Analyse (synchron)
Dieses Kapitel analysiert den Text anhand linguistischer und historischer Methoden. Es werden sprachliche Besonderheiten des Textes untersucht und die Relevanz des Textes für das Verständnis des römischen Rechts und der jüdischen Tradition erörtert.
Die Aussageabsicht des Autors (synchron)
Dieses Kapitel untersucht die Intention des Autors des Galaterbriefes und analysiert die Rhetorik und Argumentationsstruktur des Textes. Es wird untersucht, welche Botschaft der Autor mit dem Text vermitteln wollte und wie er seine Leser beeinflussen wollte.
Kontextuelle Analyse/ das innovative Potential (diachron)
Dieses Kapitel untersucht die Relevanz des Textes im historischen Kontext und untersucht, welche theologischen und gesellschaftlichen Veränderungen durch den Text initiiert wurden. Es werden verschiedene Interpretationen des Textes in der Geschichte der Theologie dargestellt und die Bedeutung des Textes für das Verständnis der Entwicklung des christlichen Glaubens beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Exegese zu Galater 3,10-14 befasst sich mit zentralen Themen des christlichen Glaubens, wie der Rolle des Gesetzes, der Bedeutung des Glaubens, der Rechtfertigung des Menschen vor Gott und der Erlösung durch Jesus Christus. Weitere wichtige Begriffe sind die Wirkungsgeschichte des Textes, die Interpretation verschiedener Theologen und Theoretiker, die Geschichte der Rezeption des Textes und die Bedeutung des Textes für das Verständnis der Bibel.
Häufig gestellte Fragen
Was meint Paulus mit dem „Fluch des Gesetzes“?
Paulus bezeichnet jene als unter dem Fluch stehend, die versuchen, ihre Errettung allein durch die strikte Einhaltung mosaischer Gesetze zu erlangen, da dies menschlich unmöglich ist.
Wie hat Christus die Menschen vom Fluch befreit?
Indem er selbst am Kreuz zum Fluch wurde, hat er laut Paulus die Strafe stellvertretend auf sich genommen und den Weg der Glaubensgerechtigkeit eröffnet.
Warum zieht Paulus Abraham als Beispiel heran?
Paulus zeigt auf, dass Abraham bereits vor der Einsetzung des Gesetzes durch seinen Glauben vor Gott gerecht gesprochen wurde.
Gilt das Gesetz für Christen laut Galaterbrief noch?
Das Gesetz hat laut Paulus seine Funktion als „Zuchtmeister“ erfüllt; für Christen steht nun die Freiheit und die Liebe im Zentrum des Glaubens.
Was ist das Ziel der Exegese zu Galater 3, 10-14?
Die Arbeit analysiert die rhetorische Absicht des Paulus und ordnet den Text in das theologische Gesamtkonzept der Rechtfertigungslehre ein.
- Quote paper
- Sirka Martin (Author), 2018, Exegese zu Galater 3, 10-14: "Der Fluch des Gesetzes", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/520686