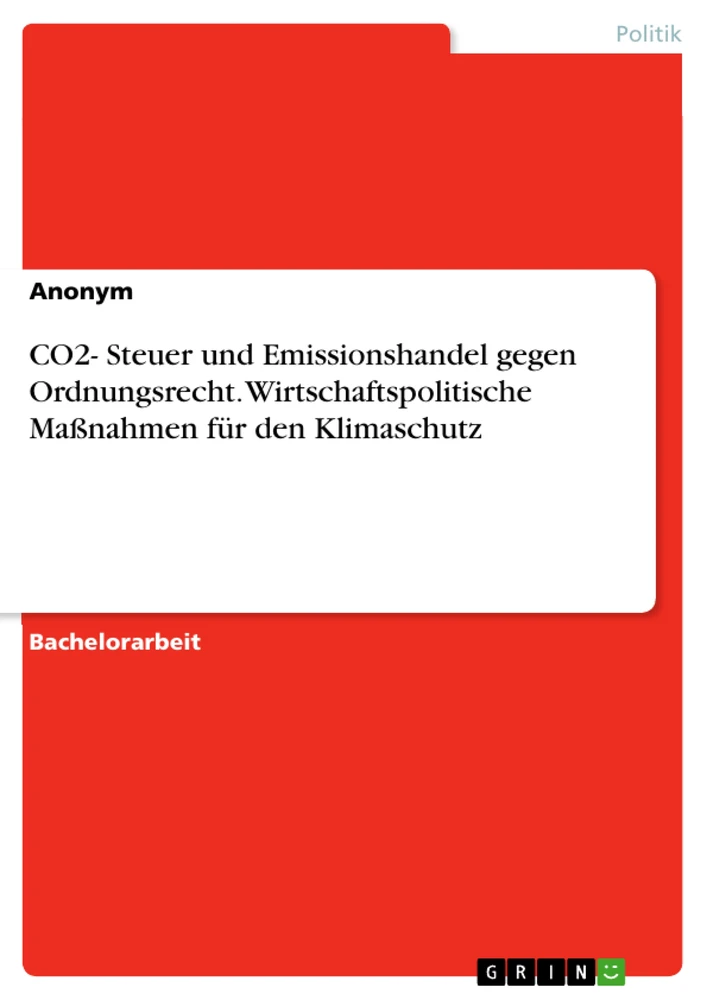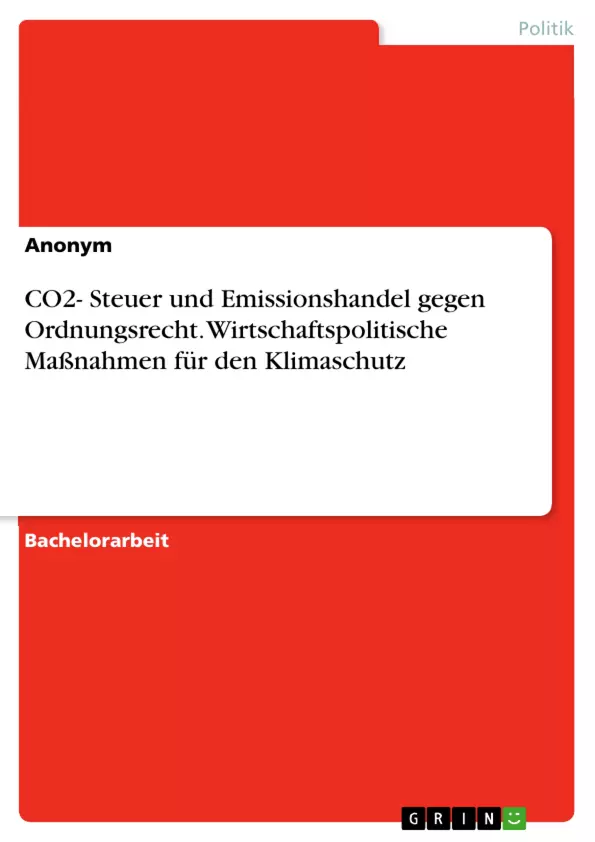Diese Arbeit beschäftigt sich mit wirtschaftspolitischen Maßnahmen zum Klimaschutz. Kapitel 2 dient einer geschichtlichen Einordnung der internationalen Klimaschutzpolitik von der Klimarahmenkonvention in Rio de Janeiro 1992 über das Kyoto-Abkommen 1997 bis zum Pariser Abkommen 2015. Besonderes Augenmerk gilt dabei der EU-weiten Umsetzung der bisherigen internationalen Beschlüsse, insbesondere werden der europäischen Emissionshandel (EU-EHS) und die Lastenteilungsverordnung betrachtet. Kapitel 3 bezieht sich auf die vom EU-EHS nicht abgedeckten Wirtschaftssektoren Verkehr und Wärme. Diese sind nach europäischen Vereinbarungen im nationalen und damit deutschen Zuständigkeitsbereich.
Für die genannten Sektoren werden zwei marktwirtschaftliche Instrumente zur Dekarbonisierung gegenübergestellt: Eine CO2-Bepreisung in Form einer Steuer und das von der Bundesregierung angekündigte nationale Emissionshandelssystem (DE-EHS) mit Festpreisen für die Sektoren. Im Anschluss daran werden im Klimaschutzprogramm angekündigte mit nicht erlassenen ordnungsrechtlichen Maßnahmen für die Sektoren Verkehr und Wärme verglichen. Ziel ist hierbei die Erörterung möglicher Wege der CO2-Reduktion. Kapitel 4 widmet sich weiteren zu berücksichtigenden Aspekten der Klimaschutzpolitik. Hier wird das Klimaschutzprogramm auf die von der Bundesregierung angekündigte Aufkommensneutralität für private Haushalte geprüft. Dabei sollen Verteilungswirkungen durch die CO2-Bepreisung analysiert werden. Des Weiteren sollen Chancen wie die Kopplung unterschiedlicher Energiesektoren betrachtet werden (Sektorkopplung). Abschließend werden im Fazit die wirtschaftspolitischen Maßnahmen unter Berücksichtigung der ökologischen Aspekte kritisch beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1. Einleitung
- 2. Klimaschutz: Rück- und Ausblick
- 2.1 Was wurde bisher erreicht und wie: Klimarahmenkonvention, das Kyoto-Protokoll und das Pariser Abkommen
- 2.2 Was noch erreicht werden soll: Effort Sharing Decision (ESD) und Effort Sharing Regulation (ESR)
- 3. Instrumente zur Förderung der Dekarbonisierung in den Nicht-EU-EHS-Sektoren
- 3.1 Marktwirtschaftliche Ansätze zur Verringerung von CO2-Emissionen
- 3.1.1 Bestehende CO2-Besteuerung im Ländervergleich
- 3.1.3 Preiselastizitäten nach Brennstoffen
- 3.1.4 Preis- oder Mengensteuerung? Eine Frage der Lenkungswirkung
- 3.2 Ordnungsrechtliche Maßnahmen nach Sektoren
- 3.2.1 Wärme
- 3.2.2 Verkehr
- 4. Welche Aspekte des Klimaschutzes noch zu berücksichtigen sind
- 4.1 Sektorkopplung
- 4.2 Verteilungswirkungen der CO2-Bepreisung und der geplanten Rückerstattungsmaßnahmen
- 5. Fazit
- Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse wirtschaftspolitischer Maßnahmen, die zum Klimaschutz beitragen sollen. Im Fokus stehen die „Eckpunkte des Klimaschutzprogramms 2030“ der deutschen Bundesregierung. Die Arbeit untersucht die angekündigten politischen Instrumente, unterteilt sie in marktorientierte und ordnungsrechtliche Maßnahmen und analysiert deren Effizienz, Zielorientierung und Lenkungswirkung.
- Analyse von marktorientierten Maßnahmen (CO2-Steuer und Emissionshandel)
- Bewertung der Wirksamkeit von ordnungsrechtlichen Maßnahmen im Verkehr- und Wärmesektor
- Untersuchung der Verteilungswirkungen von CO2-Bepreisungsmaßnahmen
- Betrachtung der Sektorkopplung als Chance für den Klimaschutz
- Kritische Beurteilung der wirtschaftspolitischen Maßnahmen im Kontext der ökologischen Aspekte
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 2: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der internationalen Klimaschutzpolitik, beginnend mit der Klimarahmenkonvention in Rio de Janeiro 1992. Es betrachtet die wichtigen Meilensteine wie das Kyoto-Protokoll und das Pariser Abkommen und beleuchtet die Umsetzung der internationalen Beschlüsse auf EU-Ebene, insbesondere den europäischen Emissionshandel (EU-EHS) und die Lastenteilungsverordnung.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel befasst sich mit den Wirtschaftssektoren Verkehr und Wärme, die vom EU-EHS nicht abgedeckt werden und daher in der nationalen Zuständigkeit Deutschlands liegen. Es vergleicht zwei marktwirtschaftliche Instrumente zur Dekarbonisierung: eine CO2-Bepreisung in Form einer Steuer und das von der Bundesregierung angekündigte nationale Emissionshandelssystem (DE-EHS) mit Festpreisen. Darüber hinaus analysiert es die im Klimaschutzprogramm angekündigten, aber nicht erlassenen ordnungsrechtlichen Maßnahmen für die Sektoren Verkehr und Wärme, um mögliche Wege der CO2-Reduktion zu diskutieren.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel widmet sich weiteren wichtigen Aspekten der Klimaschutzpolitik, die im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung berücksichtigt werden müssen. Es analysiert die Verteilungswirkungen der CO2-Bepreisung und die von der Bundesregierung angekündigte Aufkommensneutralität für private Haushalte. Zudem betrachtet es die Chancen der Sektorkopplung, also die Vernetzung verschiedener Energiesektoren, für den Klimaschutz.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Analyse wirtschaftspolitischer Maßnahmen zum Klimaschutz mit Fokus auf CO2-Bepreisung, Emissionshandel, ordnungsrechtliche Maßnahmen, Sektorkopplung, Verteilungswirkungen und Aufkommensneutralität. Die Arbeit betrachtet diese Themen im Kontext der internationalen Klimaschutzpolitik, des EU-Emissionshandelssystems und des Klimaschutzprogramms 2030 der deutschen Bundesregierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen CO2-Steuer und Emissionshandel?
Die CO2-Steuer ist eine Preissteuerung (fester Preis pro Tonne), während der Emissionshandel eine Mengensteuerung ist (begrenzte Zertifikate), wobei der Preis am Markt gebildet wird.
Welche Sektoren deckt das nationale Emissionshandelssystem (DE-EHS) ab?
Das DE-EHS konzentriert sich primär auf die Sektoren Verkehr und Wärme, die nicht vom europäischen Emissionshandel (EU-EHS) erfasst werden.
Was bedeutet Aufkommensneutralität im Klimaschutzprogramm?
Es bezeichnet das Ziel, die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an die Bürger zurückzugeben, um private Haushalte finanziell nicht zusätzlich zu belasten.
Was versteht man unter Sektorkopplung?
Sektorkopplung ist die Vernetzung von Energiebereichen wie Strom, Wärme und Verkehr, um die Effizienz zu steigern und erneuerbare Energien besser zu nutzen.
Welche ordnungsrechtlichen Maßnahmen werden im Verkehrssektor diskutiert?
Dazu gehören Vorschriften zur CO2-Reduktion, die über rein marktwirtschaftliche Anreize hinausgehen, um die Dekarbonisierung zu beschleunigen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, CO2- Steuer und Emissionshandel gegen Ordnungsrecht. Wirtschaftspolitische Maßnahmen für den Klimaschutz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/520932