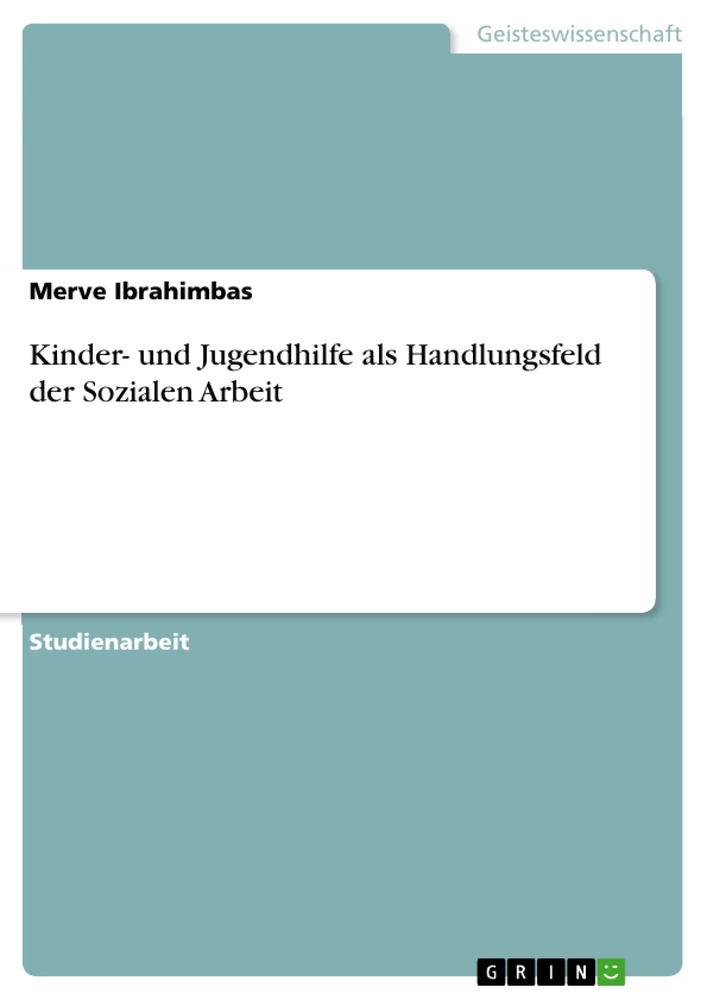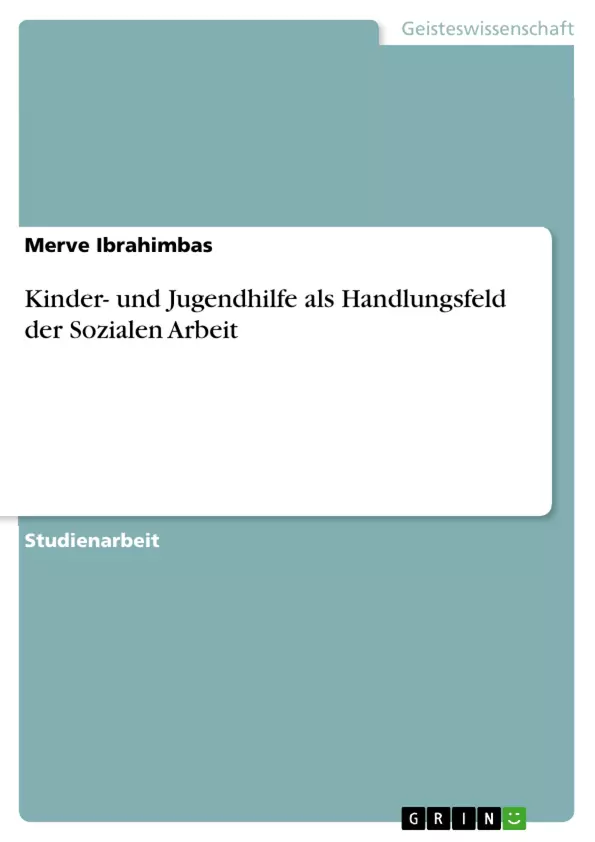Diese Arbeit setzt sich mit der Kinder- und Jugendhilfe auseinander und beantwortet demnach konkrete Fragen. Beispielsweise stellt sich die Frage, worin die Aufgabe der sozialarbeiterischen Komponente "Kinder- und Jugendhilfe" besteht. Darüber hinaus ist zu klären, wie sich dieses spezielle Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit im historischen Kontext entwickelt hat und wie sie sich überhaupt organisiert. Wer finanziert die Kinder- und Jugendhilfe, wer ist der Träger? Welche "Hilfs- beziehungsweise Unterstützungsformen" existieren innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe? Auf welchem Artikel basiert sie?
Das sind begreiflicherweise wichtige Aspekte, die zum Handlungsfeld der Kinder und Jugendhilfe gehören. Vorab möchte ich jedoch erwähnen, dass der eigentliche Schwerpunkt dieser Ausarbeitung zwar das Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe ist, dennoch ist es mir aber wichtig, auch allgemein einen groben Überblick über die Hilfen zur Erziehung der Kinder- und Jugendhilfe zu geben. Dementsprechend möchte ich an erster Stelle kurz das Arbeitsfeld Kinder- und Jugendhilfe darstellen und dann die Geschichte und Genesis des Handlungsfeldes konkretisieren. Nach den historischen Aspekten werde ich auf die rechtlichen Grundlagen eingehen, indem ich allgemein das Sozialgesetzbuch erwähne, um anschließend speziell auf die Trägerschaft, Finanzierung und Leistungen einzugehen. Davon ausgehend möchte ich im folgenden Abschnitt die Hilfen zur Erziehung näher erläutern und vorstellen. Zum Schluss werde ich die dafür benötigten Handlungskompetenzen sowie Sozial und Selbstkompetenzen von professionellen Fachkräften explizieren.
Kinder und Jugendliche können ihre Rechte besser und umfassender ausführen, wenn sie wissen, worauf sie ein Recht haben und welche Leistungen und Angebote die Kinder- und Jugendhilfe für sie und ihre Familien bietet. Ob der Sohn in ein Jugendzentrum geht, ob man ihr Kind in den Kindergarten bringt, ob Freunde ein Kind adoptiert oder in Pflege genommen haben, ständig hat man es mit Kinder- und Jugendhilfe zu tun.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kinder- und Jugendhilfe als Handlungsfeld
- Geschichte
- Die Gründungsphase
- Das derzeitige Kinderleben
- Private Kinder- und Jugendfürsorge im 19. Jahrhundert
- Begrenzung der Kinderarbeit
- Die Situation der Jugendlichen in der Weimarer Republik
- Jugendhilfe nach 1945
- Organisation
- Rechtliche Grundlagen Sozialgesetzbuch SGB 8
- Träger
- öffentliche Träger
- freie Träger
- Finanzierung
- Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
- Hilfen zur Erziehung und weitere Formen der Unterbringung außerhalb der Herkunftsfamilie
- Indikation für eine Unterbringung außerhalb der Herkunftsfamilie
- Mögliche Hilfen zur Erziehung
- Heimerziehung
- Vollzeitpflege
- Kompetenzen der Fachkräfte der Kinder und Jugendhilfe
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit setzt sich mit dem Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe auseinander. Ihr Ziel ist es, die Aufgaben der Sozialen Arbeit in diesem Bereich zu beleuchten, die historische Entwicklung zu skizzieren und die Organisation und Finanzierung der Kinder- und Jugendhilfe zu erklären. Des Weiteren werden verschiedene Hilfen zur Erziehung vorgestellt und die notwendigen Kompetenzen von Fachkräften in diesem Bereich betrachtet.
- Die Rolle der Sozialen Arbeit im Handlungsfeld Kinder- und Jugendhilfe
- Historische Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe
- Organisation und Finanzierung der Kinder- und Jugendhilfe
- Hilfen zur Erziehung und Unterbringungsmöglichkeiten
- Kompetenzen von Fachkräften in der Kinder- und Jugendhilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe vor und erläutert die zentralen Fragen, die in der Arbeit behandelt werden. Das erste Kapitel definiert die Kinder- und Jugendhilfe als Teilbereich der Sozialen Arbeit und beschreibt ihre Aufgaben und Ziele. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Geschichte der Kinder- und Jugendhilfe, beginnend mit der Gründungsphase im Mittelalter und ihren Entwicklungen bis in die Nachkriegszeit. Im dritten Kapitel werden die rechtlichen Grundlagen, die Trägerlandschaft, die Finanzierung und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe vorgestellt. Das vierte Kapitel behandelt verschiedene Formen der Hilfen zur Erziehung, insbesondere Unterbringungen außerhalb der Herkunftsfamilie.
Schlüsselwörter
Kinder- und Jugendhilfe, Soziale Arbeit, Handlungsfeld, Geschichte, Organisation, Finanzierung, Leistungen, Hilfen zur Erziehung, Unterbringung, Kompetenzen, Fachkräfte.
- Quote paper
- Merve Ibrahimbas (Author), 2018, Kinder- und Jugendhilfe als Handlungsfeld der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/520954