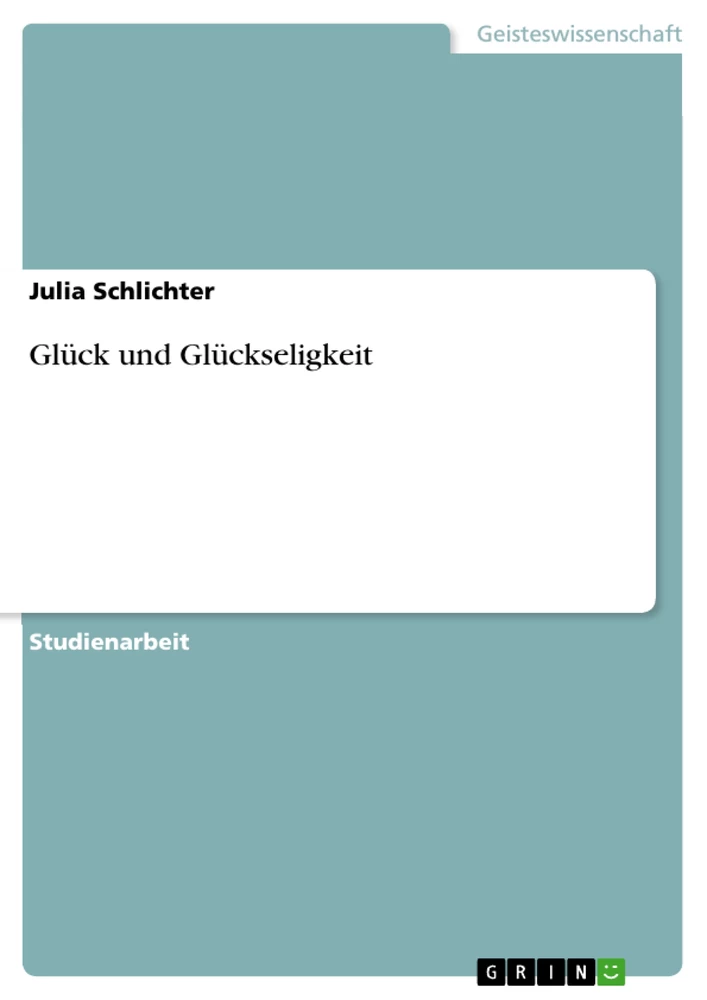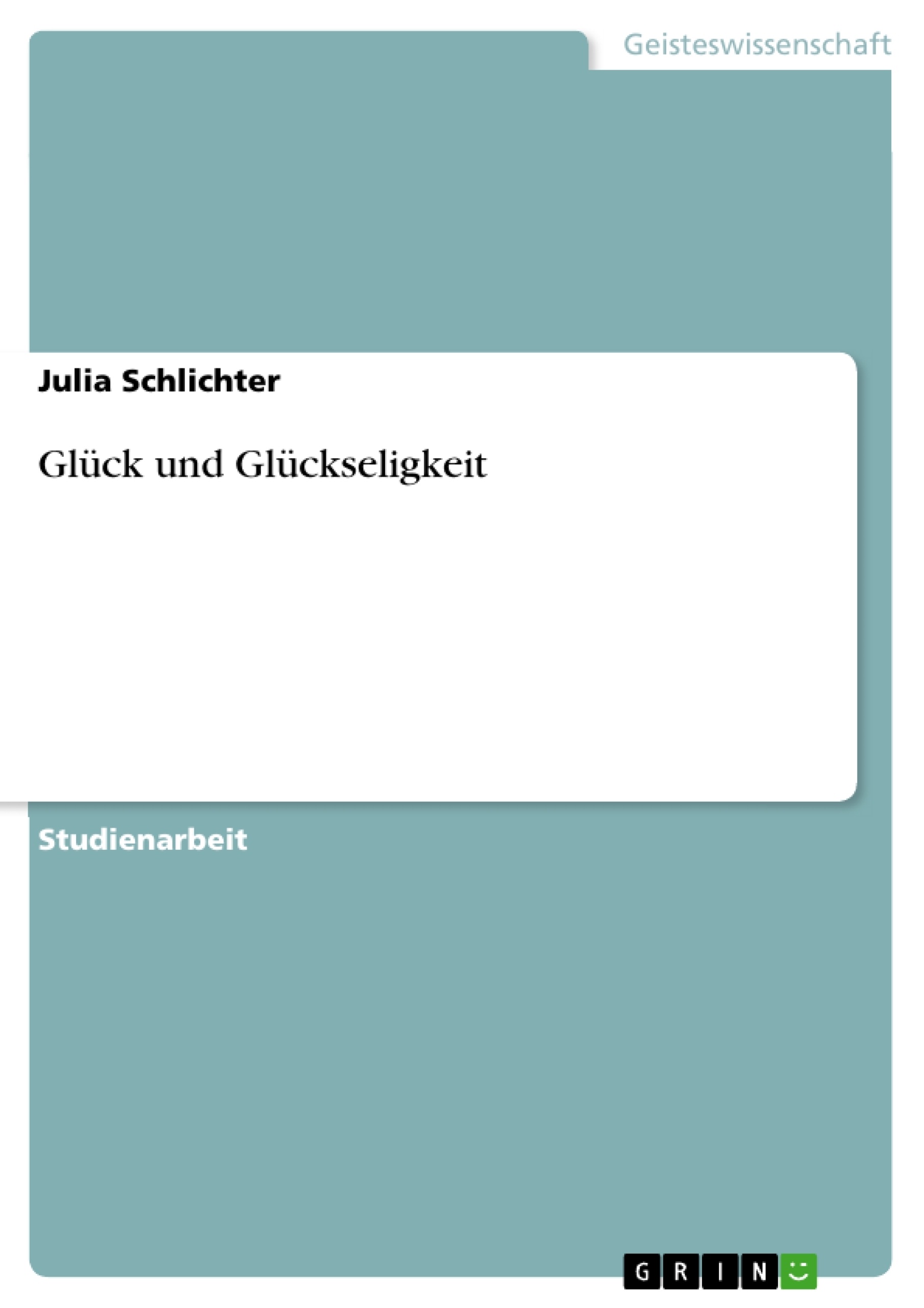In ihrem Buch „Einführung in die Ethik“ gibt Annemarie Pieper unter anderem auch einen kurzen Überblick über den Begriff der „Glückseligkeit“ und des Glücks. In der vorliegenden Arbeit werden diese beiden Ausdrücke unter dem Gesichtspunkt ihrer Vielfältigkeit behandelt. Ausgegangen wird dabei von dem von A. Pieper verfassten Text. Eine Unterscheidung der Glücksbegriffe wird danach auf der Grundlage der Einteilung von Günther Bien vorgenommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Streben nach Glück - Verschiedene Moralprinzipien
- 3. Was ist das Glück des Menschen?
- 4. Zum Glücksbegriff
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff der Glückseligkeit und des Glücks anhand des Textes von Annemarie Pieper. Sie analysiert verschiedene moralphilosophische Perspektiven auf das Streben nach Glück und die Frage nach der Rechtfertigung individuellen Glückstrebens.
- Das Streben nach Glück als menschliches Grundbedürfnis
- Konflikt zwischen Glückseligkeit und moralischen Prinzipien
- Der Utilitarismus als ethische Grundlage für das Streben nach Glück
- Kants deontologische Ethik und die Einschränkung des Glückstrebens durch die Pflicht
- Die Vereinbarkeit von individuellem Glückstreben und moralischem Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Glückseligkeit und des Glücks ein und kündigt die Auseinandersetzung mit verschiedenen Glücksbegriffen und moralphilosophischen Perspektiven an. Sie benennt Annemarie Piepers Werk als Grundlage der Analyse und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit.
2. Das Streben nach Glück – Verschiedene Moralprinzipien: Dieses Kapitel beleuchtet den fundamentalen menschlichen Wunsch nach Glück und präsentiert zwei gegensätzliche ethische Positionen. Die erste, vertreten von John Stuart Mill, argumentiert für das "Prinzip der Glückseligkeit" als oberstes normatives Prinzip, wobei das Glück zum Maßstab moralischen Handelns wird. Die zweite Position, von Immanuel Kant vertreten, betont das "Prinzip der Pflicht", welches das Streben nach Tugend über das Glück stellt. Kant argumentiert, dass die uneingeschränkte Suche nach Glück die Freiheit des Individuums einschränkt. Pieper zeigt die Spannung zwischen dem natürlichen Wunsch nach Glück und den Anforderungen der Moral auf, wobei die Vereinbarkeit beider untersucht wird. Der Text veranschaulicht diese Konzepte mit Beispielen und illustriert die unterschiedlichen ethischen Implikationen.
Schlüsselwörter
Glückseligkeit, Glück, Moralprinzipien, Utilitarismus, Kants Ethik, Pflicht, Freiheit, Selbstbestimmung, ethische Rechtfertigung, individuelles Glückstreben.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des Glücksbegriffs nach Annemarie Pieper
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Begriff der Glückseligkeit und des Glücks anhand eines Textes von Annemarie Pieper. Sie untersucht verschiedene moralphilosophische Perspektiven auf das Streben nach Glück und die Frage nach der Rechtfertigung individuellen Glückstrebens.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Streben nach Glück als menschliches Grundbedürfnis, dem Konflikt zwischen Glückseligkeit und moralischen Prinzipien, dem Utilitarismus als ethische Grundlage für das Streben nach Glück, Kants deontologischer Ethik und der Einschränkung des Glückstrebens durch die Pflicht sowie der Vereinbarkeit von individuellem Glückstreben und moralischem Handeln.
Welche moralphilosophischen Positionen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht den Utilitarismus, vertreten beispielsweise durch John Stuart Mill (Prinzip der Glückseligkeit, Glück als Maßstab moralischen Handelns), mit Kants deontologischer Ethik (Prinzip der Pflicht, Tugend über Glück). Der Fokus liegt auf der Spannung zwischen dem natürlichen Wunsch nach Glück und den Anforderungen der Moral.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, die das Thema einführt und den methodischen Ansatz skizziert. Es folgt ein Kapitel, das das Streben nach Glück und verschiedene Moralprinzipien beleuchtet. Weitere Kapitel befassen sich mit dem Glücksbegriff selbst und einer abschließenden Zusammenfassung.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Glückseligkeit, Glück, Moralprinzipien, Utilitarismus, Kants Ethik, Pflicht, Freiheit, Selbstbestimmung, ethische Rechtfertigung und individuelles Glückstreben.
Wo finde ich eine detaillierte Übersicht der Kapitel?
Das Inhaltsverzeichnis bietet eine Übersicht der Kapitel: Einleitung, Das Streben nach Glück - Verschiedene Moralprinzipien, Was ist das Glück des Menschen?, Zum Glücksbegriff, und Zusammenfassung.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit analysiert den Text von Annemarie Pieper und setzt diesen in den Kontext verschiedener moralphilosophischer Perspektiven. Der methodische Ansatz wird in der Einleitung näher erläutert.
- Arbeit zitieren
- Julia Schlichter (Autor:in), 2005, Glück und Glückseligkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52099