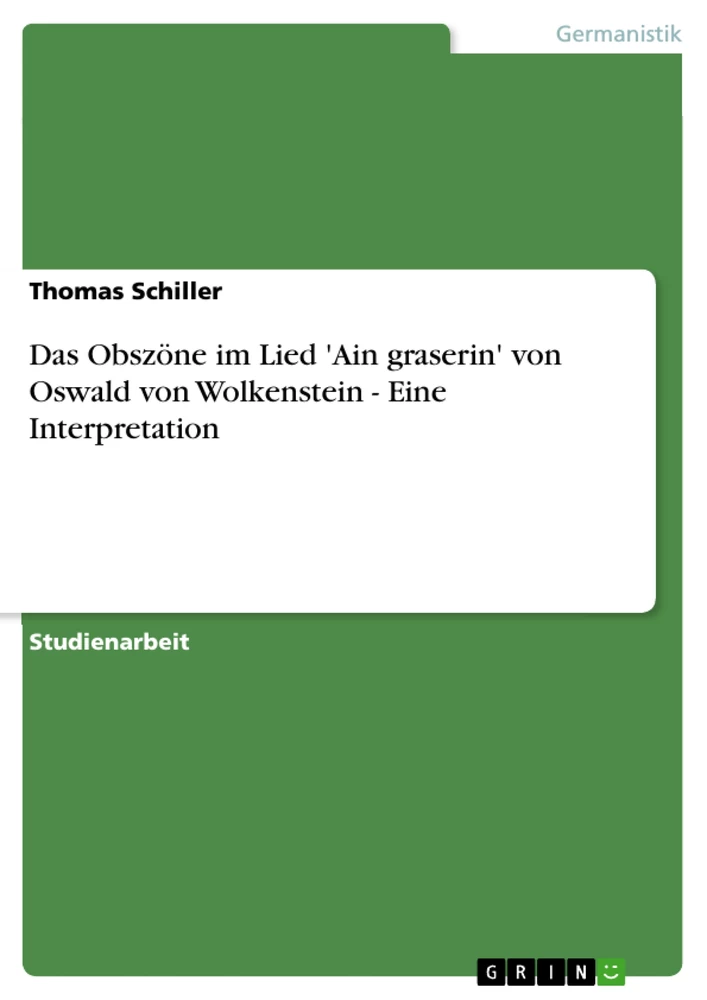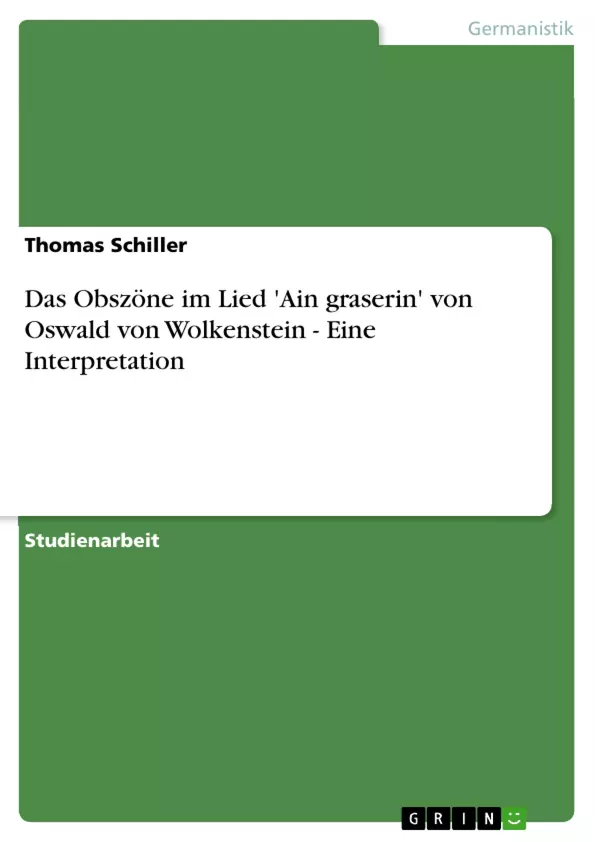"Für ihn ist Liebe immer leibhaftig, irdisch, das ursprüngliche Naturverhältnis wird nachdrücklich in seine Rechte eingesetzt und emanzipiert sich von gesellschaftlichen Tabus." [Wolkenstein, Oswald v.: Leib- und Lebenslieder. Ausgewählt und übertragen von Hubert Witt. Leipzig 1982 ( = Sammlung Dieterich, Bd. 397), S. 195 (Nachwort).] Diese Behauptung soll die folgende kurze Abhandlung einleiten, welche sich ebenfalls mit Oswald von Wolkensteins Verhältnis zu Sexualität, Natürlichkeit und Gesellschaft in seiner Zeit und dessen dichterischer Umsetzung auseinander setzt. Am Beispiel des um 1408 [Vgl. Wolkenstein, Oswald v: Die Lieder. Mittelhochdeutsch - Deutsch. 2.Auflage. In Text und Melodien neu übertragen und kommentiert von Klaus J. Schönmetzler. Essen 1990, S.442 (Kommentar).] entstandenen Liedes "Ain graserin" [Klein, Karl Kurt (Hrsg.): Die Lieder Oswalds von Wolkenstein. 3., neubearb. u. erw. Auflage. Tübingen 1987 ( = Altdeutsche Textbibliothek, Nr.55), S. 202-203.] soll ein Aspekt dieser Beziehung herausgearbeitet und auf Tauglichkeit geprüft werden: das Obszöne.
Zu Beginn erfolgt eine eigenständige Übersetzung des Liedes. Dabei auftretende Probleme und Sonderheiten werden danach diskutiert. In wieweit die von Oswald verwendeten Stilmittel, welche für die Wirkung der graserin evident sind, mit in die Übertragung einfließen konnten, wird ebenfalls besprochen. Die interpretatorische Annäherung beschäftigt sich zunächst mit der räumlichen und zeitlichen Disposition, sowie mit der Figurenkonstellation, bevor der Aufbau der Zweideutigkeiten des Liedes erkundet wird. Dazu gehören eine Bestimmung des Obszönitätsbegriffes und die Darlegung der Rolle des Metaphorischen. Anschließend erfolgt die Untersuchung am Text. Die Frage, welcher Gattung das Lied zugeordnet werden kann, soll in einem gesonderten Kapitel thematisiert werden. Den Abschluss bilden eine Einordnung des graserin - Themas in das Oeuvre des Wolkensteiners, sowie ein Fazit dieser Arbeit. Im Rahmen der Abhandlung steht stets das Textwerk der Handschrift B im Fordergrund. Ein Vergleich mit den Handschriften A, c, F, welche das Lied ebenfalls beinhalten, kann nicht stattfinden. Auch die musikalische Ausformung wird vernachlässigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Übersetzung
- Kritischer Kommentar
- Interpretation
- Inhaltswiedergabe
- Bestimmung des räumlichen und zeitlichen Rahmens
- Die Figurenkonstellation
- Die Frage nach dem lyrischen Ich
- Aufbau der Doppeldeutigkeit
- „Obszön“ - Versuch einer Begriffsklärung
- Die Rolle der Metapher
- Oswalds Spiel mit dem Obszönen
- Inhaltswiedergabe
- „Ain graserin“ – eine Pastourelle?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Oswald von Wolkensteins Umgang mit Obszönität, Natur und Gesellschaft in seinem Lied „Ain graserin“. Die Zielsetzung besteht darin, einen Aspekt seines Verhältnisses zu Sexualität und gesellschaftlichen Tabus herauszuarbeiten und zu analysieren. Die Interpretation konzentriert sich auf die sprachlichen Mittel und den Aufbau von Doppeldeutigkeiten im Lied.
- Die Darstellung von Sexualität und Obszönität in der mittelalterlichen Lyrik
- Die Interpretation von Mehrdeutigkeiten und Metaphern in „Ain graserin“
- Die Einordnung des Liedes in den Kontext von Oswalds Gesamtwerk
- Die sprachliche und stilistische Analyse des mittelhochdeutschen Textes
- Die Frage nach der literarischen Gattung des Liedes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und benennt die zentrale Fragestellung der Arbeit: die Analyse des Obszönen im Lied „Ain graserin“. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der eine Übersetzung, einen kritischen Kommentar und eine Interpretation des Liedes umfasst. Es wird auf die Bedeutung des Textes im Kontext von Wolkensteins Verhältnis zu Sexualität, Natürlichkeit und Gesellschaft hingewiesen. Der Fokus liegt auf der Handschrift B, während andere Fassungen unberücksichtigt bleiben.
Übersetzung: Dieses Kapitel präsentiert eine eigene Übersetzung des mittelhochdeutschen Liedes „Ain graserin“ ins Neuhochdeutsche. Die Übersetzung versucht, sowohl die sprachliche Präzision des Originals als auch die Verständlichkeit für ein heutiges Publikum zu gewährleisten. Die Übersetzung wird in drei Strophen unterteilt.
Kritischer Kommentar: Der kritische Kommentar beleuchtet Herausforderungen bei der Übersetzung des Liedes, insbesondere im Hinblick auf die veralteten Begriffe und die doppelten Bedeutungen der Wörter. Es werden kritische Anmerkungen zu spezifischen Stellen im Text gegeben und diverse sprachliche und inhaltliche Probleme diskutiert. Zum Beispiel wird die Bedeutung von „graserin“, „seul“ und „niederen peunt“ erläutert und die Problematik der doppelten Verneinung in (1;9) sowie die Mehrdeutigkeit von „zeunen“ in (II;1) behandelt.
Interpretation: Die Interpretation des Liedes gliedert sich in die Inhaltswiedergabe und die Analyse des Aufbaus der Doppeldeutigkeiten. Die Inhaltswiedergabe beschreibt den räumlichen und zeitlichen Rahmen des Geschehens und analysiert die Figurenkonstellation. Die Analyse der Doppeldeutigkeit untersucht den Begriff des Obszönen und die Rolle der Metapher, um die vielschichtigen Bedeutungen des Liedes zu erschließen. Das Kapitel untersucht das erotische Spiel zwischen den Personen.
„Ain graserin“ – eine Pastourelle?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage der Einordnung des Liedes in eine literarische Gattung. Es wird diskutiert, ob das Lied als Pastourelle zu klassifizieren ist, und die Merkmale des Liedes werden in Bezug auf diese Gattung untersucht. Es werden stilistische und inhaltliche Aspekte verglichen, um eine fundierte Einordnung vorzunehmen.
Schlüsselwörter
Oswald von Wolkenstein, Ain graserin, mittelhochdeutsche Lyrik, Obszönität, Sexualität, Metapher, Doppeldeutigkeit, Pastourelle, Interpretation, Übersetzung, kritischer Kommentar, gesellschaftliche Tabus, Natur, Mittelalter.
Häufig gestellte Fragen zu Oswald von Wolkensteins "Ain graserin"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert Oswald von Wolkensteins Lied "Ain graserin" mit Fokus auf den Umgang des Autors mit Obszönität, Natur und Gesellschaft. Sie umfasst eine Übersetzung des mittelhochdeutschen Textes, einen kritischen Kommentar zu Übersetzungsherausforderungen und eine detaillierte Interpretation, die die sprachlichen Mittel und den Aufbau von Doppeldeutigkeiten untersucht. Zusätzlich wird die Einordnung des Liedes in eine literarische Gattung (Pastourelle) diskutiert.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Darstellung von Sexualität und Obszönität in der mittelalterlichen Lyrik, die Interpretation von Mehrdeutigkeiten und Metaphern in "Ain graserin", die Einordnung des Liedes in den Kontext von Oswalds Gesamtwerk, die sprachliche und stilistische Analyse des mittelhochdeutschen Textes und die Frage nach der literarischen Gattung des Liedes.
Welche Methode wird verwendet?
Der methodische Ansatz beinhaltet eine Übersetzung des Liedes ins Neuhochdeutsche, einen kritischen Kommentar, der sprachliche und inhaltliche Probleme beleuchtet, und eine umfassende Interpretation, die die Inhaltswiedergabe, den räumlichen und zeitlichen Rahmen, die Figurenkonstellation und die Analyse der Doppeldeutigkeiten umfasst. Dabei wird insbesondere die Handschrift B herangezogen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Übersetzung, Kritischer Kommentar, Interpretation (mit den Unterpunkten Inhaltswiedergabe und Analyse des Aufbaus der Doppeldeutigkeiten), "Ain graserin" – eine Pastourelle?, und Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz vor. Die Interpretation analysiert den Begriff des Obszönen, die Rolle der Metapher und das erotische Spiel im Lied. Das Kapitel zu "Ain graserin" als Pastourelle diskutiert die Einordnung des Liedes in eine literarische Gattung.
Welche Herausforderungen wurden bei der Übersetzung festgestellt?
Der kritische Kommentar thematisiert die Herausforderungen bei der Übersetzung des mittelhochdeutschen Textes, insbesondere im Hinblick auf veraltete Begriffe und doppelte Bedeutungen. Konkrete Beispiele sind die Bedeutung von Wörtern wie "graserin", "seul" und "niederen peunt", die Problematik der doppelten Verneinung und die Mehrdeutigkeit von "zeunen".
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Oswald von Wolkenstein, Ain graserin, mittelhochdeutsche Lyrik, Obszönität, Sexualität, Metapher, Doppeldeutigkeit, Pastourelle, Interpretation, Übersetzung, kritischer Kommentar, gesellschaftliche Tabus, Natur und Mittelalter.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit ist die Analyse des Umgangs mit Obszönität in Oswald von Wolkensteins Lied "Ain graserin".
Auf welche Handschrift konzentriert sich die Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Handschrift B von "Ain graserin"; andere Fassungen bleiben unberücksichtigt.
Welche Aspekte der Interpretation werden besonders hervorgehoben?
Die Interpretation legt besonderen Wert auf die sprachlichen Mittel und den Aufbau von Doppeldeutigkeiten im Lied, um die vielschichtigen Bedeutungen zu erschließen. Die Inhaltswiedergabe beschreibt den räumlichen und zeitlichen Rahmen und analysiert die Figurenkonstellation.
- Arbeit zitieren
- Thomas Schiller (Autor:in), 2004, Das Obszöne im Lied 'Ain graserin' von Oswald von Wolkenstein - Eine Interpretation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52103