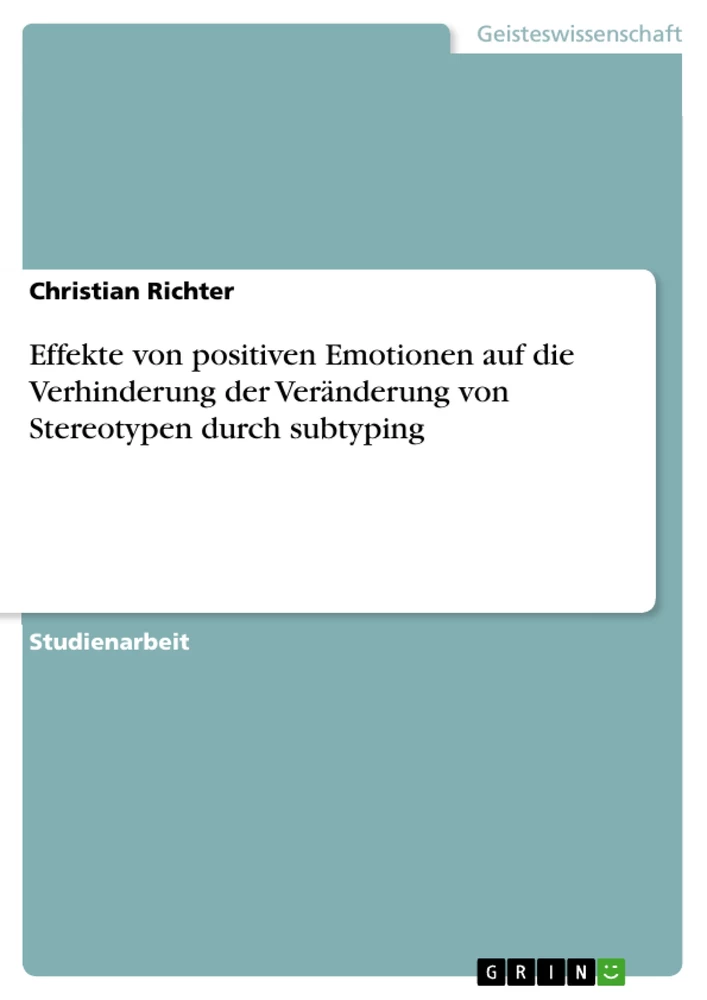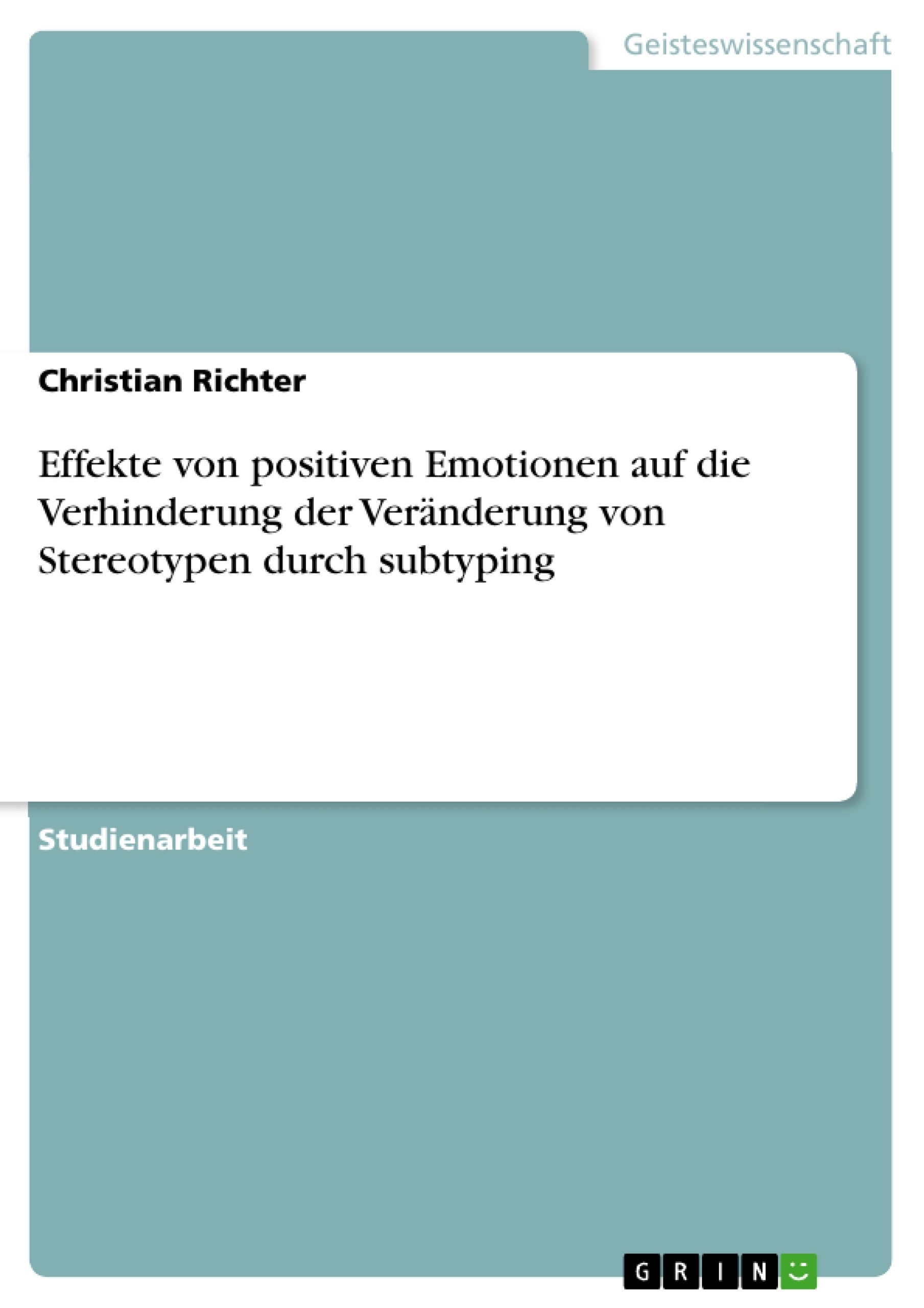Ziele und Vorgehen
Welchen Effekt haben positive Emotionen auf die Verhinderung der Veränderung von Stereotypen durch den Prozess der Bildung einer Unterkategorie („subtyping“) ? Diesen Fragen soll in der vorliegenden Hausarbeit nachgegangen werden, und somit versucht werden, ein Licht auf den Zusammenhang zwischen dem Prozess des „subtyping“ und positiven Emotionen zu werfen. Um dieses Ziel zu erreichen werde ich zunächst versuchen zu klären, was Stereotype sind (nächster Abschnitt) und wie sie entstanden sein könnten (Abschnitt 2.1). Dann werde ich empirische Ergebnisse vorstellten, die den Prozess der Bildung von kognitiven Unterkategorien erklären (Abschnitt 2.2). Unter Abschnitt 3 soll ein Blick auf die Rolle von Emotionen bei der Veränderung von Stereotypen geworfen werden. Welche spezielle Bedeutung positiven Emotionen dabei zukommt, wird in Abschnitt 3.1 und anhand der Präsentation einer Studie in Abschnitt 3.2 erörtert. Über welche Mechanismen Effekte von positiven Emotionen auf die Verhinderung der Veränderung von Stereotypen durch „subtyping“ Effekte positiver Emotionen auf „subtyping“ vermittelt werden könnten, wird in den darauffolgenden Teilen dieser Arbeit untersucht (Abschnitte 3.3 und 3.4). In Abschnitt 4 werden Schlüsse aus den betrachteten Forschungsergebnissen gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Ziele und Vorgehen
- Veränderung von Stereotypen
- Wodurch können Stereotype entstanden sein?
- Verhinderung der Veränderung von Stereotypen durch „subtyping“
- Positive Emotionen und Stereotype
- Veränderung von Stereotypen und positive Emotionen
- Studie: Happiness and Stereotypic Thinking in Social Judgement (Bodenhausen, Kramer & Süsser, 1994)
- Mögliche Effekte positiver Emotionen auf „subtyping“ vermittelt über Kapazität und Flexibilität
- Mögliche Effekte positiver Emotionen auf „subtyping“ vermittelt über Motivation
- Abschließende Worte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Einfluss positiver Emotionen auf die Verhinderung der Veränderung von Stereotypen durch den Prozess des „Subtyping“. Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen „Subtyping“ und positiven Emotionen zu untersuchen und zu analysieren, wie positive Emotionen die Veränderung von Stereotypen beeinflussen können.
- Entstehung und Stabilität von Stereotypen
- Der Prozess des „Subtyping“ als Mechanismus zur Bewältigung von Stereotypen-Inkonsistenzen
- Der Einfluss positiver Emotionen auf kognitive Prozesse und Entscheidungsfindung
- Mögliche Mechanismen, durch die positive Emotionen den „Subtyping“-Prozess beeinflussen können
- Die Rolle von Kapazität, Flexibilität und Motivation im Kontext von Stereotypen und Emotionen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Hausarbeit stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit vor. Es wird die Hypothese formuliert, dass positive Emotionen die Veränderung von Stereotypen durch „Subtyping“ verhindern können. Das zweite Kapitel definiert den Begriff „Stereotyp“ und diskutiert mögliche Entstehungsmechanismen. Zudem wird der Prozess des „Subtyping“ als Strategie zur Bewältigung von Stereotypen-Inkonsistenzen erläutert. Das dritte Kapitel widmet sich der Rolle von Emotionen bei der Veränderung von Stereotypen, wobei der Fokus auf positiven Emotionen liegt. Es wird eine Studie vorgestellt, die den Einfluss von Glück auf stereotypsches Denken untersucht. Abschließend werden mögliche Mechanismen diskutiert, durch die positive Emotionen den „Subtyping“-Prozess beeinflussen können.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe der vorliegenden Arbeit sind Stereotype, „Subtyping“, positive Emotionen, kognitive Prozesse, Kapazität, Flexibilität, Motivation, und Veränderung von Stereotypen. Die Hausarbeit untersucht, wie positive Emotionen die Verhinderung der Veränderung von Stereotypen durch „Subtyping“ beeinflussen können. Dabei wird auf die kognitiven Prozesse und Mechanismen eingegangen, die diesen Einfluss vermitteln.
Häufig gestellte Fragen zu positiven Emotionen und Stereotypen
Was ist „Subtyping“ im Zusammenhang mit Stereotypen?
Subtyping ist ein kognitiver Prozess, bei dem Ausnahmen von einem Stereotyp in eine Unterkategorie eingeordnet werden, um das ursprüngliche Stereotyp trotz widersprüchlicher Informationen beizubehalten.
Wie beeinflussen positive Emotionen das stereotype Denken?
Untersuchungen deuten darauf hin, dass Menschen in einem glücklichen Zustand eher dazu neigen, sich auf Heuristiken und Stereotype zu verlassen, anstatt Informationen tiefgründig zu verarbeiten.
Können positive Emotionen die Veränderung von Stereotypen verhindern?
Ja, die Hausarbeit analysiert, ob positive Emotionen den Subtyping-Prozess verstärken und dadurch verhindern, dass ein allgemeines Stereotyp durch Gegenbeispiele korrigiert wird.
Welche Rolle spielt die kognitive Kapazität dabei?
Es wird diskutiert, ob positive Emotionen die kognitive Kapazität oder Flexibilität einschränken, was zu einer oberflächlicheren Informationsverarbeitung führt.
Was besagt die Studie von Bodenhausen et al. (1994)?
Die Studie zeigt, dass „Happiness“ (Glück) die Wahrscheinlichkeit erhöht, in sozialen Urteilen auf Stereotype zurückzugreifen, da die Motivation zur systematischen Analyse sinkt.
- Quote paper
- Christian Richter (Author), 2003, Effekte von positiven Emotionen auf die Verhinderung der Veränderung von Stereotypen durch subtyping, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52161