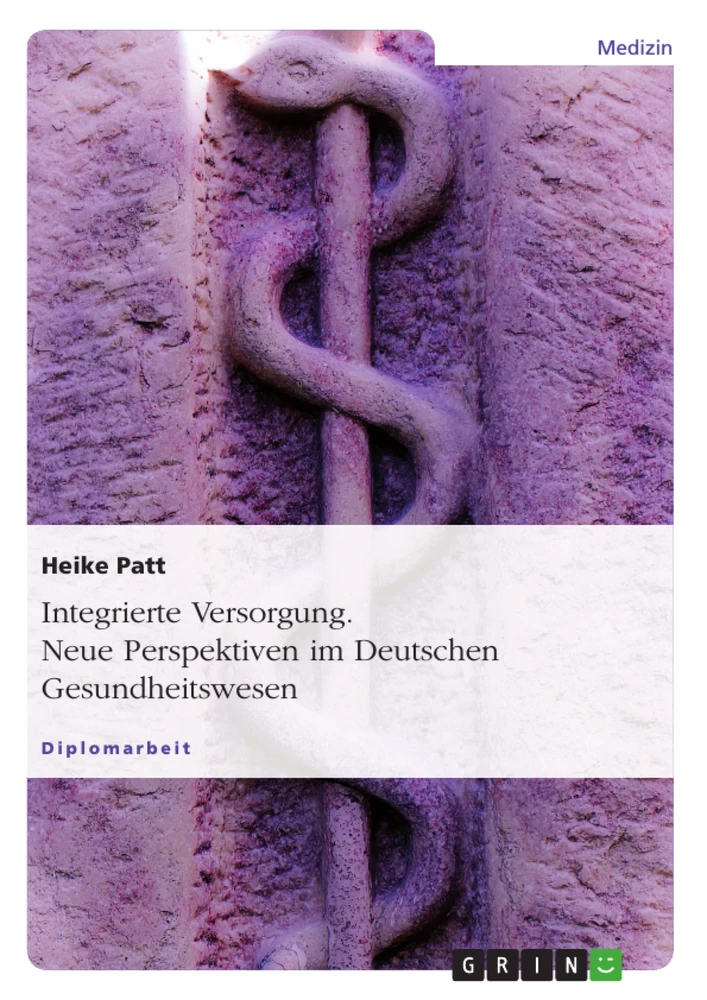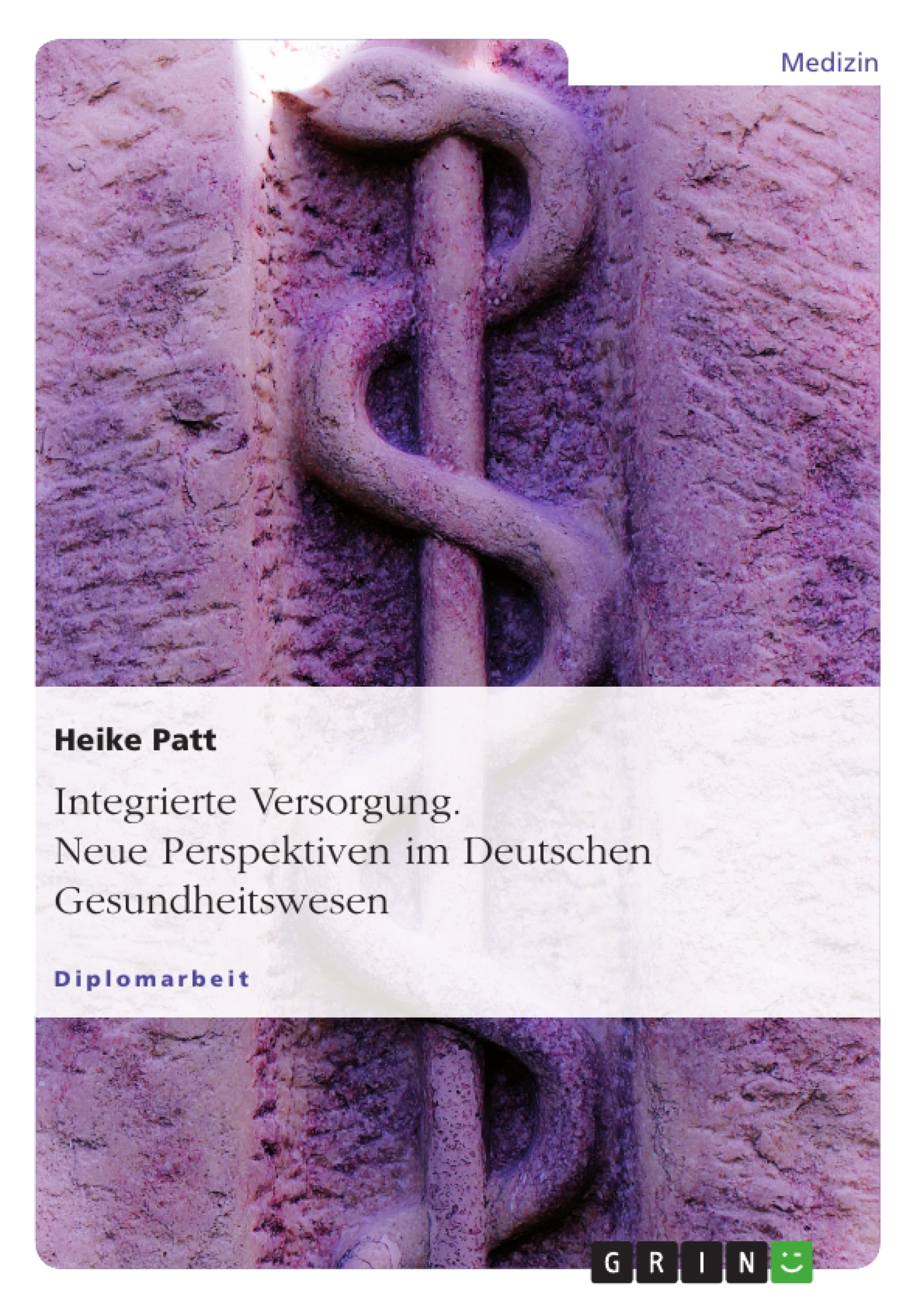Das Deutsche Gesundheitssystem steht vor dem Wandel.
Schon die vergangenen drei Jahrzehnte versuchte die Politik mit zahlreichen Reformen den Kostenanstieg einzudämmen.
Es gibt nur wenige Wirtschaftbereiche die in solch kurzer Zeit mit so vielen Gesetzesänderungen zu tun hatten, wie das Deutsche Gesundheitssystem. Schlagworte wie Verzahnung, Kooperation oder Vernetzung fielen bereits in den vergangenen Jahren, doch blieb es lediglich bei Gesprächen und Diskussionen.
Anstatt die Strukturen und Anreize des Systems zu verändern, wurde weiterhin eine Budgetierung und Rationierung verfolgt und der entscheidende Durchbruch blieb bis heute aus.
Die Einführung der Integrierten Versorgung (IV) durch die Gesundheitsreform 2000 war keineswegs eine Neuenddeckung für den maroden Gesundheitssektor.
Bereits im Jahr 1973 wurde durch das Institut des Deutschen Gewerkschaftsbundes ein Ausschuss von Wissenschaftlern und Praktikern ins Leben gerufen, mit der Aufgabe, eine Analyse der Notwendigkeit sowie den Möglichkeiten und Grenzen einer integrierten medizinischen Versorgung vorzunehmen. Das Ergebnis war erwartungsgemäß positiv. Doch aufgrund der Beharrlichkeit vieler Leistungsanbieter konnte sich das neue System nicht durchsetzten. [...] Das Ziel der Arbeit ist es, dem Leser eine Übersicht vom System der Integrierten Versorgung
sowie deren mögliche Auswirkungen auf das Deutsche Gesundheitswesen zu verschaffen.
Zu ergänzen ist, dass die unter 5. aufgeführten Gedanken nicht abschließend sind. Zur
Umsetzung des Systems müssen Managementstrukturen aufgebaut werden, wie man sie in der
bisherigen Gesundheitsversorgung noch nicht kennt.
Leider kann aber im Rahmen dieser Arbeit nur ein Abriss über wesentliche Punkte der
Umsetzung gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Rahmenbedingungen im deutschen Gesundheitswesen
- 2.1 Sektorale Trennung und die daraus resultierenden Mängel
- 2.2 „Kostenexplosion“ im deutschen Gesundheitssystem und deren Ursachen
- 2.2.1 Ausgabenentwicklung im Gesundheitswesen
- 2.2.2 Demographische Entwicklung
- 2.2.3 Medizinisch-technischer Fortschritt
- 2.2.4 Angebotsinduzierte Nachfrage
- 2.3 Fazit
- 3 Integrierte Versorgung
- 3.1 Begriffsdefinitionen
- 3.1.1 Integrierte Versorgung
- 3.1.2 Integration
- 3.1.3 Kooperation und Koordination
- 3.2 Abgrenzung zur Regelversorgung, Modellvorhaben nach §§ 63-65 SGB V und Strukturverträgen nach § 73a SGB V
- 3.2.1 Regelversorgung
- 3.2.2 Modellvorhaben nach §§ 63-65 SGB V
- 3.2.3 Strukturverträge nach § 73a SGB V
- 3.3 Die Zielsetzung der Integrierten Versorgung
- 3.4 Vor- und Nachteile für Patienten der Integrierten Versorgung
- 3.5 Vor- und Nachteile für Leistungsanbieter der Integrierten Versorgung
- 4 Gesetzliche Grundlagen der integrierten Versorgung
- 4.1 Gesundheitsreform 2000 - § 140a-h SGB V
- 4.2 Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenkassen (GKV-Modernisierungsgesetz) - § 140a-d SGB V
- 4.2.1 Vertragspartner nach § 140b Abs. 1 SGB V
- 4.2.2 Verträge nach § 140b Abs. 3-5
- 4.2.3 Vergütung nach § 140c SGB V
- 4.2.4 Grundsatz der Beitragssatzstabilität nach § 140b Abs. 4 S 2 SGB V
- 4.2.5 Die Anschubfinanzierung, Bereinigung nach § 140d SGB V
- 4.2.5.1 Die Anschubfinanzierung
- 4.2.5.2 Die Budgetbereinigung
- 4.2.5.3 Registrierungsstelle zur Unterstützung der Umsetzung des §140d
- 4.3 Haftung bei Behandlungsfehlern in der Integrierten Versorgung
- 5 Die Umsetzung der Integrierten Versorgung
- 5.1 Unternehmensnetzwerke in der IV
- 5.2 Das Schnittstellenmanagement der IV
- 5.3 Das Informationsmanagement der IV
- 5.4 Das Qualitätsmanagement der IV
- 5.5 Behandlungspfade in der IV
- 5.6 Das Kostenmanagement der IV
- 6 Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die integrierte Versorgung im deutschen Gesundheitswesen. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen, gesetzlichen Grundlagen und die praktische Umsetzung der integrierten Versorgung zu analysieren. Dabei werden Vor- und Nachteile für Patienten und Leistungserbringer beleuchtet.
- Rahmenbedingungen der integrierten Versorgung
- Gesetzliche Grundlagen und Regulierung
- Praktische Umsetzung und Herausforderungen
- Vor- und Nachteile für Patienten und Leistungserbringer
- Kostenmanagement in der integrierten Versorgung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der integrierten Versorgung ein und skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit. Sie beleuchtet die Problemstellungen des bestehenden Systems, insbesondere die sektorale Trennung und die Kostenexplosion im deutschen Gesundheitswesen, um die Notwendigkeit integrierter Versorgungsmodelle aufzuzeigen. Die Einleitung dient als Grundlage für die nachfolgende detaillierte Untersuchung der integrierten Versorgung.
2 Rahmenbedingungen im deutschen Gesundheitswesen: Dieses Kapitel analysiert die wirtschaftlichen und demografischen Rahmenbedingungen des deutschen Gesundheitswesens. Es untersucht die sektorale Trennung von ambulanter und stationärer Versorgung und die daraus resultierenden Ineffizienzen. Besonderes Augenmerk liegt auf der „Kostenexplosion“ und den Ursachen wie der demografischen Entwicklung, dem medizinisch-technischen Fortschritt und der angebotsinduzierten Nachfrage. Das Kapitel bildet die Basis für das Verständnis der Herausforderungen, die die integrierte Versorgung zu bewältigen sucht.
3 Integrierte Versorgung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung der integrierten Versorgung. Es beleuchtet verschiedene Begriffsdefinitionen wie Integration, Kooperation und Koordination und setzt diese in Relation zur Regelversorgung und den Modellvorhaben nach §§ 63-65 SGB V sowie den Strukturverträgen nach § 73a SGB V. Die Zielsetzung der integrierten Versorgung wird erörtert, ebenso werden die Vor- und Nachteile für Patienten und Leistungserbringer detailliert analysiert.
4 Gesetzliche Grundlagen der integrierten Versorgung: Dieses Kapitel analysiert die gesetzlichen Grundlagen, beginnend mit der Gesundheitsreform 2000 und dem GKV-Modernisierungsgesetz. Es beschreibt die relevanten Paragraphen des SGB V, die Vertragspartner, die Vertragsgestaltung, die Vergütung und den Grundsatz der Beitragssatzstabilität. Die Anschubfinanzierung und die Budgetbereinigung werden im Detail beleuchtet, um die rechtlichen Rahmenbedingungen der integrierten Versorgung vollständig darzustellen. Die Haftungsfragen bei Behandlungsfehlern innerhalb integrierter Versorgungssysteme werden ebenfalls thematisiert.
5 Die Umsetzung der Integrierten Versorgung: Dieses Kapitel befasst sich mit den praktischen Aspekten der Umsetzung der integrierten Versorgung. Es behandelt die Rolle von Unternehmensnetzwerken, das Schnittstellenmanagement, das Informationsmanagement, das Qualitätsmanagement, die Gestaltung von Behandlungspfaden und das Kostenmanagement. Es wird analysiert, welche Herausforderungen sich in der Praxis stellen und welche Strategien zur erfolgreichen Implementierung erfolgreich eingesetzt werden können.
Schlüsselwörter
Integrierte Versorgung, Gesundheitswesen, Gesundheitsreform, SGB V, Kostenmanagement, Qualitätsmanagement, Gesundheitsökonomie, Kooperation, Koordination, Gesetzliche Krankenversicherung.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Integrierte Versorgung im deutschen Gesundheitswesen
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit analysiert die integrierte Versorgung im deutschen Gesundheitswesen. Sie untersucht die Rahmenbedingungen, gesetzlichen Grundlagen und die praktische Umsetzung der integrierten Versorgung, beleuchtet Vor- und Nachteile für Patienten und Leistungserbringer und befasst sich ausführlich mit dem Kostenmanagement.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die Rahmenbedingungen im deutschen Gesundheitswesen (sektorale Trennung, Kostenexplosion), die Definition und Abgrenzung der integrierten Versorgung, die relevanten gesetzlichen Grundlagen (Gesundheitsreform 2000, GKV-Modernisierungsgesetz, SGB V), die praktische Umsetzung (Unternehmensnetzwerke, Schnittstellen-, Informations- und Qualitätsmanagement, Behandlungspfade, Kostenmanagement) sowie die Vor- und Nachteile für Patienten und Leistungserbringer.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Rahmenbedingungen im deutschen Gesundheitswesen, Integrierte Versorgung (Definition, Abgrenzung, Ziele, Vor- und Nachteile), Gesetzliche Grundlagen der integrierten Versorgung (SGB V, Gesundheitsreform, GKV-Modernisierungsgesetz, Haftung), Umsetzung der integrierten Versorgung (praktische Aspekte, Herausforderungen, Strategien) und Schlussbemerkung.
Welche gesetzlichen Grundlagen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die relevanten Paragraphen des SGB V, insbesondere im Kontext der Gesundheitsreform 2000 und des GKV-Modernisierungsgesetzes. Sie befasst sich detailliert mit den Vertragsbedingungen, der Vergütung, dem Grundsatz der Beitragssatzstabilität, der Anschubfinanzierung und der Budgetbereinigung. Auch die Haftungsfragen bei Behandlungsfehlern werden thematisiert.
Welche Herausforderungen der Umsetzung der integrierten Versorgung werden diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Herausforderungen bei der Umsetzung der integrierten Versorgung, darunter das Schnittstellenmanagement, das Informationsmanagement, das Qualitätsmanagement, die Gestaltung von Behandlungspfaden und das Kostenmanagement. Es werden Strategien zur erfolgreichen Implementierung analysiert.
Wer profitiert von der integrierten Versorgung?
Die Arbeit untersucht die Vor- und Nachteile der integrierten Versorgung sowohl für Patienten als auch für Leistungserbringer. Während Patienten von einer besseren Koordination und Qualität der Versorgung profitieren können, müssen Leistungserbringer die Herausforderungen des komplexen Managements bewältigen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Integrierte Versorgung, Gesundheitswesen, Gesundheitsreform, SGB V, Kostenmanagement, Qualitätsmanagement, Gesundheitsökonomie, Kooperation, Koordination, Gesetzliche Krankenversicherung.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Zusammenfassung der Kapitel im Inhaltsverzeichnis bietet einen Überblick über die Inhalte jedes einzelnen Kapitels. Die Arbeit selbst liefert detaillierte Informationen und Analysen zu den jeweiligen Themen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Diplomarbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist es, die Rahmenbedingungen, gesetzlichen Grundlagen und die praktische Umsetzung der integrierten Versorgung im deutschen Gesundheitswesen zu analysieren und die Vor- und Nachteile für Patienten und Leistungserbringer zu beleuchten.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit dem deutschen Gesundheitswesen, der integrierten Versorgung und den damit verbundenen rechtlichen und praktischen Aspekten befassen, beispielsweise Studierende, Wissenschaftler, Praktiker im Gesundheitswesen und politische Entscheidungsträger.
- Quote paper
- Heike Patt (Author), 2006, Integrierte Versorgung. Neue Perspektiven im Deutschen Gesundheitswesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52189