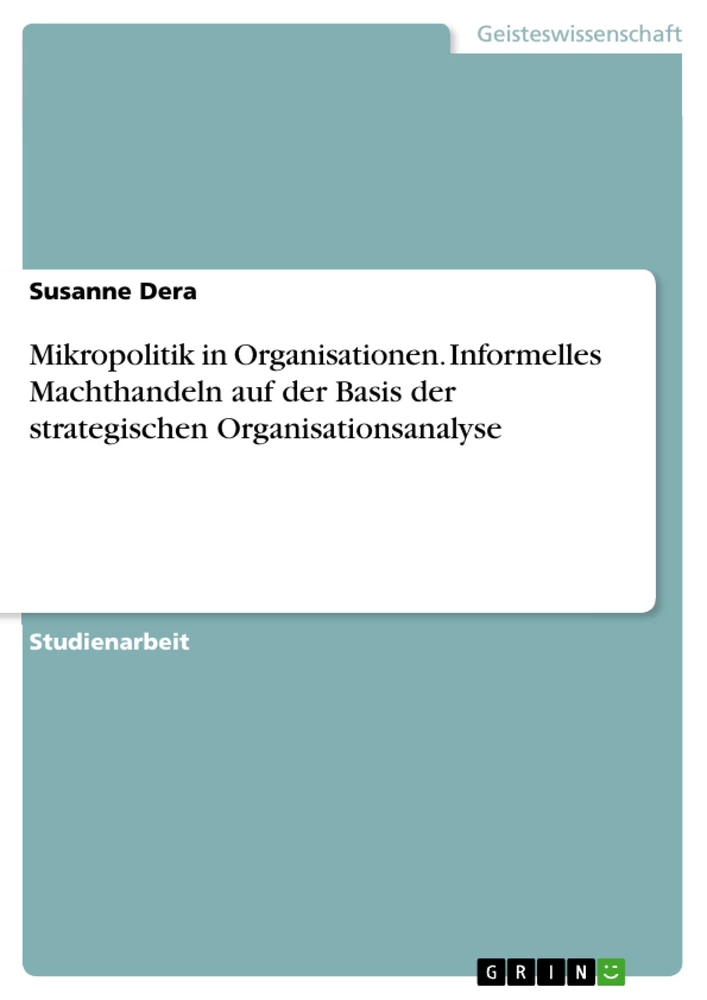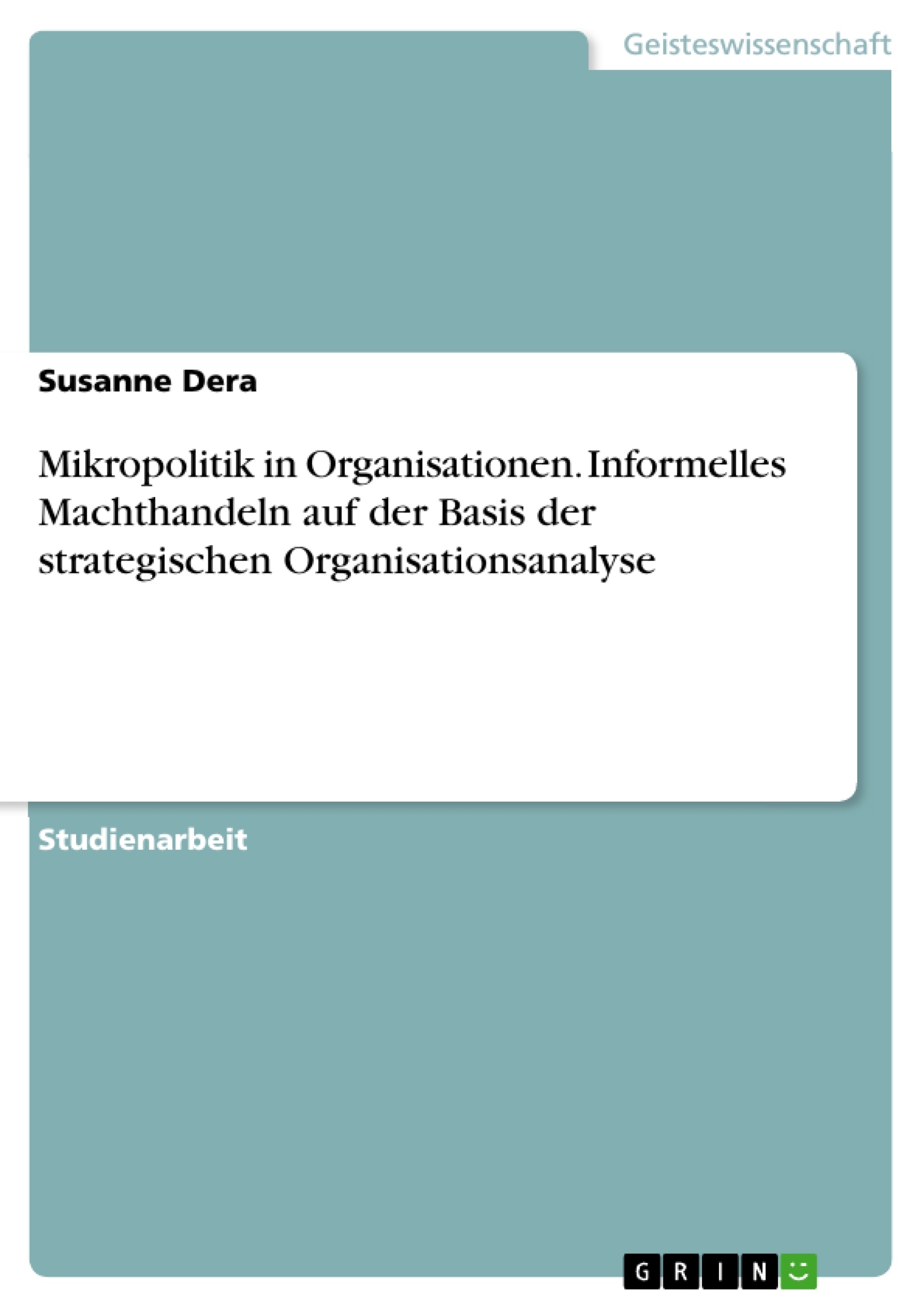Die vorliegende Arbeit widmet sich dem allseits gegenwärtigen Phänomen der Mikropolitik in Organisationen. Informelle Machthandeln ist in allen Organisationen an der Tagesordnung und prägt das tägliche Miteinander in nicht zu unterschätzender Art und Weise. Da es zum Teil die formalen Strukturen überlagert und den Ablauf innerhalb der Organisationen bedeutend prägt, lohnt es sich, die informellen Mechanismen des Machthandelns näher zu beleuchten und zu analysieren.
Dafür ist es notwendig, sich zunächst den Paradigmenwechsel des Organisationsbegriffes vor Augen zu führen: Organisationen werden nicht länger als zweckrationale Gebilde begriffen, sondern als „lebensweltlich konstruierte Handlungszusammenhänge“. Um die Entwicklung der mikropolitischen Konzeptionen aufzeigen zu können, wird eines der Basismodelle der mikropolitischen Konzeptionen, das Modell der strategischen Organisationsanalyse von Crozier und Friedberg, vorgestellt und näher erläutert. Dieses Modell vereint alle zentralen Elemente der mikropolitischen Ansätze in sich und es lässt sich anhand der von ihm dargestellten Dialektik von Freiheit und Zwang sehr treffend aufzeigen, wo mikropolitisches Handeln möglich und wahrscheinlich wird. Dieses Basimodell verbunden mit Anthony Giddens „Theorie der Strukturierung“ soll helfen, die zentralen Fragestellungen des vorliegenden Werkes zu beantworten: Was ist Mikropolitik? Wie und warum entsteht sie? Wodurch wird mikropolitisches Handeln möglich und wodurch wird es eingegrenzt?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Organisationsbegriff mikropolitischer Konzeptionen
- Basismodelle der mikropolitischen Konzeptionen
- Crozier / Friedbergs Modell der strategischen Organisationsanalyse
- Strategie
- Macht
- Spiel
- Kritische Würdigung
- Anthony Giddens Theorie der Strukturierung
- Dualität der Struktur
- Kontrolle und Konsens als Dialektik
- Crozier / Friedbergs Modell der strategischen Organisationsanalyse
- Mikropolitik
- Definition
- Begriffsbestandteile
- Was ist mikropolitisches Handeln?
- Der mikropolitische Akteur und seine spezifische Macht
- Folgen von Mikropolitik
- Funktionale Folgen
- Dysfunktionale Folgen
- Theoretische Modelle mikropolitischer Konzeptionen
- Psychologische Modelle
- Soziologische Modelle
- Kritikansätze an mikropolitischen Konzeptionen
- Schlußbemerkung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Phänomen Mikropolitik, also das informelle Machthandeln in Organisationen. Sie beleuchtet den Wandel des Organisationsbegriffes, indem Organisationen nicht länger als rein zweckrationale Gebilde betrachtet werden, sondern als „lebensweltlich konstruierte Handlungszusammenhänge“.
- Der Wandel des Organisationsbegriffes in mikropolitischen Konzeptionen
- Die strategische Organisationsanalyse nach Crozier und Friedberg
- Die Theorie der Strukturierung von Anthony Giddens
- Die Definition und die Begriffsbestandteile von Mikropolitik
- Die Folgen von Mikropolitik in Organisationen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik der Mikropolitik in Organisationen vor und führt den Paradigmenwechsel des Organisationsbegriffes ein. Sie betont die Bedeutung des Modells der strategischen Organisationsanalyse von Crozier und Friedberg, da es zentrale Elemente mikropolitischer Ansätze integriert.
- Der Organisationsbegriff mikropolitischer Konzeptionen: Dieses Kapitel analysiert den Organisationsbegriff aus der Perspektive mikropolitischer Konzeptionen. Organisationen werden nicht länger als zweckrationale Gebilde, sondern als Handlungszusammenhänge mehrerer Individuen betrachtet, die ihre eigenen Kulturen ausbilden. Die Organisationsziele werden als Handlungsprodukt verstanden und nicht als Handlungsursache.
- Basismodelle der mikropolitischen Konzeptionen: Dieses Kapitel widmet sich den Basismodellen der mikropolitischen Konzeptionen. Das Modell der strategischen Organisationsanalyse von Crozier/Friedberg steht im Zentrum der Diskussion. Es definiert kollektives Handeln als ein gesellschaftlich herausgebildetes Konstrukt. Die Organisation wird als „Arena“ angesehen, in der der Konflikt zwischen den Mitgliedern auf der Ausübung und Anhäufung von Macht basiert. Die „Theorie der Strukturierung“ von Anthony Giddens wird als ergänzendes Basismodell vorgestellt, da sie sich eignet, das Modell von Crozier und Friedberg zu stützen und zu erweitern.
- Mikropolitik: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Mikropolitik, beschreibt ihre Begriffsbestandteile und erörtert die Frage, was mikropolitisches Handeln ausmacht. Es behandelt den mikropolitischen Akteur und seine spezifische Macht und analysiert die Folgen von Mikropolitik, sowohl die funktionalen als auch die dysfunktionalen Folgen.
- Theoretische Modelle mikropolitischer Konzeptionen: Dieses Kapitel stellt verschiedene theoretische Modelle mikropolitischer Konzeptionen vor, die in psychologische und soziologische Modelle unterteilt werden.
- Kritikansätze an mikropolitischen Konzeptionen: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Kritikansätze an den mikropolitischen Konzeptionen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Mikropolitik, informelles Machthandeln, Organisationsbegriff, strategische Organisationsanalyse, Crozier/Friedberg, Theorie der Strukturierung, Anthony Giddens, Akteur, Macht, Interessen, Konflikte, Handlungszusammenhänge, Lebenswelt.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Soz. Susanne Dera (Autor:in), 1999, Mikropolitik in Organisationen. Informelles Machthandeln auf der Basis der strategischen Organisationsanalyse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52255