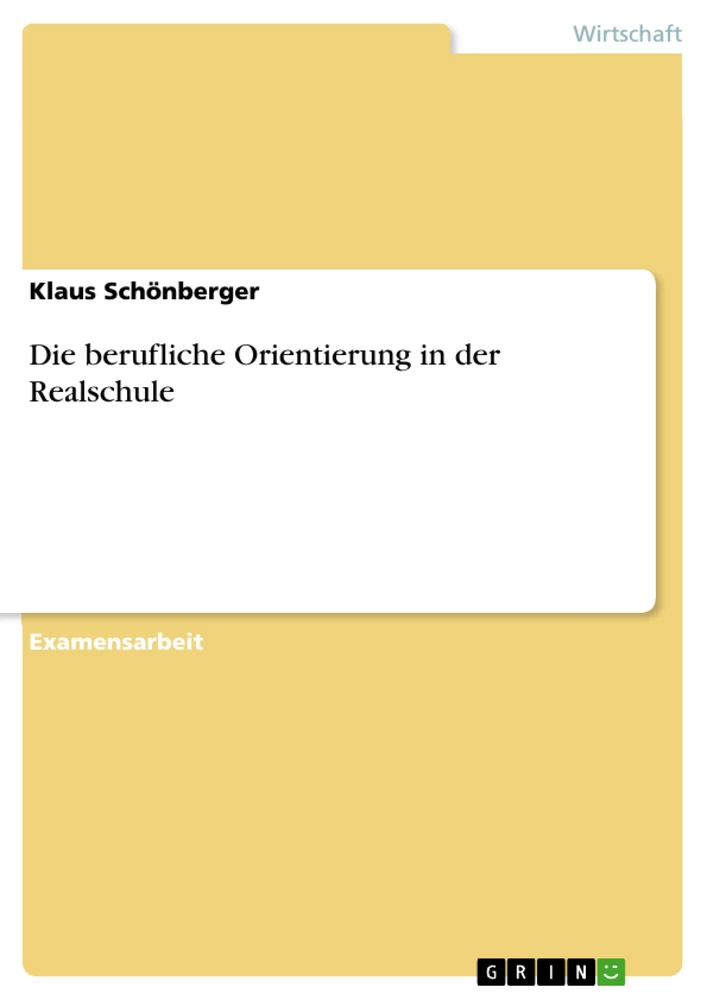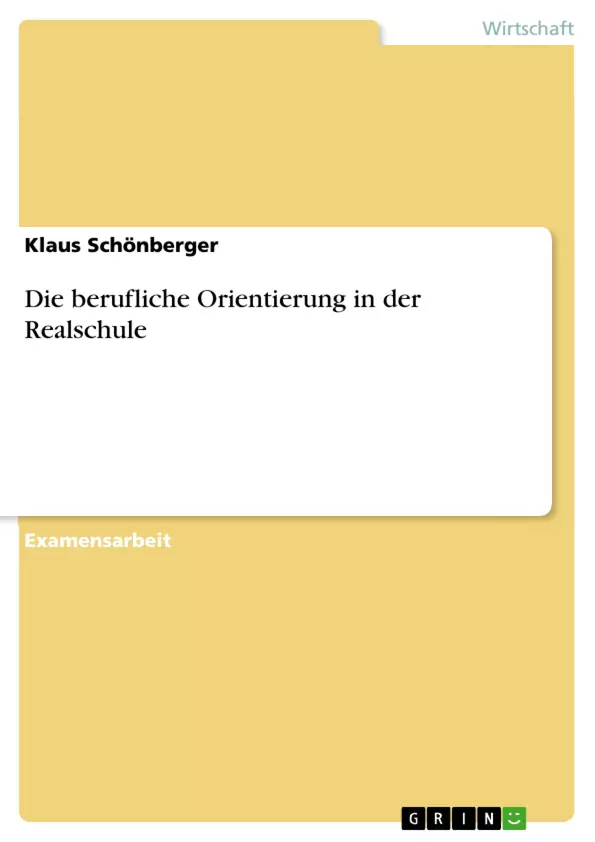Der Beruf stellt eine in der Regel langfristige und auf Einkommenserzielung ausgerichtete Tätigkeit dar. Der berufliche Lohn bildet die wirtschaftliche Existenzgrundlage und nimmt dadurch großen Einfluss auf die soziale Stellung in der Gesellschaft und auf die finanziellen Möglichkeiten des Einzelnen. Obwohl durch das soziale System in Deutschland versucht wird, jedem Bürger ein Mindestmaß an finanzieller Sicherheit zu garantieren, spielt die Berufstätigkeit für die Erfüllung, Freude und Selbstverwirklichung eines Gesellschaftsmitglieds eine entscheidende Rolle. Das Rechtssystem der BRD stellt es grundsätzlich jedem Bürger frei, einen beliebigen Beruf zu wählen. Bevor eine Entscheidung für ein bestimmtes Berufziel fällt ist es wichtig, sich intensiv mit den persönlichen Voraussetzungen auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall sollten die eigen Interessen mit den Inhalten des zukünftigen Berufs zusammenpassen. Dies allein reicht aber meist nicht aus: Damit die Anforderungen eines bestimmten Berufs auch erfüllt werden können braucht man auch die entsprechenden Fähigkeiten. Die Auseinandersetzung mit persönlichen Interessen und Fähigkeiten kann die Aufmerksamkeit auf bestimmte Berufe lenken. Das Überangebot an unterschiedlichen Möglichkeiten wird so eingegrenzt und überschaubar.
Inhaltsverzeichnis
- I. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- II. KLÄRUNG DER ZIELSETZUNG
- 1 BEGRÜNDUNG VON DER SACHE HER
- BERUFSWAHL – PERSÖNLICHE ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN
- 1.1.1 Freie Berufswahl
- 1.1.2 Interessen
- 1.1.3 Fähigkeiten
- 1.2 BERUFSWAHL - ANFORDERUNGEN UND ERWARTUNGEN DER BETRIEBE
- 1.2.1 Berufsbilder und Anforderungsprofile
- 1.2.2 Allgemeine Erwartungen an Auszubildende
- 1.3 BEWERBUNG
- 1.3.1 Bewerbungsunterlagen
- 1.3.2 Einstellungstest
- 1.3.3 Vorstellungsgespräch und Assessment Center
- 1.4 BERUFSAUSBILDUNG
- 1.4.1 Betriebliche Berufsausbildung
- 1.4.2 Duales System
- 1.5 JUGENDARBEITSSCHUTZ
- 1.5.1 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
- 1.5.2 Arbeitszeit
- 1.5.3 Pausen
- 1.5.4 Urlaub
- 1.5.5 Berufsschule
- 1.5.6 Beschäftigungsverbote
- 1.6 ARBEITSRECHT
- 1.6.1 Europäisches Recht
- 1.6.2 Grundgesetz
- 1.6.3 Arbeitsrechtliche Gesetze
- 1.6.4 Tarifverträge
- 1.6.5 Betriebsvereinbarungen
- 1.6.6 Arbeitsvertrag
- 1.6.7 Betriebliche Übung
- 1.6.8 Richterliche Rechtsfindung
- 1.7 KÜNDIGUNG UND KÜNDIGUNGSSCHUTZ
- 1.7.1 Kündigung
- 1.7.2 Allgemeiner Kündigungsschutz
- 1.7.3 Mutterschutz
- 1.7.4 Schutz von Behinderten
- 1.7.5 Schutz von Betriebsratmitgliedern
- 1.8 BETRIEBLICHE MITBESTIMMUNG
- 1.8.1 Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)
- 1.8.2 Der Betriebsrat
- 1.8.3 Die Jugend- und Auszubildendenvertretung
- 1.8.4 Die Betriebsversammlung
- 1.8.5 Der Wirtschaftsauschuss
- 1.8.6 Die Einigungsstelle
- 1.9 MITBESTIMMUNG IM UNTERNEHMEN
- 1.9.1 Montan-Mitbestimmungsgesetz von 1951 (Montan-MitbestG)
- 1.9.2 Mitbestimmungsgesetz von 1976 (MitbestG)
- 1.9.3 Drittelbeteiligungsgesetz von 2004 (DrittelbG)
- 2 BEGRÜNDUNG VOM BILDUNGSZIEL HER
- 2.1 BEITRAG ZUR FACHLICHEN BILDUNG
- 2.2 BEITRAG ZUR BEWÄLTIGUNG SPEZIFISCHER LEBENSSITUATIONEN
- 2.3 BEITRAG ZUR HALTUNGSBILDUNG
- 3 BEGRÜNDUNG VON DER INDIVIDUALLAGE HER
- III. PLANUNG UND BEGRÜNDUNG DES METHODISCHEN ENTWURFS
- 1 UNTERRICHTSFORMEN
- 1.1 SZENARIO
- 1.2 ROLLENSPIEL
- 1.3 LEHRERVORTRAG
- 1.4 LEHRER-SCHÜLER-GESPRÄCH
- 1.5 EINZELARBEIT
- 1.6 PARTNER- UND GRUPPENARBEIT
- 1.7 BRAINSTORMING
- 1.8 LERNZIRKEL
- 1.9 REFERATE
- 2 AUSWAHL UND EINSATZ VON UNTERRICHTSMEDIEN
- 2.1 LEHRER UND SCHÜLER
- 2.2 TAGESLICHTPROJEKTOR UND ARBEITSTRANSPARENT
- 2.3 FERNSEHGERÄT - VIDEOREKORDER - VHS-KASSETTE
- 2.4 COMPUTER MIT INTERNETANSCHLUSS
- 2.5 TAFELBILD
- 2.6 ARBEITSBLATT
- 2.7 SCHULBUCH
- 2.8 ZEITUNGS- UND ZEITSCHRIFTENAUSSCHNITTE
- 2.9 GESETZESTEXTE
- 2.10 SONSTIGE TEXTMEDIEN
- 3 DIE ORGANISATION DES UNTERRICHTSABLAUFS
- IV. STUNDENVERTEILUNG
- 1. STUNDE 1: BERUFSWAHL - INTERESSEN UND FÄHIGKEITEN
- 1.1 FESTLEGUNG DER LERNZIELE
- 1.2 DER GESTALTUNGSGEDANKE
- 1.3 DIE METHODISCHE STRUKTUR
- 1.4 PLAN DER DURCHFÜHRUNG
- 2 STUNDE 2: BERUFSWAHL - ANFORDERUNGEN UND ERWARTUNGEN DER Betriebe
- 2.1 FESTLEGUNG DER LERNZIELE
- 2.2 DER GESTALTUNGSGEDANKE
- 2.3 DIE METHODISCHE STRUKTUR
- 2.4 PLAN DER DURCHFÜHRUNG
- 3 STUNDE 3: BEWERBUNG
- 3.1 FESTLEGUNG DER LERNZIELE
- 3.2 DER GESTALTUNGSGEDANKE
- 3.3 DIE METHODISCHE STRUKTUR
- 3.4 PLAN DER DURCHFÜHRUNG
- 4 STUNDE 4: BERUFSAUSBILDUNG
- 4.1 FESTLEGUNG DER LERNZIELE
- 4.2 DER GESTALTUNGSGEDANKE
- 4.3 DIE METHODISCHE STRUKTUR
- 4.4 PLAN DER DURCHFÜHRUNG
- 5 STUNDE 5: JUGENDARBEITSSCHUTZ
- 5.1 FESTLEGUNG DER LERNZIELE
- 5.2 DER GESTALTUNGSGEDANKE
- 5.3 DIE METHODISCHE STRUKTUR
- 5.4 PLAN DER DURCHFÜHRUNG
- 6 STUNDE 6: ARBEITSRECHT
- 6.1 FESTLEGUNG DER LERNZIELE
- 6.2 DER GESTALTUNGSGEDANKE
- 6.3 DIE METHODISCHE STRUKTUR
- 6.4 PLAN DER DURCHFÜHRUNG
- 7 STUNDE 7: KÜNDIGUNG UND KÜNDIGUNGSSCHUTZ
- 7.1 FESTLEGUNG DER LERNZIELE
- 7.2 DER GESTALTUNGSGEDANKE
- 7.3 DIE METHODISCHE STRUKTUR
- 7.4 PLAN DER DURCHFÜHRUNG
- 8 STUNDE 8: BETRIEBLICHE MITBESTIMMUNG
- 8.1 FESTLEGUNG DER LERNZIELE
- 8.2 DER GESTALTUNGSGEDANKE
- 8.3 DIE METHODISCHE STRUKTUR
- 8.4 PLAN DER DURCHFÜHRUNG
- 9 STUNDE 9: MITBESTIMMUNG AUF UNTERNEHMENSEBENE
- 9.1 FESTLEGUNG DER LERNZIELE
- 9.2 DER GESTALTUNGSGEDANKE
- 9.3 DIE METHODISCHE STRUKTUR
- 9.4 PLAN DER DURCHFÜHRUNG
- V. LITERATURANGABEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die berufliche Orientierung in der Realschule mit dem Ziel, einen Beitrag zur fachlichen Bildung, zur Bewältigung spezifischer Lebenssituationen und zur Haltungsbildung der Schülerinnen und Schüler zu leisten. Die Arbeit betrachtet verschiedene Aspekte der Berufswahl, Bewerbung, Berufsausbildung, Arbeitsrechts sowie der betrieblichen Mitbestimmung.
- Individuelle Entscheidungsfaktoren der Berufswahl
- Anforderungen und Erwartungen der Betriebe an Auszubildende
- Rechtliche Aspekte der Berufsausbildung und des Arbeitsrechts
- Mitbestimmung in Unternehmen
- Praktische Umsetzung der beruflichen Orientierung im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I. Abkürzungsverzeichnis: Dieses Kapitel enthält eine Liste der Abkürzungen, die in der Arbeit verwendet werden.
- Kapitel II. Klärung der Zielsetzung: Dieser Teil befasst sich mit den Zielen der Hausarbeit und beleuchtet die Bedeutung der beruflichen Orientierung in der Realschule. Er betrachtet die Thematik aus unterschiedlichen Perspektiven, z. B. der gesellschaftlichen, pädagogischen und individuellen.
- Kapitel III. Planung und Begründung des Methodischen Entwurfs: In diesem Kapitel werden die Unterrichtsformen, die Auswahl der Unterrichtsmedien sowie die Organisation des Unterrichtsablaufs erläutert. Es wird ein methodischer Entwurf für die praktische Umsetzung der Inhalte der beruflichen Orientierung im Unterricht vorgestellt.
- Kapitel IV. Stundenverteilung: Dieses Kapitel gliedert die Themengebiete der beruflichen Orientierung in einzelne Unterrichtseinheiten. Für jede Stunde werden Lernziele, methodische Vorgehensweise und konkrete Unterrichtsaktivitäten beschrieben.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit fokussiert auf die berufliche Orientierung in der Realschule und behandelt Themen wie Berufswahl, Bewerbung, Berufsausbildung, Arbeitsrecht, Jugendarbeitsschutz, betriebliche Mitbestimmung und Mitbestimmung auf Unternehmensebene.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Realschule bei der Berufswahl?
Die Realschule bereitet Schüler durch berufsorientierende Maßnahmen, Praktika und Unterrichtsfächer wie Wirtschaft auf den Übergang in das Berufsleben oder weiterführende Schulen vor.
Was sind wichtige Entscheidungskriterien bei der Berufswahl?
Dazu gehören persönliche Interessen, individuelle Fähigkeiten und Talente sowie die Anforderungen und Zukunftsaussichten des jeweiligen Berufsfeldes.
Was ist das Duale System der Berufsausbildung?
Es ist die parallele Ausbildung in einem Betrieb (praktisch) und in der Berufsschule (theoretisch), was als Markenzeichen der deutschen Berufsbildung gilt.
Welche Rechte schützt das Jugendarbeitsschutzgesetz?
Es regelt Arbeitszeiten, Pausen, Urlaubsansprüche und Beschäftigungsverbote für Jugendliche unter 18 Jahren, um deren Gesundheit und Entwicklung zu schützen.
Was gehört in eine vollständige Bewerbungsmappe?
Dazu zählen das Anschreiben, ein tabellarischer Lebenslauf mit Foto sowie Kopien der letzten Zeugnisse und Praktikumsbescheinigungen.
- Quote paper
- Klaus Schönberger (Author), 2005, Die berufliche Orientierung in der Realschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52269