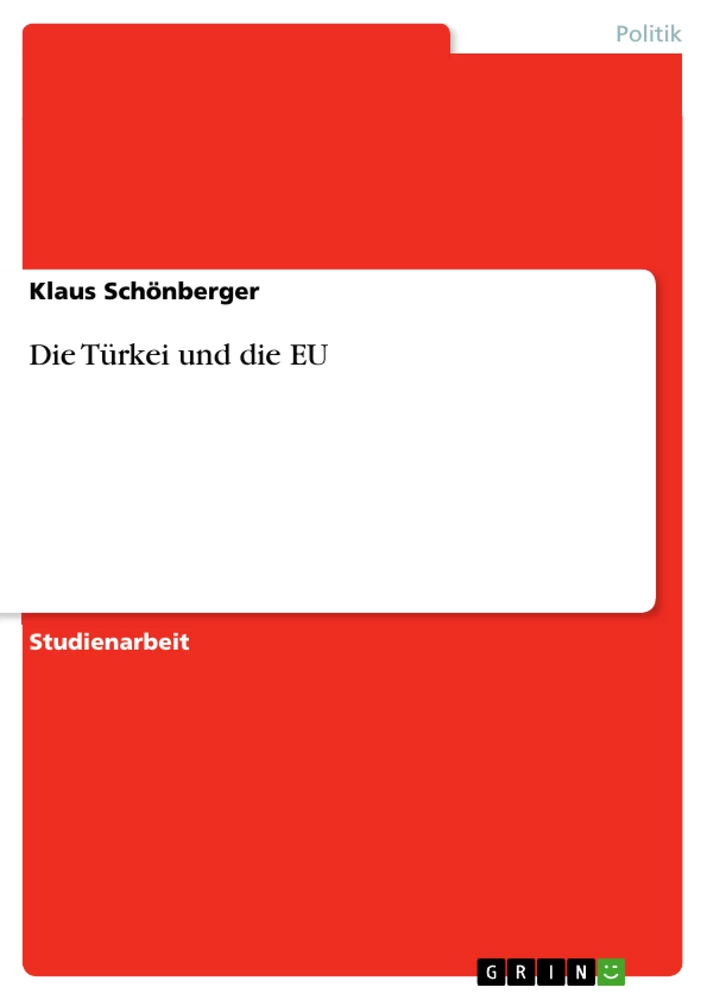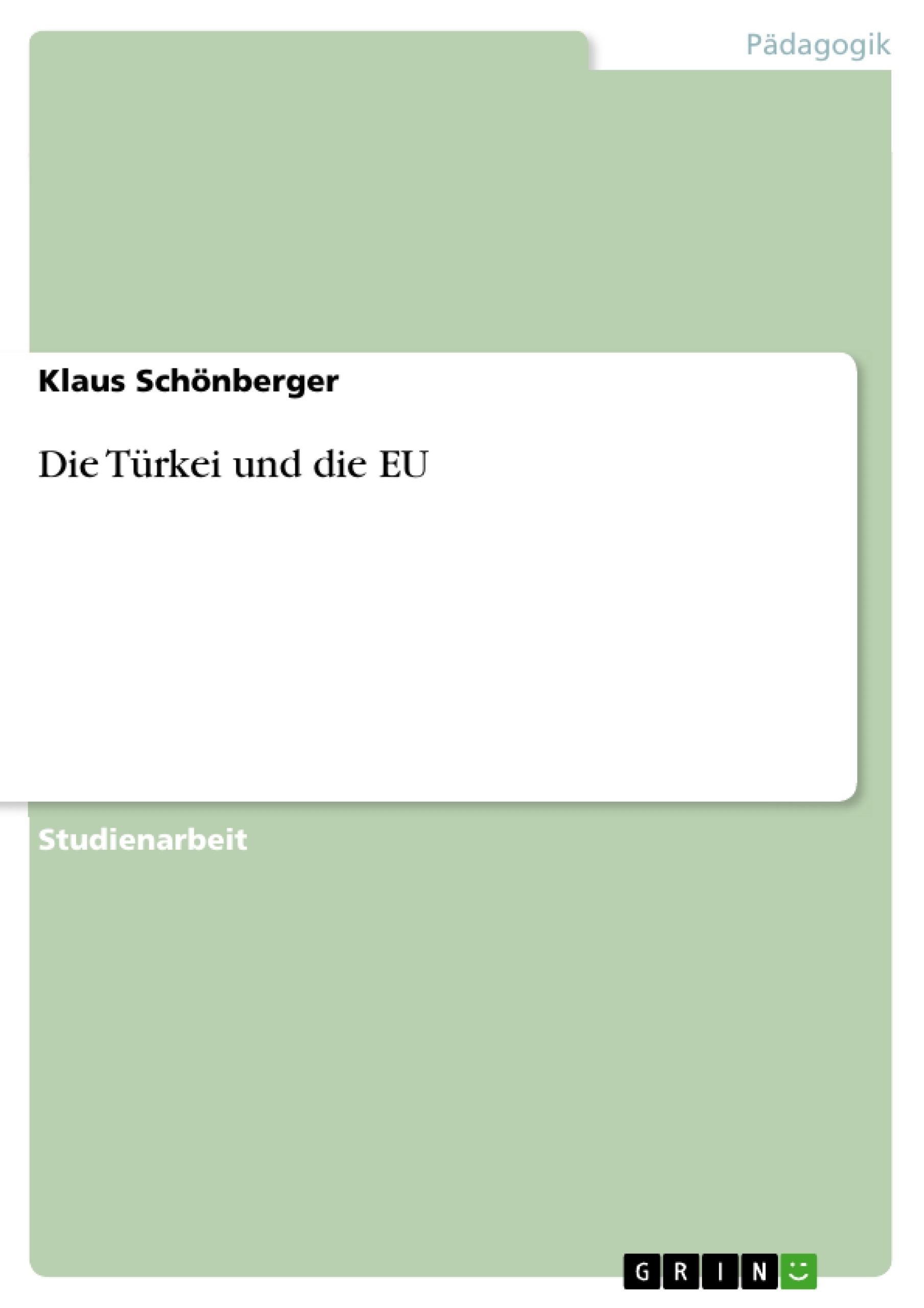Die Debatte um einen möglichen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union spielt in der politischen Diskussion auf nationaler Ebene in den einzelnen Mitgliedsstaaten und auf europäischer Ebene in den Organen der Europäischen Union eine wichtige Rolle. Das Thema spaltet die EU-Bevölkerung und politische Machtträger in Befürworter und Gegner einer Aufnahme der Türkei. Diese Diskussion ist aber keinesfalls so neu wie sie vielleicht erscheinen mag. Seit über 40 Jahren besteht ein konkretes Interesse von Seiten der Türkei, in die Union aufgenommen zu werden. 1963 wurde ein Assoziationsvertrag zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Türkei geschlossen, in dem die Perspektive auf eine spätere Vollmitgliedschaft beinhaltet war. Seit diesem Ereignis vor knapp einem halben Jahrhundert arbeiten türkische Politiker an einer Annäherung ihres Landes an die EU. Zum ersten Mal wurde 1987 ein Antrag auf eine Vollmitgliedschaft gestellt, der zwei Jahre später von der EU abgelehnt wurde, ohne dabei eine spätere Mitgliedschaft prinzipiell auszuschließen. So kam es 1999 dazu, dass die EU der Türkei den Status eines Beitrittskandidaten zuerkannte. Ein möglicher Beitritt war jedoch an die Erfüllung der 1993 formulierten Kopenhagener Kriterien gebunden, die jedes potentielle neue Mitglied vor einem Beitritt erfüllen muss. Für die Türkei stellte die Aufstellung der Kriterien einerseits konkrete objektive Anhaltspunkte dar, an denen man sich bei der Annäherung an die EU orientieren konnte und deren Erfüllung einen Beitritt zur EU gewissermaßen unvermeidlich machen würde. „Denn die Kriterien sollten für alle Länder gleichermaßen gelten, die an einem Beitritt interessiert waren - deshalb würde es höchst schwierig, anderen Ländern bei der Erfüllung den Beitritt zu gestatten, der Türkei das gleiche aber zu verwehren.
Inhaltsverzeichnis
- DIE TÜRKEI AUF DEM WEG ZUR EU-MITGLIEDSCHAFT
- DIE REPUBLIK TÜRKEI
- GEOGRAPHISCHE LAGE
- BEVÖLKERUNG
- RELIGION
- POLITIK
- WIRTSCHAFT
- DER LANGE WEG ZUM VERHANDLUNGSBEGINN
- DAS OSMANISCHE REICH
- ANPASSUNG AN EUROPA UNTER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SEIT 1923
- MITGLIEDSCHAFT IN WESTLICHEN ORGANISATIONEN NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG
- ASSOZIERUNGSABKOMMEN 1963
- REAKTIVIERUNG DER BEZIEHUNGEN IN DEN 80ER JAHREN
- ZOLLUNION 1995
- STATUS EINES KANDIDATEN FÜR DIE VOLLMITGLIEDSCHAFT 1999
- EU-BEITRITTSPARTNERSCHAFT 2001
- ZYPERNFRAGE
- VERHANDLUNGSBEGINN 2005
- PRO- UND CONTRADEBATTE
- GRENZZIEHUNG
- POLITISCHE ÜBERLASTUNG DER EU
- MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN
- KURDENPROBLEMATIK
- VÖLKERMORD AN DEN ARMENIERN
- BEVÖLKERUNGSWACHSTUM
- WIRTSCHAFTLICHE ÜBERFORDERUNG DER EU
- KULTURELLE ANDERSARTIGKEIT UND INTEGRATION
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Türkei auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft und analysiert die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Beziehungen zwischen der Türkei und der EU und diskutiert die wichtigsten Argumente für und gegen einen möglichen Beitritt.
- Die historische Entwicklung der Beziehungen zwischen der Türkei und der EU
- Die Kopenhagener Kriterien für den EU-Beitritt und deren Bedeutung für die Türkei
- Die Pro- und Contra-Argumente im Hinblick auf eine türkische EU-Mitgliedschaft
- Die Auswirkungen eines möglichen Beitritts auf die EU und die Türkei
- Die Bedeutung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Unterschiede zwischen der Türkei und der EU
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Beziehungen zwischen der Türkei und der EU, beginnend mit dem Assoziationsvertrag von 1963. Es werden die verschiedenen Phasen der Annäherung, die Hürden und Herausforderungen sowie die Fortschritte, die die Türkei auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft gemacht hat, dargestellt. Im zweiten Kapitel wird die Republik Türkei in ihren geographischen, demographischen, religiösen, politischen und wirtschaftlichen Dimensionen vorgestellt. Es werden wichtige Aspekte wie die Bevölkerungsstruktur, das Verhältnis zwischen Türken und Kurden, die Rolle des Islams in der türkischen Gesellschaft und die politische Systematik näher beleuchtet. Das dritte Kapitel behandelt die Pro- und Contra-Argumente im Hinblick auf einen möglichen Beitritt der Türkei zur EU. Es werden verschiedene Perspektiven und Standpunkte diskutiert, die sich mit den möglichen Auswirkungen eines Beitritts auf die EU und die Türkei befassen. Hierzu zählen die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Unterschiede zwischen der Türkei und der EU sowie die Herausforderungen in Bezug auf Menschenrechte, die Kurdenfrage und die Integrationsprozesse.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Türkei und ihrer Beziehung zur Europäischen Union. Wichtige Schlüsselbegriffe sind EU-Beitritt, Kopenhagener Kriterien, Assoziationsvertrag, islamische Religion, Kurdenfrage, Bevölkerungswachstum, politische Reform, wirtschaftliche Entwicklung, kulturelle Unterschiede und Integrationsprozesse.
Häufig gestellte Fragen zum EU-Beitritt der Türkei
Seit wann möchte die Türkei Mitglied der EU werden?
Das Interesse besteht seit über 40 Jahren; bereits 1963 wurde ein Assoziationsvertrag mit der EWG geschlossen.
Was sind die „Kopenhagener Kriterien“?
Es sind objektive Anforderungen (politisch, wirtschaftlich, rechtlich), die jeder Beitrittskandidat erfüllen muss, um EU-Mitglied werden zu können.
Welche politischen Hürden werden oft genannt?
Zentrale Themen der Debatte sind Menschenrechtsverletzungen, die Kurdenproblematik, die Zypernfrage und der Völkermord an den Armeniern.
Welche wirtschaftlichen Argumente gibt es gegen einen Beitritt?
Kritiker befürchten eine wirtschaftliche Überforderung der EU aufgrund der Größe der Türkei und des starken Bevölkerungswachstums.
Welche Rolle spielt die Religion in der Debatte?
Die kulturelle Andersartigkeit und die Rolle des Islam werden häufig als Herausforderungen für die Integration in die europäische Wertegemeinschaft diskutiert.
- Citation du texte
- Klaus Schönberger (Auteur), 2005, Die Türkei und die EU, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52271