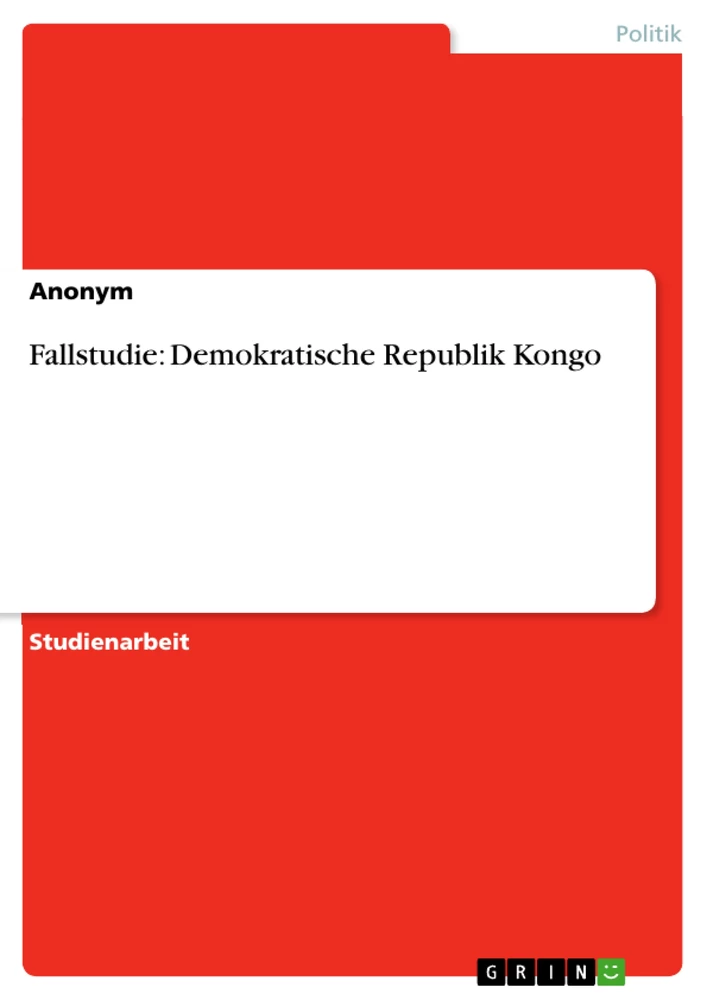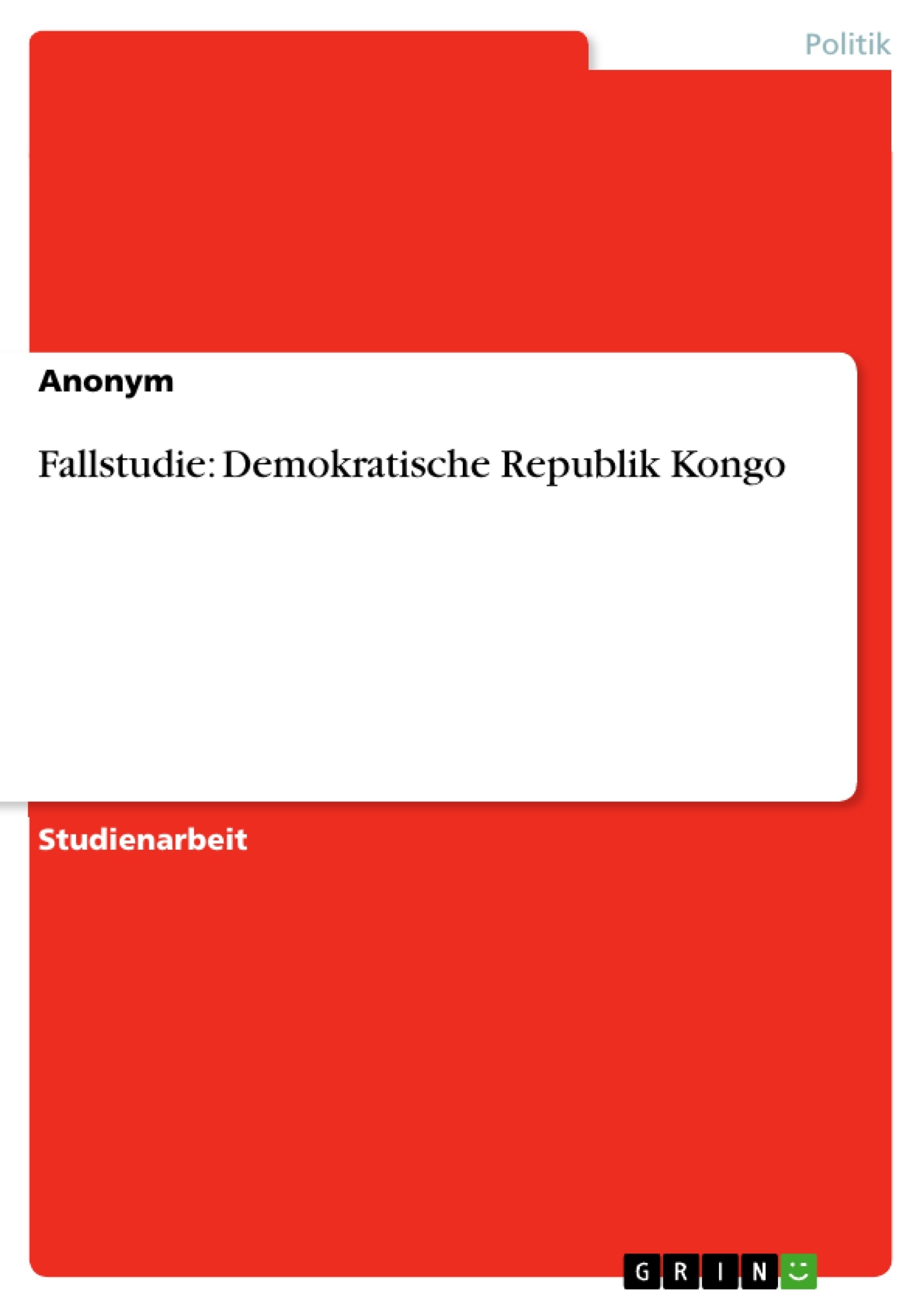Auch heute noch wird Krieg in den Köpfen der Menschen weitgehend nach der Definition von Clausewitz als Fortführung der Politik mit anderen Mitteln verstanden, in dem sich Soldaten verfeindeter Staaten gegenüberstehen und für den militärischen Sieg ihres Vaterlandes kämpfen. Krieg umfasse dabei den Zeitraum von Kriegserklärung bis zum Friedensschluß und unterliegt den Regeln des Kriegsrechts bzw. Völkerrechts.
Die jüngsten Kriege in Afghanistan und Irak tragen sicherlich dazu bei, dieses Bild bei zu behalten, selbst wenn beide Kriege zeigen, dass ein militärischer Sieg noch lange keinen dauerhaften Frieden zur Folge hat.
Die meisten Kriege seit den 90er Jahren werden dieser Definition jedoch nicht mehr gerecht, da ihre Erscheinungsformen sich grundlegend geändert haben. So konstatiert Herfried Münkler: Die „(..)Staaten haben als die faktischen Monopolisten des Krieges abgedankt, und an ihre Stelle treten immer häufiger parastaatliche, teilweise sogar private Akteure (...), für die der Krieg zu einem dauerhaften Betätigungsfeld geworden ist.“ Demzufolge ist die Anzahl klassischer Staatenkriege (zwischenstaatliche Kriege) rapide gesunken, während immer mehr Kriege innerhalb der Staatsgrenzen ausgetragen werden. Dabei ist oftmals weder ein Anfang noch ein Ende der teils endlos vor sich hinschwelenden Kriegshandlungen auszumachen, was darauf zurückgeführt wird, dass die Kosten des low-intensity-war dem Nutzen der durch die Fortdauer des Krieges erhofften Gewinne mehr als gerecht wird. Schließlich zeigt die Opferbilanz, dass 80% der Getöteten und Verletzten nun Zivilisten sind, wohingegen bis Anfang des 20.Jahrhunderts 90% der Gefallenen und Verwundeten noch Kombattanten waren.
Diese Phänomene faßt Herfried Münkler mit den Begriffen Entstaatlichung bzw. Privatisierung des Krieges, Asymmetrisierung kriegerischer Gewalt und sukzessiver Verselbständigung bzw. Autonomisierung zusammen. Münkler bevorzugt den unscharfen, aber offenen Begriff der “neuen Kriege“ um die Komplexität der Konfliktgründe und Gewaltmotive zu betonen, wobei er auf unverkennbare Parallelen zum Dreißigjährigen Krieg in Europa verweist:
„Die neuen Kriege werden von einer schwer durchschaubaren Gemengelage aus persönlichem Machtstreben, ideologischen Überzeugungen, ethnisch-kulturellen Gegensätzen sowie Habgier und Korruption am Schwelen gehalten und häufig nicht um erkennbare Zwecke und Ziele willen geführt.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung - Was ist neu an den neuen Kriegen?
- Ausgangslage bzw. Ursachen des Kongo-Konflikt
- Staatszerfall unter Mobutu
- Auswirkungen des Völkermordes in Ruanda
- Auslöser und Verlauf des Kongo-Krieg ab 1998
- Der Krieg 1996
- Der Kriegsverlauf ab 1998
- Neuer oder alter Krieg ?
- Die These der sicherheitspolitischen Motive
- Die These der ökonomischen Motive
- Indikatoren für neue Kriegsformen
- Anfang und Ende des Krieges
- Dominanz ziviler Opfer
- Die niedrige Intensität der Kriegsführung
- Die Kriegsökonomie
- Fazit - Der neue alte Krieg
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht anhand des Fallbeispiels Demokratische Republik Kongo die Relevanz des von Herfried Münkler entwickelten theoretischen Ansatzes der „neuen Kriege“ zur Erklärung der Kriegsursachen und der Motive der beteiligten Akteure.
- Staatszerfall und Privatisierung des Krieges
- Die Rolle von Bodenschätzen und Ressourcenkonflikten
- Die Auswirkungen des Völkermordes in Ruanda
- Die Merkmale der „neuen Kriege“ im Kongo-Konflikt
- Die Herausforderungen zur Lösung des Konflikts
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung - Was ist neu an den neuen Kriegen? Dieses Kapitel führt in die Thematik der „neuen Kriege“ ein und stellt die zentralen Merkmale dieser neuen Kriegsformen dar. Es werden die Definitionen von Krieg sowie die traditionellen Kriegsformen mit den aktuellen Entwicklungen im Bereich der Kriegsführung kontrastiert.
- Ausgangslage bzw. Ursachen des Kongo-Konflikt Der zweite Abschnitt beleuchtet die wichtigsten Bedingungsfaktoren für den Kongo-Konflikt. Dabei werden die Rolle des Staatszerfalls unter Mobutu und die Auswirkungen des Völkermordes in Ruanda untersucht.
- Auslöser und Verlauf des Kongo-Krieg ab 1998 Dieses Kapitel beschreibt die Auslöser des Kongo-Kriegs ab 1998 sowie die zentralen Phasen des Konflikts. Es werden die Motive und Strategien der verschiedenen Konfliktparteien beleuchtet.
- Neuer oder alter Krieg ? Der vierte Abschnitt untersucht die Frage, ob der Kongo-Konflikt den Kriterien der „neuen Kriege“ entspricht. Die Analyse fokussiert auf die sicherheitspolitischen und ökonomischen Motive der Konfliktparteien, sowie auf die Indikatoren für neue Kriegsformen, wie z. B. die Dominanz ziviler Opfer und die Kriegsökonomie.
Schlüsselwörter
Demokratische Republik Kongo, Kongo-Konflikt, „neue Kriege“, Staatszerfall, Ressourcenkonflikte, Völkermord in Ruanda, Kriegsökonomie, Kriegstheorie, Herfried Münkler, Bodenschätze, Ressourcenabbau, Machtvakuum, Konflikte, Konfliktforschung, Internationale Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet 'neue Kriege' von klassischen Kriegen?
Neue Kriege (nach Herfried Münkler) sind oft entstaatlicht, werden von privaten Akteuren geführt, haben kein klares Ende und fordern zu 80% zivile Opfer.
Was waren die Ursachen für den Konflikt im Kongo?
Zentrale Faktoren waren der Staatszerfall unter Mobutu, die Auswirkungen des Völkermordes im benachbarten Ruanda und der Kampf um wertvolle Bodenschätze.
Welche Rolle spielt die Kriegsökonomie im Kongo?
Der illegale Abbau von Ressourcen finanziert die Kriegshandlungen, wodurch für die Akteure ein ökonomisches Interesse besteht, den Konflikt dauerhaft aufrechtzuerhalten.
Was versteht man unter der 'Privatisierung der Gewalt'?
Anstelle staatlicher Armeen treten Milizen, Warlords und Söldnergruppen, die aus persönlichen Machtstreben oder Habgier handeln.
Warum ist der Kongo-Konflikt so schwer zu lösen?
Die Gemengelage aus ethnischen Gegensätzen, Korruption und dem Fehlen staatlicher Strukturen macht friedliche Verhandlungen und eine stabile Ordnung äußerst schwierig.
Was bedeutet 'Asymmetrisierung' kriegerischer Gewalt?
Es beschreibt den Kampf ungleicher Gegner, bei dem oft Guerilla-Taktiken gegen Zivilisten oder schwache staatliche Reste eingesetzt werden, anstatt offener Feldschlachten.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2004, Fallstudie: Demokratische Republik Kongo, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52315