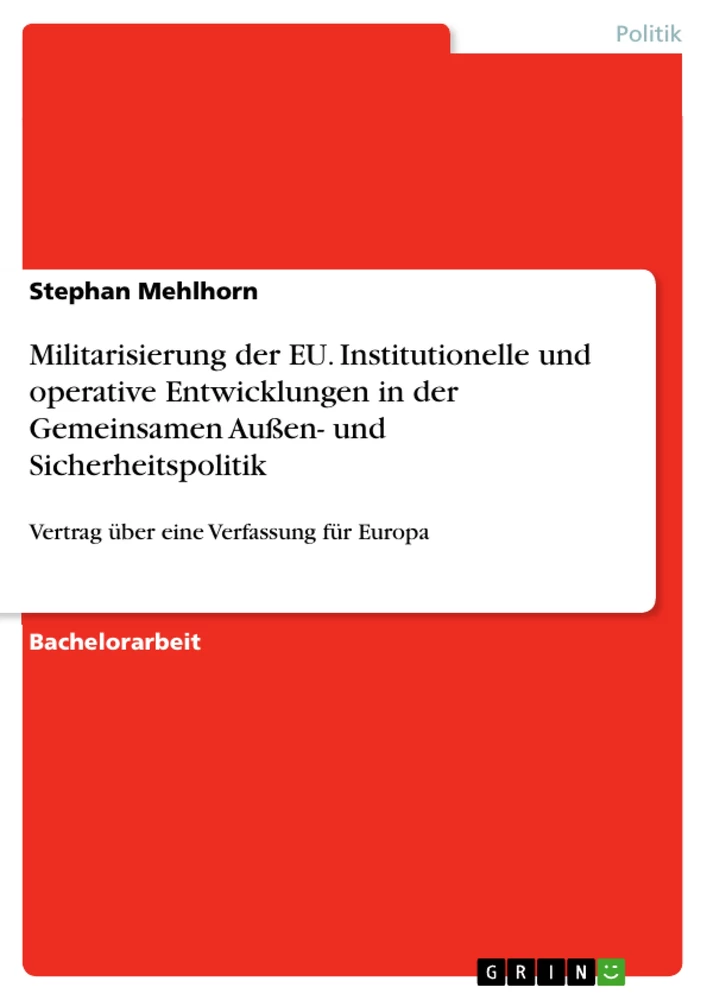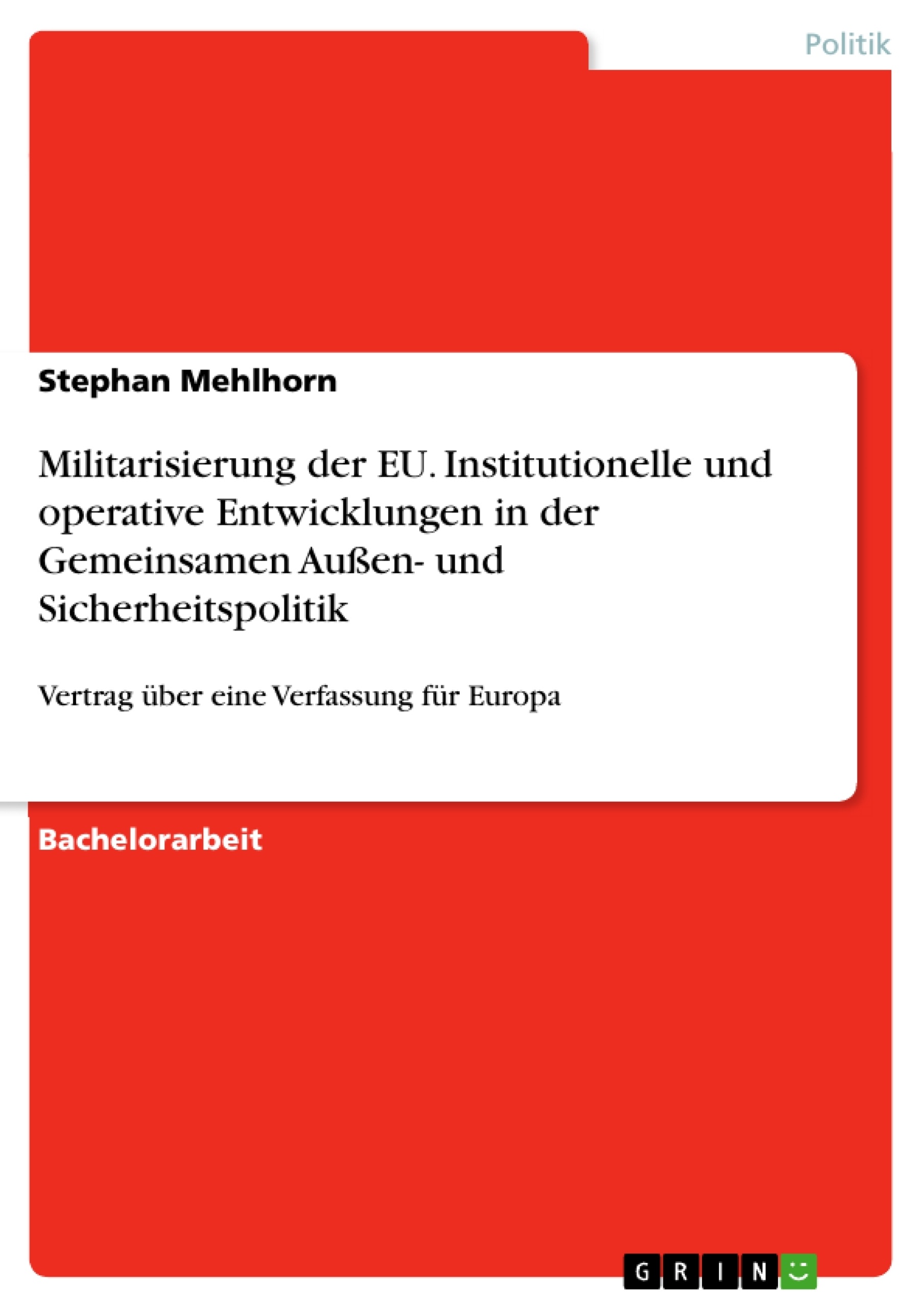Entwickelt sich Europa, respektive die Europäische Union, zu einer Großmacht, die ihrem enormen wirtschaftlichen Einfluss eine ernstzunehmende militärische Stärke zur Seite stellt? In welche politische-ideelle Richtung würde dies zielen. Wäre eine solche Entwicklung eine reine Verteidigungsstrategie oder sind, wie Kritiker behaupten, die ersten Schritte zur offensiven Machtausübung bereits getan? Betrachtet wird dafür die bisherige Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg über die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der 1990er Jahre bis ins 21. Jahrhundert und zum vorläufigen rechtlichen Endpunkt, dem Vertrag über eine Verfassung für Europa. Dieses Verstragswerk ist genauer zu untersuchen, da es sich mit den verteidigungs- und sicherheitspolitischen Aspekten der weiterentwickelten Europäischen Union befasst. Mit diesem Vertrag würde die Verpflichtung zur Aufrüstung für alle Mitgliedstaaten in Verfassungsrang erhoben und ein supranationales Amt zur Überwachung der Rüstungspflicht geschaffen werden. Unter dem Schlagwort Terrorbekämpfung würde die EU berechtigt, Aufstandsbekämpfung selbst auf dem Hoheitsgebiet von Drittstaaten zu unternehmen und die Union ermächtigt, weltweit ohne Bindung an ein UN-Mandat, militärisch zu intervenieren. Neben der Fortführung der bisherigen GASP sollte mit den neuen Bestimmungen in der Verfassung ein quantitativer und qualitativer Sprung in der europäischen Militärpolitik getan werden. Ob dies gelungen wäre, besonders in Hinsicht auf qualitative Verbesserung der Handlungsfähigkeit wird dabei ebenfalls zu untersuchen sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Fragestellung
- 2. Forschungsstand
- 3. Historischer Kontext sicherheitspolitischer Vereinbarungen in Europa
- 3.1. Europäische Verteidigungsgemeinschaft und Europäische Politische Zusammenarbeit
- 3.2. Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik im Spiegel von Maastricht, Amsterdam und Nizza
- 3.3. Vertiefungen durch Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, -union und -identität
- 4. Der Vertrag über eine Verfassung für Europa vom 29. Oktober 2004
- 4.1. Die Sicht der Europäischen Bürger
- 4.2. Der Diskurs im Konvent
- 4.3. Die Artikel betreffend Sicherheits- und Verteidigungspolitik
- 4.3.1. Allgemeine Bestimmungen
- 4.3.2. Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (Artikel 16)
- 4.3.3. Besondere Bestimmungen der GASP und ESVP (Artikel 40 – 41)
- 4.3.4. Ausführen zur Arbeitsweise der Union (Artikel 294 – 312)
- 4.3.5. Die Zusätze
- 5. Organisation, Ausstattung und Einsatzfähigkeiten des Europäischen Militärs
- 5.1. Einrichtungen der Europäischen Union
- 5.2. Bestehende und vorgesehene Truppenkontingente der Union
- 5.3. Sicherheitsexporteur Europäische Union: Zivile und militärische Operationen
- 6. Das gescheiterte Ratifizierungsverfahren und seine Folgen
- 7. Schlussbetrachtung: Sicherheitspolitischer Fort- oder Militaristischer Rückschritt?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die potenzielle Militarisierung der Europäischen Union im Kontext des Vertrags über eine Verfassung für Europa. Ziel ist es, zu ergründen, ob die EU zu einer Großmacht mit militärischer Stärke heranwächst und welche Richtung diese Entwicklung nimmt. Die Analyse betrachtet dabei sowohl die historische Entwicklung der Europäischen Union als auch die konkreten Bestimmungen des Verfassungsentwurfs sowie deren potenzielle Folgen.
- Die Entwicklung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) von den 1990er Jahren bis zum Entwurf der Verfassung
- Die konkreten Bestimmungen des Vertrags über eine Verfassung für Europa im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik
- Die Auswirkungen der Verfassung auf die Organisation, Ausstattung und Einsatzfähigkeiten des Europäischen Militärs
- Die Rolle des Ratifizierungsverfahrens und die Gründe für dessen Scheitern
- Die Frage, ob die Verfassung einen Fortschritt in der europäischen Sicherheitspolitik oder eine Militarisierung der Union darstellt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung und der Fragestellung, die sich mit der potenziellen Militarisierung der Europäischen Union beschäftigt. Kapitel 2 beleuchtet den Forschungsstand zu diesem Thema. Im Anschluss wird der historische Kontext sicherheitspolitischer Vereinbarungen in Europa mit einem Fokus auf die Entwicklung der GASP beleuchtet. Kapitel 4 analysiert den Vertrag über eine Verfassung für Europa im Detail, insbesondere die Artikel betreffend die Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Anschließend werden die Organisation, Ausstattung und Einsatzfähigkeiten des Europäischen Militärs behandelt. Das Kapitel 6 widmet sich dem gescheiterten Ratifizierungsverfahren und seinen Folgen. Die Arbeit schließt mit einer Schlussbetrachtung, die diskutiert, ob die Verfassung einen Fortschritt in der europäischen Sicherheitspolitik oder eine Militarisierung der Union darstellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Fokusthemen dieser Arbeit sind die Europäische Union, die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP), der Vertrag über eine Verfassung für Europa, Militarisierung, Verteidigungspolitik, Truppenkontingente, Ratifizierungsverfahren und Machtpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Wird die Europäische Union zu einer militärischen Großmacht?
Die Arbeit untersucht, ob die EU durch die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) ihre wirtschaftliche Macht um eine ernstzunehmende militärische Komponente ergänzt.
Was sah der EU-Verfassungsvertrag von 2004 militärisch vor?
Er enthielt Bestimmungen zur Aufrüstungspflicht der Mitgliedstaaten und zur Schaffung eines supranationalen Amtes zur Überwachung der Rüstung.
Darf die EU weltweit militärisch intervenieren?
Kritiker bemängeln, dass die Verfassung der EU ermöglicht hätte, auch ohne UN-Mandat weltweit zu intervenieren, beispielsweise zur Terror- oder Aufstandsbekämpfung.
Warum scheiterte das Ratifizierungsverfahren der EU-Verfassung?
Die Arbeit beleuchtet das Scheitern des Verfahrens und diskutiert die Folgen für die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP).
Was ist der Unterschied zwischen GASP und ESVP?
Die GASP bildet den allgemeinen Rahmen der Außenpolitik, während die ESVP (heute GSVP) speziell die verteidigungspolitischen Aspekte und Einsätze abdeckt.
Ist die EU-Militärpolitik ein Fortschritt oder ein Rückschritt?
Die Schlussbetrachtung wägt ab, ob die Entwicklungen einen sicherheitspolitischen Gewinn oder einen bedenklichen militaristischen Rückschritt darstellen.
- Arbeit zitieren
- B.A. Stephan Mehlhorn (Autor:in), 2006, Militarisierung der EU. Institutionelle und operative Entwicklungen in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52446