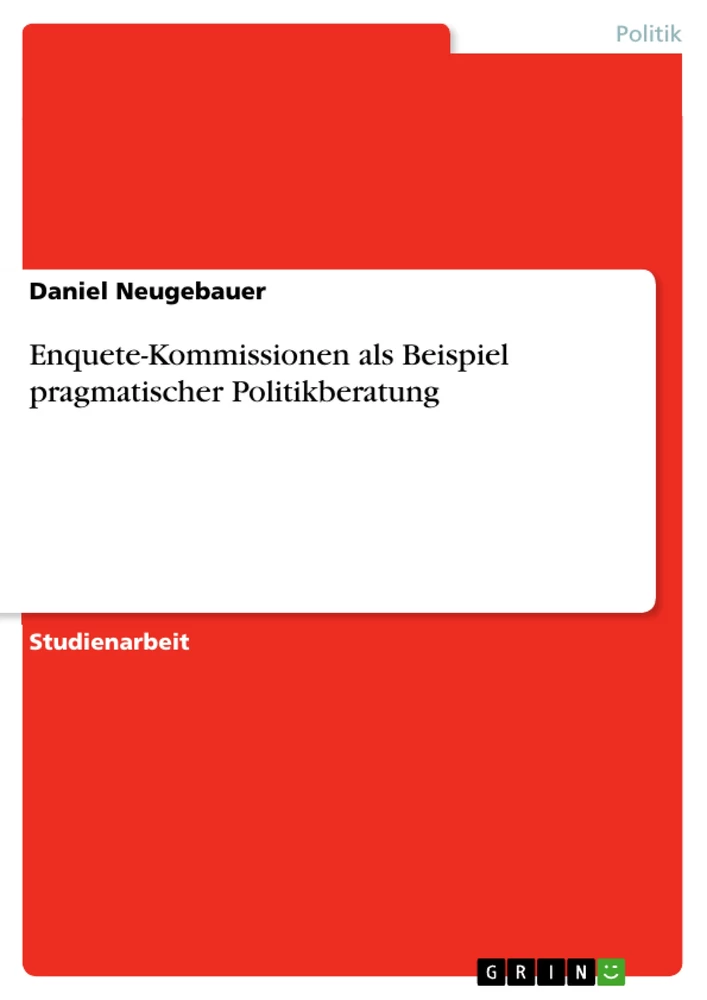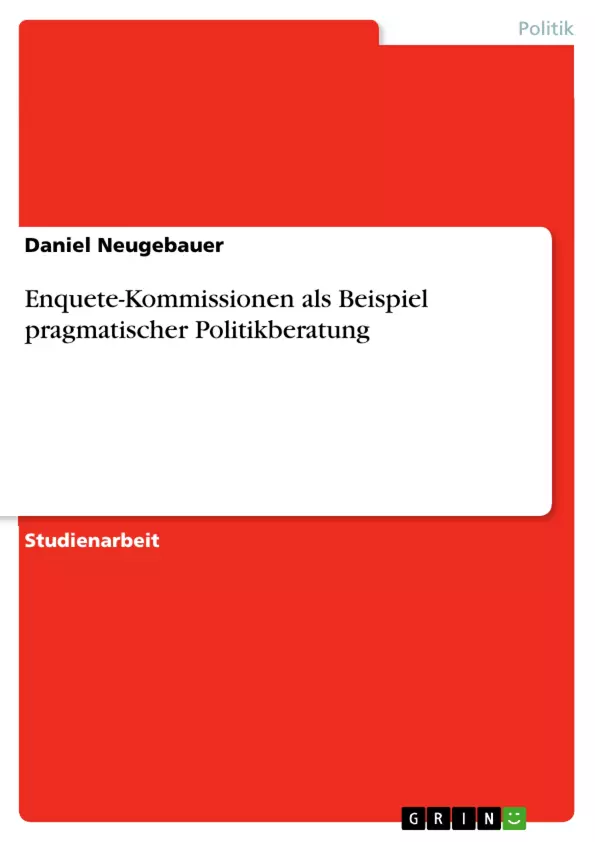Im Rahmen der Geschäftsordnungsreform 1969, die auch unter dem Namen ‚kleine Parlamentsreform’ bekannt wurde, schuf der Bundestag die Möglichkeit, zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfangreiche und bedeutsame Sachkomplexe Enquete-Kommissionen einzusetzen (§ 56 Abs. 1 GOBT). Hintergrund war ein verändertes Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft im Verlauf der 60er Jahre. Hatte sich der Staat bis dahin auf die administrativ-professionelle Kompetenz seiner Beamtenschaft verlassen, wurden nun die Schaffung von verwaltungsinternen Planungs-, Informations- und Analysekapazitäten sowie die Nutzung wissenschaftlicher Beratungsleistungen durch externe Forscher zur Vorraussetzung für modernes Regieren. Von den Enquete-Kommissionen als institutionalisierte Form der Politikberatung wurde eine „Stärkung der Position des Parlaments in all seinen Funktionen“ sowie eine „Verbesserung der Gesetzgebungsarbeit und Kontrolle durch planvollere Behandlung größerer Aufgabenbündel“ erwartet. Die starke Abhängigkeit der Abgeordneten von den Informationen und Vorlagen aus den Ministerien, die keinen Raum für die eigenständige Bearbeitung von Themen ließ, sollte damit der Vergangenheit angehören.
Bis heute hat die Politik auf Bundesebene 23 Enquete-Kommissionen eingerichtet. Die zentrale Fragestellung in dieser Hausarbeit lautet: Hat sich die Enquete-Kommission als Instrument der Politikberatung bewährt? Nach einer gründlichen Darstellung ihrer Entstehungsgeschichte, Rechtsgrundlagen, Zusammensetzung und Arbeit soll untersucht werden, ob die Ergebnisse der Kommissionen Eingang in den Policy Cycle fanden. Ist dies nicht der Fall, soll dargelegt werden, woran die Kommissionen scheiterten. Auf Grund der Materialfülle kann dabei nicht auf jede Kommission eingegangen werden, vielmehr soll die Frage aus der Vogelperspektive beantwortet werden, ohne dabei Unterschiede zu vernachlässigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Zum Begriff der Politikberatung
- 2. Entstehungsgeschichte
- Die Einrichtung des Instituts Enquete-Kommission im Jahr 1969
- Die Bedeutung von Enquete-Kommissionen für die Eigenständigkeit des Parlaments
- Die Aufnahme des neuen § 74a in die Geschäftsordnung des Bundestages (GOBT)
- 3. Rechtsgrundlagen der Enquete-Kommissionen: § 56 GOBT
- a) Aufgabe und Einsetzungsverfahren
- b) Zusammensetzung
- c) Berichterstattung
- 4. Problemerörterung
- a) Einschränkungen hinsichtlich der Gesetzgebungsfunktion
- b) Einschränkungen hinsichtlich der Öffentlichkeitsfunktion
- c) Die Beziehungen zwischen Wissenschaftlern und Politikern
- d) Rechtlicher Status
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Rolle von Enquete-Kommissionen als Instrument der Politikberatung. Sie untersucht, ob sich dieses Instrument bewährt hat, indem sie die Entstehungsgeschichte, Rechtsgrundlagen, Zusammensetzung und Arbeitsweise der Kommissionen beleuchtet und analysiert, ob deren Ergebnisse Eingang in den Policy Cycle gefunden haben. Im Falle eines Scheiterns sollen die Gründe dafür aufgezeigt werden.
- Entstehung und Entwicklung von Enquete-Kommissionen
- Rechtliche Grundlagen und Funktionsweise von Enquete-Kommissionen
- Bedeutung von Enquete-Kommissionen für die parlamentarische Willensbildung und Gesetzgebung
- Die Rolle von Wissenschaftlern in Enquete-Kommissionen
- Bewertung der Effektivität von Enquete-Kommissionen als Instrument der Politikberatung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Politikberatung und die Rolle von Enquete-Kommissionen ein. Sie stellt die zentrale Fragestellung der Hausarbeit dar und skizziert den Forschungsansatz.
- 1. Zum Begriff der Politikberatung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Politikberatung und erläutert verschiedene Modelle der Politikberatung. Es wird deutlich gemacht, dass Enquete-Kommissionen dem pragmatischen Modell der Politikberatung zuzuordnen sind.
- 2. Entstehungsgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte der Enquete-Kommissionen im Kontext der Parlamentsreform von 1969. Es wird die historische Entwicklung und der Wandel im Verhältnis von Politik und Wissenschaft im 20. Jahrhundert dargestellt.
- 3. Rechtsgrundlagen der Enquete-Kommissionen: § 56 GOBT: Dieses Kapitel beschreibt die rechtlichen Grundlagen der Enquete-Kommissionen und erläutert die Aufgaben, die Zusammensetzung und die Berichterstattungsverfahren.
- 4. Problemerörterung: Dieses Kapitel widmet sich einer kritischen Analyse der Enquete-Kommissionen. Es behandelt die Einschränkungen hinsichtlich der Gesetzgebungsfunktion, der Öffentlichkeitsfunktion und des rechtlichen Status der Kommissionen. Es beleuchtet auch die komplexen Beziehungen zwischen Wissenschaftlern und Politikern in diesem Kontext.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Enquete-Kommissionen, Politikberatung, parlamentarische Willensbildung, Gesetzgebung, Wissenschaft und Politik, Policy Cycle, Rechtsgrundlagen und Effektivität von Politikberatung. Sie analysiert die Rolle von Enquete-Kommissionen als Instrument der Politikberatung und untersucht die Herausforderungen und Potenziale dieses Instruments im deutschen politischen System.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Enquete-Kommission?
Es ist ein Gremium des Bundestages, das aus Abgeordneten und externen Sachverständigen besteht, um komplexe und bedeutsame Sachkomplexe für politische Entscheidungen vorzubereiten.
Warum wurden Enquete-Kommissionen 1969 eingeführt?
Ziel war die Stärkung des Parlaments gegenüber der Regierung durch die Nutzung externer wissenschaftlicher Expertise („kleine Parlamentsreform“).
Haben sich Enquete-Kommissionen als Instrument bewährt?
Die Arbeit zieht eine gemischte Bilanz: Während sie die Debattenkultur fördern, finden ihre Ergebnisse nicht immer direkten Eingang in die Gesetzgebung (Policy Cycle).
Wie setzen sich Enquete-Kommissionen zusammen?
Sie bestehen zu gleichen Teilen aus Mitgliedern des Bundestages und externen Wissenschaftlern bzw. Experten, die von den Fraktionen benannt werden.
Was sind die rechtlichen Grundlagen für diese Kommissionen?
Die Einsetzung und Arbeit ist in § 56 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages (GOBT) geregelt.
- Quote paper
- Daniel Neugebauer (Author), 2004, Enquete-Kommissionen als Beispiel pragmatischer Politikberatung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52497